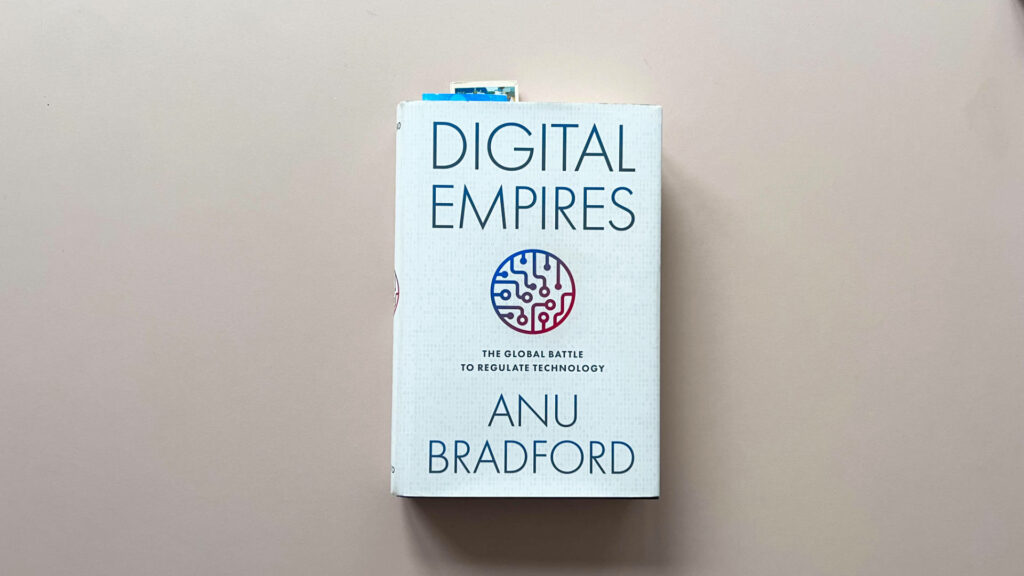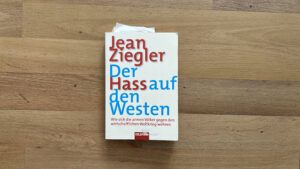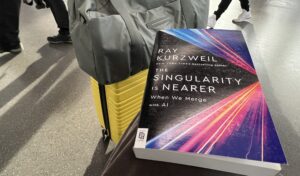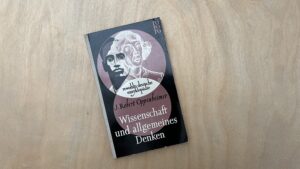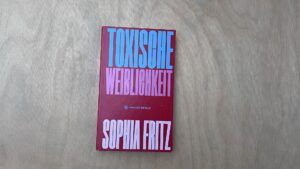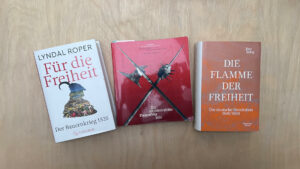Das Internet ist nicht mehr global. Diverse Internetvarianten stehen einander gegenüber, bekämpfen einander teilweise, suchen mit verschiedenen Mitteln Vorherrschaft und Marktmacht und konkurrieren um Einfluss in noch unentschiedenen Märkten. Anu Bradford beschreibt, wie unterschiedliche Formen von Digitalpolitik in den USA, in China und in der EU unterschiedliche Prioritäten setzen. Ihre Schlussfolgerung ist geradezu versöhnlich: Europa werde sich durchsetzen, denn auch in den USA mache sich zunehmend Kritik am rein marktorientierten Governancemodell breit, die überbordende Macht der Techkonzerne werde kritisch betrachtet und es gebe mehr und mehr Bereitschaft, auch von den USA aus Technologie und Digitalmarkt in Regeln zu fassen.
Das Buch erschien 2023, bevor sich abzeichnete, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft Realität werden könnte.
Der Sturm auf das Kapitol vom Jänner 2021 ist eines der Beispiele, das auch den USA die politische Macht und Gefahr digitaler Politik vor Augen geführt habe. Der Großteil der von Biden verabschiedeten Digitalregelungen ist schon wieder – im ersten Monat von Trumps Regierungszeit – außer Kraft gesetzt. Die von Bradford nur kurz als absurd gestreifte Option, die USA könnten sich auf die digitale Seite Chinas und damit Russlands stellen, ist dabei, Realität zu werden.
Die Diagnose dieses Buches steht damit auf wackligen Beinen, die Analyse ist umso relevanter.
Bradford beschreibt das US-Internet-Governance-Modell als marktorientiertes und freiheitsbetontes, das staatliche Einmischung vermeide und Regeln als Innovationshürde betrachte.
Gegenpol dazu ist das chinesische Modell, das Staat und Partei an erster Stelle sieht, Innovation an staatliche Vorgaben und Programme bindet und massiv in Märkte und Geschäftsmodelle eingreift, um mögliche Fehlentwicklungen zu korrigieren.
Europa verfolgt ein rechtegetriebenes Modell, in dem Daten- und Konsumentenschutz im Vordergrund stehen. Damit kommen weniger eigene Innovationen in den Markt, aber Europa gibt vor, nach welchen Regeln Innovation in den Markt kommt. Denn solange Europa ein interessanter Markt für globale Unternehmen ist, sind diese bereit, Auflagen zu erfüllen.
Bradford nennt diese Dreiteilung die horizontale Seite des Kampfs um digitale Vorherrschaft. Dazu kommt die vertikale Dimension, in der einander Staaten, Unternehmen und Zivilgesellschaft gegenüberstehen.
Das freiheitsorientierte Digitalmodell der USA basiert teilweise auf veralteten Voraussetzungen. Die Section 230-Regel, die Betreiber digitale Dienste weitestgehend von der Verantwortung für Inhalte freispricht, stammt aus den Neunziger Jahren. Damals waren Dienstebetreiber vorrangig Provider, die Server und Leitungen zur Verfügung stellten und tatsächlich nichts mit Inhalten zu tun hatten. Das hat sich deutlich verändert. Eine andere Schwäche des digitalen Freiheitsgedankens: Die USA halten sich selbst nicht daran. Aufgedeckte Überwachungs- und Spionagefälle zeichnen ein anderes Bild als das des vom Staat unberührten Internet. Und um kritische Märkte zu erschließen, werden die Freiheitsprinzipien ebenfalls flexibel gehandhabt. Apple macht 20 Prozent seines globalen Umsatzes in China, hat dazu eine eigene, kontrollierte Appstore-Instanz ins Leben gerufen und lagert die Daten chinesischer Nutzer in einem chinesischen Datawarehouse, dess Betreiber im Zugriff der chinesichen Regierung steht. Microsoft hat noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges russische Cyberattacken auf ukrainische Behörden-Netzwerke registriert und Regierungen informiert. Die USA treffen damit auf öfters auf Kritik. Ein Kritikpunkt betrifft Scheinheiligkeit und Glaubwürdigkeit, ein andere die Skepsis von Staat gegenüber digitalen Freiheit.
Beides spielt letztlich dem chinesischen Modell in die Hände. Autokraten aller Größenordnungen in Europa, Afrika und Asien sind gegenüber Möglichkeiten, das Internet strikt zu regulieren, durchaus aufgeschlossen. Wo Staatsinteressen im Vordergrund stehen, sollen Einzelinteressen kontrolliert und zurückgedrängt werden können. China bietet dafür Infrastruktur, Überwachungstechnologie und Governancemodelle, die auch die stärksten Unternehmen klein halten. Die Kommunistische Partei verhängt Milliardenstrafen gegen börsenotierte Konzerne, ordnet Merger oder Aufteilungen an und verbietet chinesischen Konzernen Börsegänge in den USA, wenn dafür Daten offengelegt werden müssten. Alibaba-Gründer Jack Ma ist Parteimitglied. Soziale Harmonie ist die Keule, mit der Abweichungen wieder eingefangen und notfalls eingestampft werden. Der Sturm auf das US Kapitol im Jänner 2021 sei in chinesischen Medien ein Paradebeispiel dafür, was passiere, wenn digitale Medien nicht im Sinne der Gemeinschaft kontrolliert würden. Zensur und Medienkontrolle funktioniert sehr gut – vor allem auch, weil Jahrzehnte von Zensur und kontrollierten Medien dazu geführt haben, dass Menschen den Umgang mit Medien und Information verlernt haben. China gibt strenge Regeln vor, sperrt andere aus dem chinesischen Markt aus, drängt selbst aber sehr aktiv auf andere Märkte.
Bei der Einschätzung der Capitol Riots treffen einander China und Europa, allerdings von verschiedenen Seiten. In Europa stehen Bürgerrechte im Vordergrund, nicht der Staat. Das prägt die Digitalgesetzgebung – und das bringt Europa den Ruf ein, Innovation durch Regeln abzuwürgen. Diesen Einwand betrachtet Bradford allerdings skeptisch. Auch vor der DSGVO, der ersten großen und tiefgreifenden Digitalregelung, sei wenig erfolgreiche Innovation aus Europa gekommen. Relevanter seien Probleme wie Sprachbarrieren, fehlende Regelungen für einen einheitlichen Binnenmarkt und der Umgang mit unternehmerischem oder finanziellem Risiko. Überdies seit die EU-Verwaltung, die nur ein Prozent des EU-BIP ausmache, deutlich kleiner dimensioniert als die US-Verwaltung, die 20 Prozent des US-BIP verschlinge. Europäische Regulierung wird als innovationsbremsend, protektionistisch und revanchistisch gegen erfolgreiche US-Konzerne kritisiert. Allerdings verfolgen europäische Regulierungen auch marktverzerrende Förderungen – und richten sich damit auch gegen staatliche Einflussnahme auf den Digitalmarkt.
Was Europa laut Bradfords Analyse zugutekommen kann, ist ein stärker aufkeimendes Bewusstsein um die Relevanz digitaler Souveränität. Die USA verfolgen dieses Ziel mit Macht- und geldorientiertem Imperialismus, China setzt auf Infrastrukturimperialismus, die EU hält mit Regulierungsimperialismus dagegen. Nur letzterer steht allen Staaten offen. Bradford bezeichnet es als Brussels Effect, wenn sich auch Staaten und Unternehmen, die das gar nicht müssten, an EU-Prinizipien orientieren. Das geschieht einerseits aus politischen Gründen, um demokratische Einflussnahme zu sichern, andererseits aus wirtschaftlichen: Wenn Unternehmen strenge EU-Auflagen erfüllen, um in der EU operieren zu dürfen, wenden sie diese Grundsätze überall an, weil das oft effizienter ist, als unterschiedliche Standards und Regelsysteme zu verwalten. Damit gewinnt insgesamt Europa wieder ein wenig Oberhand – zumindest so lange, wie sich US-Konzerne nicht ausdrücklich gegen die EU stellen. Letzteres zeichnet sich gerade ab.
China betreibt neben seinem Infrastrukturimperialismus, der als neue Digitale Seidenstraße Technologie, Infrastruktur, chinesische Standards, in Hard- und Software verbaute chinesische Grundsätze und chinesische Überwachungstechnologie exportiert, noch eine zweite Strategie. Es ist großteils Folge chinesischer Initiative, dass Digitalthemen in den letzten Jahren jetzt auch stärker auf UN-Ebene verhandelt und reguliert werden. Das entzieht die Digitalgesetzgebung ein Stück weit dem Einfluss von EU und USA, das erhöht staatlichen Einfluss dort, wo bislang zivilgesellschaftlich verwaltet wurde, und das schafft eine neue Bühne, auf der Staaten auf eine multipolare Welt pochen können, die nicht nur vom Westen geprägt werden soll, auf der man sich Einmischung in innere Angelegenheiten verbitten kann und die Platz für flexible Interpretationen von Menschenrechten bietet. Letzteres ist eine beliebte Diskursstrategie von Autokraten. Russland gefällt das. Und die Entscheidungen zu UN Global Digital Compact und UN Cybercrime Convention dokumentieren das.
Diese schleichend autoritäre Tendenz in UN-Digitalpolitik, das Kippen der USA und der großen US-Techkonzerne, die Annäherungen zwischen den USA und Russland, der Erfolgslauf chinesischer Technologie und die Schwäche Europas gegenüber anderen Weltregionen säen Zweifel an Bradfords Europa-optimistischer Diagnose. Und selbst wenn sich Europa durchsetzt, wenn der Regulierungs- und Bürgerrechtsgedanke siegt: Was kann man sich darum kaufen? In welche reale Macht lässt sich das ummünzen? Wie verleiht das Stärke?
Vielleicht sind das auch genau die falschen Fragen: Weisen solche Fragen darauf hin, dass Fragesteller bereits den Wert von Freiheit und Privatsphäre für alle über Bord geworfen haben und sich stattdessen mit der Vorstellung von Macht für wenige anfreunden.