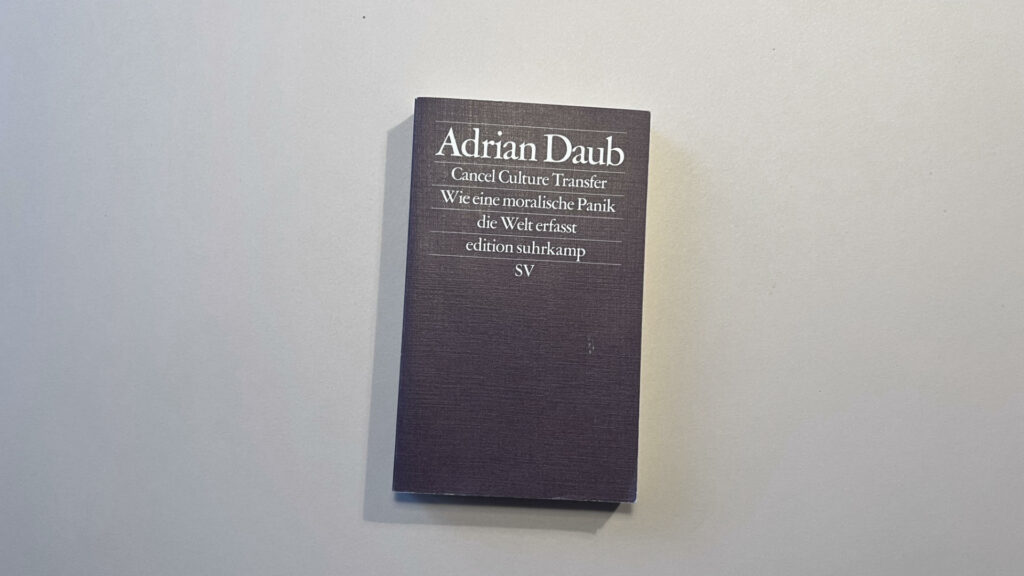Die Erwähnung von Cancel Culture ist oft ein verlässlicher Indikator dafür, dass man gerade einen geist- und belanglosen, großteils faktenfreien Text liest, in dem in der Regel kulturpessimistisch eingestellte Schreibende Phrasen recyceln. Verschärft wird dieser Umstand, wenn Umstände an nicht näher genannten „amerikanischen Universitäten“ als Belege genannt werden.
Adrian Daub zeichnet die Entstehungsgeschichte des Begriffs und seiner Übersiedlung aus den USA nach Europa mit einer Fülle historischen Materials nach. So klärt er etwa auch die Frage, was mit Canceln eigentlich gemeint ist. Ist es tatsächlich Auslöschung, radikales Entfernen, Beseitigen, das an Wegsperren und Straflager mahnt? Die historischen Ursprünge dürften in dem Hashtag #cancelcolbert liegen, mit dem eine Twitteruserin eine missglückte Parodie von Stephen Colbert kommentierte (für die dieser sich später entschuldigte). Cancel bezog sich auf das Absetzen einer Fernsehshow, halbironisch gebraucht von einer Twitteruserin. Die Reaktionen auf diesen Tweet blieben einstellig. Colbert stieg weiter zu einem der erfolgreichsten Comedians der Welt auf.
Cancel Culture funktioniert als Konstrukt der Kritik ähnlich wie Political Correctness. Der Begriff ist eine vage Umschreibung für eine Ansammlung anzuklagender Punkte, konkrete Inhalte können dabei wechseln. Jene, die in den Beschreibungen der Kritiker Cancel Culture betreiben, haben dagegen meistens keinen klaren Begriff von dem, was sie vermeintlich tun.
Cancel Culture-Erzählungen strapazieren Anekdoten und versteigen sich von dort zu unspezifischen Verallgemeinerungen. Daub exerziert das an einer Fülle von gut dokumentierten Beispielen vor. Besonders ergiebige Beispiele liefern dafür Ulf Poschardt und andere One Trick Ponys aus dem Feuilleton. Berühmt ist auch der sogenannte Flipchart-Hoax, den unter anderen sich gecancelt fühlende Berühmtheiten wie Jordan Peterson strapaziert haben. In wechselnden Unternehmen (bei Peterson war es eine Bank) soll das Wort Flipchart aus dem Sprachgebrauch verbannt worden sein, weil es an die Bezeichnung “Flip” für Menschen von den Philippinen erinnere. Das soll Menschen, die sich dagegen verwehren wollten, in Burnout oder andere Probleme getrieben haben. Peterson erzählt die Geschichte als Erlebnis einer seiner Patientinnen. Die Story wurde allerdings einige Jahre vorher (und auch danach) immer wieder in wechselnden Zusammensetzungen mit anderen Unternehmen und ohne Bezug auf Peterson erzählt.
Die Erzählungen der Cancel Culture-Kritiker sind meist vage oder, wie bei Peterson, hyperspezifisch genug, um weder verifiziert noch widerlegt werden zu können.
Die aggressivsten Formen angeblicher Cancel Culture dagegen lassen sich in ihren Wurzeln recht gut zu den Sprachspielen von Black Twitter zurückverfolgen, zu einer Sprachkultur, die sich nicht an das unverständige Publikum wendet, die sich eigentlich an überhaupt niemanden wendet und keine konkreten Reaktionen erwartet oder Folgen bewirken will, sondern eher eine Art der Poesie darstellt. Sich davon angesprochen zu fühlen – das kann nur zu Missverständnissen führen. Die Darstellung von Daub erinnert an die Auseinandersetzung von Henry Louis Gates mit beleidigenden Rap-Texten, die Gates auf die Figur des Signifying Monkey, einer Legendengestalt der Yoruba zurückführte. Sich von Trash-Talk beleidigt zu fühlen oder eine andere Form der persönlichen Betroffenheit in diesen Texten zu suchen, ist also etwa ähnlich, als würde sich heute jemand von den Texten von Abraham a Sancta Clara oder Francois Villon beleidigt fühlen.
Problematisch ist an Cancel Culture-Texten vor allem, dass sie im gut situierten Feuilleton stattfinden, sich nicht an die angeblich Cancelnden richten, um etwas über deren Gründe zu erfahren oder sie vom Canceln abzuhalten, sondern dass sie sich an ein dankbares Publikum richten, das sich gerne gruselt und empört. Cancel Culture-Kritik ist ein Ritual zur eigenen Bestätigung, das, das schreibt Daub über die New York Times, vor allem Unbehagen darüber zum Ausdruck bringt, dass andere Zuhören und Mitreden dürfen und man nicht unter sich ist. Die Stimmen von außen werden als falsch empfunden. Wenn sie bezug auf identitätspolitische Argumente nehmen, sind sie überdies zu emotional; die Kritik daran dagegen wird als Kern der Vernunft gesehen.
Daub sammelt eine Reihe weiterer Belege für die schlechte Argumentationsqualität von Cancel Culture-Kritik, streift Identitätspolitik, Gendern und andere Verwandte dieser Debatten und weist auch auf die teilweise großzügige Dotierung von Cancel Culture-Kritik oder angeblicher Cancel Culture-Dokumentation durch konservative Stiftungen und Think Tanks hin.
Gibt es einen Ausweg aus diesem recht festgefahrenen Dilemma, in dem seit über 30 Jahren, seit dem Aufkommen der ersten Political Correctness-Kritik, keine neuen Argumente mehr greifen? Daub erwähnt eine Möglichkeit gleich zu Beginn seines Texts: Diejenigen, die ohnehin nicht gemeint sind, die von Cancel Culture nicht betroffen sind, könnten schlicht von etwas anderem reden. Das ist allerdings insofern unwahrscheinlich, als sich die mit Cancel Culture-Kritik einhergehende Inszenierung für viele auch als Prominenzbooster erwiesen hat. Nachvollziehbare Fälle von Canceln finden sich dagegen eher unter Schwächeren: Daub skizziert dazu Diskussionen aus gender- und herkunftssensibler Fantasyliteratur. Dort kann der falsche Ton zu bestimmten Identitäten tatsächlich Karrieren beenden, bevor sie begonnen haben – aber auch aus diesem Milieu zitiert Daub Fälle, in denen Kritik von konservativen Zeitungen aufgegriffen und in Karriereturbos verwandelt wurde.
Daub fasst Cancel Culture-Kritik als Fälle kultureller und moralischer Panik zusammen. Und ein wesentliches Merkmal von Panik ist es eben, nicht mehr so genau hinzusehen auf das, wovor man sich fürchtet …