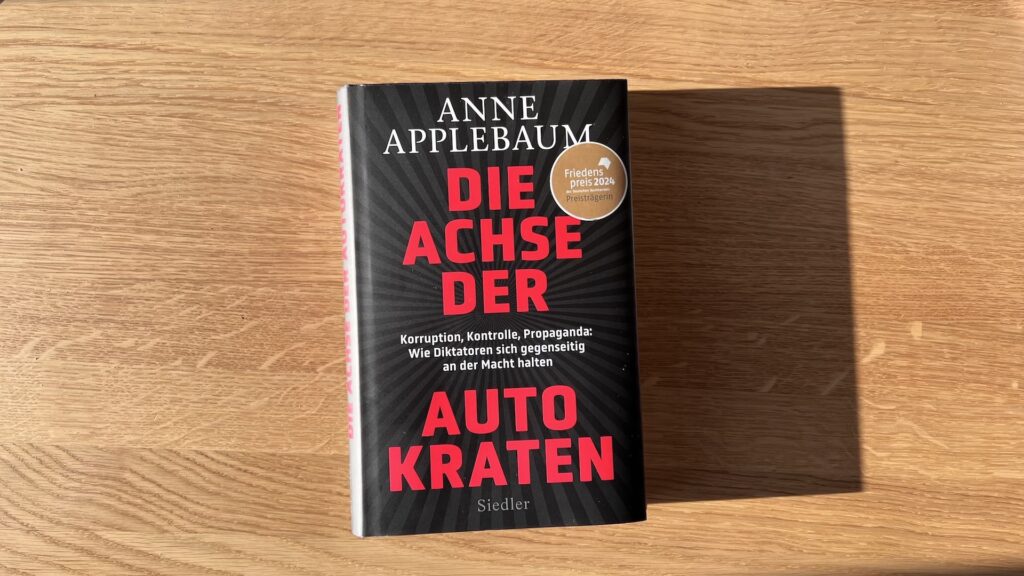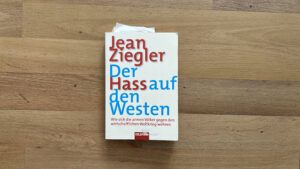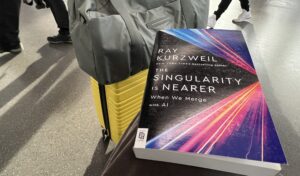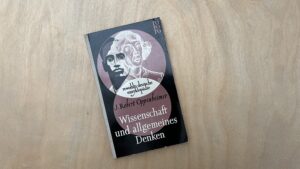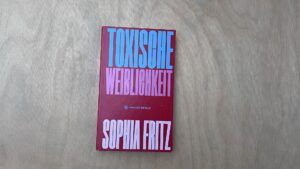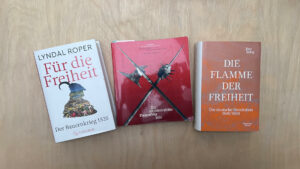Ein Autokrat kommt nicht allein. Annäherungsversuche und Handelsbeziehungen haben aus einst ärmlichen Staaten, deren Drohgebärden wenig Realität enthielten, mächtige Gegner gemacht. Und mittlerweile sind viele Autokratien stark und selbstbewusst genug, einander auch gegenseitig zu stützen. Embargos gegen international geächtete Staaten wirken heute kaum noch – denn diese finden problemlos neue Handelspartner, neue Märkte und andere Freunde. Auch die sehr breit unterstützten Embargos gegen Russland zeigen aktuell erst recht langsam Wirkung.
Applebaum beschreibt, wie Netzwerke autokratisch regierter Staaten im Großen ähnlich gut funktionieren wie Pfuschernetzwerke im Kleinen: Man braucht fast nichts mehr von den anderen, alle Bedürfnisse können auf der eigenen, dunklen Seite der Macht gedeckt werden.
Ein zweiter relevanter Aspekt in Applebaums Buch ist die Möglichkeit neuer Erzählungen. Moderne Autokratische Staaten sind nicht mehr in Opposition gegen den Westen (oder Norden, oder Kapitalismus). Sie erzählen eigene Geschichten von Diversität, Multilateralismus und Multipolarität. Und sie stellen sich selbstbewusst gegen „Einmischung in innere Angelegenheiten unter dem Vorwand von Demokratie und Menschenrechten“. Diese Floskel ist wörtlich häufig in digitalpolitischen Diskussionen zu hören. Mit der – von Russland dominierten – UN Cybercrime Convention haben sich autoritäre Staaten eine Grundlage geschaffen, solche „Einmischungen“ abwehren und auch verfolgen zu müssen. Unterzeichner dieser Convention (auch Österreich will unterzeichnen) müssten ihnen dabei helfen, diese Einmischer, also beispielsweise NGOs oder Dissidenten im Exil, zu verfolgen. In seiner Zustimmung zum UN Global Digital Compact legt China eine eigenartige Interpretation von Menschenrechten an den Tag und verwehrt sich ebenfalls gegen „Einmischung“. Das wichtigste Menschenrecht sei das Recht auf Wirtschaftswachstum.
Multipolarität, eigene Interpretationen von Menschenrechten, Nichteinmischung – mit diesen Schlagworten punkten Autokratien auch bei afrikanischen und südamerikanischen Staaten, die gar nicht grundsätzlich autokratische Tendenzen haben, für die das Begriffsgemisch aber eine willkommene Grundlage zur selbstbewussten Distanzierung von Westen und Norden bietet.
Diese neuen Erzählungen tragen zu Misstrauen und neuen Streitthemen bei. Sie sind auch Kern der zeitgemäßen autokratischen Taktik gegenüber Opposition und Dissidenten. Diskreditierung und Rufmord sind effizienter als Gewalt, Folter und Mord, die am Ende neue Märtyrer schaffen.
Diese Kombination aus Misstrauen, Medienmanipulation und Uminterpretation von Menschenrechten und demokratischen Grundsätzen ist der eigentliche Sprengstoff, den der Aufstieg von Autokratien birgt. Deren neue Erzählungen sind erfolgreich – und in einer zunehmend kaputten Medien-, Politik- und Kulturwelt kennt bald kaum noch jemand jener, die mit diesen autokratischen Erzählungen aufwachsen, deren Grundlage. Menschenrechte, Liberalismus und Freiheit werden so zunehmend zu Zerrbildern – durch jene, die sie ungeschickt verteidigen fast ebenso wie durch jene, die sie attackieren.