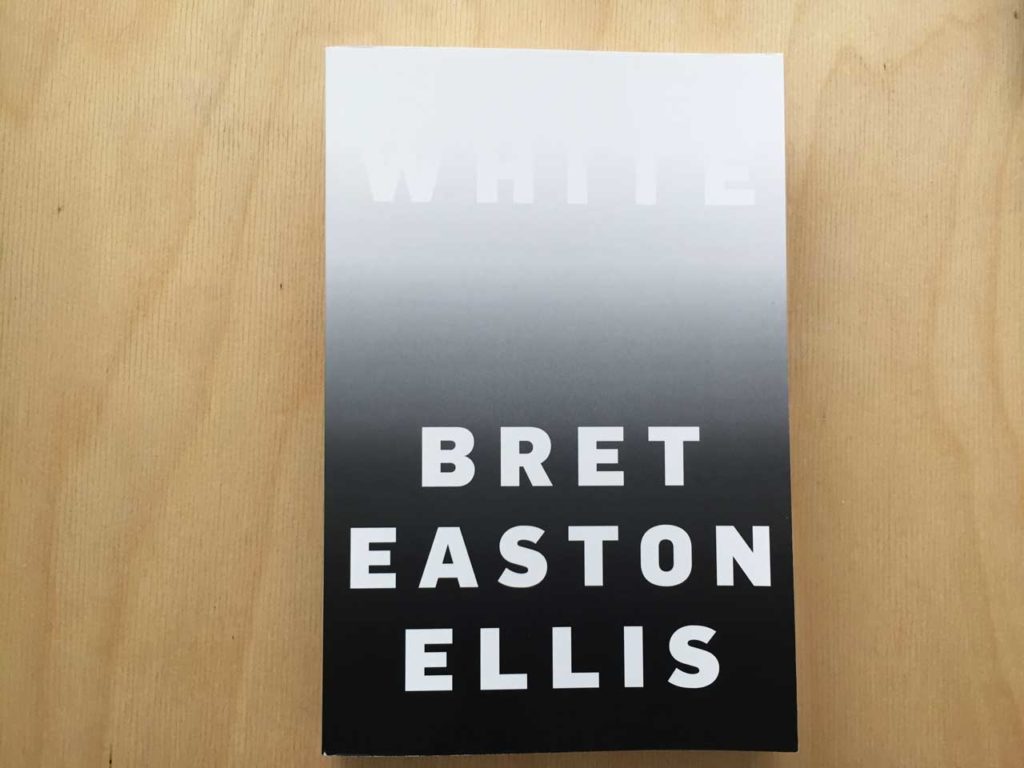Bret Easton Ellis bringt mit „White“ sein erstes Buch seit über zehn Jahren heraus. Die Werbung verkauft „White“ als Auseinandersetzung eines Starautors mit Social Media und lässt eine Auseinandersetzung mit Entwicklungen in Diskurs und Medien und deren Auswirkungen auf – naja, wichtige Dinge eben, erwarten.
Das leistet das Buch nicht ganz.
„White“ ist eher das Zeugnis des Unbehagens eines alternden Starautors mit neuen Werten und Prioritäten. Ellis ist Mitte fünfzig und war es gewohnt, lange entlang des Zeitgeists zu schreiben. Seine Porträts der 80er Jahre ließen sich mühelos auch in die 90er Jahre hinüberretten – zumindest für die Szenen, über die Ellis schrieb. Später, als das Jahr 2000 auch schon länger vorbei war, erhöhte man einfach die Dosis der Psychopharmaka.
Ich halte Ellis keinesfalls für ein One Hit Wonder – im Gegenteil, ich fang Lunar Park (2009 erscheinen) auf allen Ebenen um Hausecken besser als American Psycho; eigentlich ist Lunar Park für mich bis heute Ellis’ einzig wirklich gutes Buch.
Insofern schreibt Ellis kein Klagelied eines auf dem Abstellgleis Gelandeten, hier spricht eher das ehrliche Staunen desjenigen, der feststellen muss, dass die aktuelle Zeit mich mehr die seine ist.
Die Ratlosigkeit der Entertainment-Elite
„White“ hat starke Momente. Etwa dann, wenn Ellis erklärt, dass er die Lust verloren hat, zusammenhängende Gedanken und Storys zu entwickeln, wenn nichts altmodischer und unattraktiver ist als ein Roman. Wenn Kleinteiligkeit der Königsweg zur Aufmerksamkeit ist und damit auch zu immer kleineren Formaten und letztlich kleineren Gedanken führt. Wenn auch der unhinterfragte Bestsellerautor, der mehrfach bewiesen hat, dass er kommerziell erfolgreich sein kann, auch ohne jede sich anbietende PR-Welle zu surfen, angesichts kultureller Entwicklungen rat- und lustlos wird.
Dann biegt er allerdings wieder ab und verliert sich auf den nächsten mehr als hundert Seiten in popkulturellen Rants und Referenzen, die ich schon in seinen Romanen immer wieder langweilig fand. Es ist auch ein recht passend, dass diese Rants – wenige Seiten nachdem Ellis zunehmende Beliebigkeit beklagt hat – ihrerseits vollkommen subjektiv und beliebig sind. Als Leser staunt man eher über den weitgehend distinktionslosen Pop-Geschmack des sonst so bissig kritischen Ellis, wobei ich zumindest auch sagen muss: 85 Prozent der Filme und Musikveröffentlichungen, die Ellis als epochal und stilbildend referenziert, kenne ich nicht, weitere zehn Prozent sind mir reichlich egal, auf den Rest können wir uns einigen. – Das, um kurz abzuschweifen, zeigt einerseits die angesprochene Beliebigkeit aber es zeigt auch, dass die manchmal so weltumspannend und weltbeherrschend scheinen US-Popkultur über weite Strecken auch nur ein lokales US-Phänomen ist.
White – wie reinweiß oder wie nicht schwarz?
Wenn Ellis dann wieder auf seine Spur findet, geht es mit ein paar Rants über Millenials und Snowflakes weiter, über Meinungen und Beleidigungen und darüber, was man den eigenen Überzeugungen widersprechenden Meinungen und Kunstwerken man aushalten können sollte.
Ellis schreibt dabei nicht über politische Korrektheit – so platt wird er nicht. Er beschreibt eher eine Wohlfühlkultur, die keinen Widerspruch erträgt, die keine Schattierungen anerkennen will und die bei jeder Gelegenheit nach den großen Keulen ruft. Trump zum Beispiel ist für Ellis nur ein Achselzucken wert. Als bekennender Nichtwähler ist der Präsident nur ein weiterer Präsident, der auch wieder Geschichte sein wird – während sich das Land über die richtige Einstellung zu Trump zerstreitet; am lautesten streiten für Ellis dabei die, die am wenigsten davon betroffen sind.
Darin ist wohl auch ein Hinweis auf die Wahl des Titels zu sehen: „White“ verweist einerseits darauf, dass Nuancen und Schattierungen nicht gerade die Stärken unserer Zeit sind. Zugleich steht der Titel aber wohl auch dafür, dass die meisten von Ellis beschriebenen Symptome die Probleme einer weißen amerikanischen Mehrheitsgesellschaft sind. So interpretieren dass zumindest einige Rezensenten, die sich dafür aber auch der Frage aussetzen müssten, ob sie etwa glauben, dass diese kränkelnden Eigenschaften etwa in anderen Bevölkerungsgruppen, in denen man noch andere Sorgen hat, nicht auftreten würden.
Von Ellis ist hier keine Antwort zu erwarten. Er beschreibt, analysiert aber nicht. Er beleidigt wohl viele, urteilt aber nicht. Er will weder vorwärts noch zurück in eine bessere Zeit. Aufgeklärte Europäer sind da eher an Taten orientiert. Von klein auf an Psychopharmaka gewöhnte Westküstenbewohner sehen dem Drama entspannt von der Designercouch aus zu.
Man kann durchaus einen Schritt weitergehen, als Ellis es in seinem Buch vorzeigt. Aber ich finde es auch anerkennenswert, dass jemand, der noch immer mit der Axt und der Kettensäge eines American Psycho im Kopf nicht mit der merkwürdigen Besserwisser-Rage eines Carlo Strenger schreibt (die von manchen Rezensenten beschriebene Wut habe ich in „White“ nicht gefunden).
Und noch besser finde ich, dass Ellis auch in einem Nonfiction-Buch Entertainer und Bestsellerautor bleibt und sich nicht zum mäandernden Gesellschaftsphilosophen aufschwingt. Da bleibt noch genug Luft.