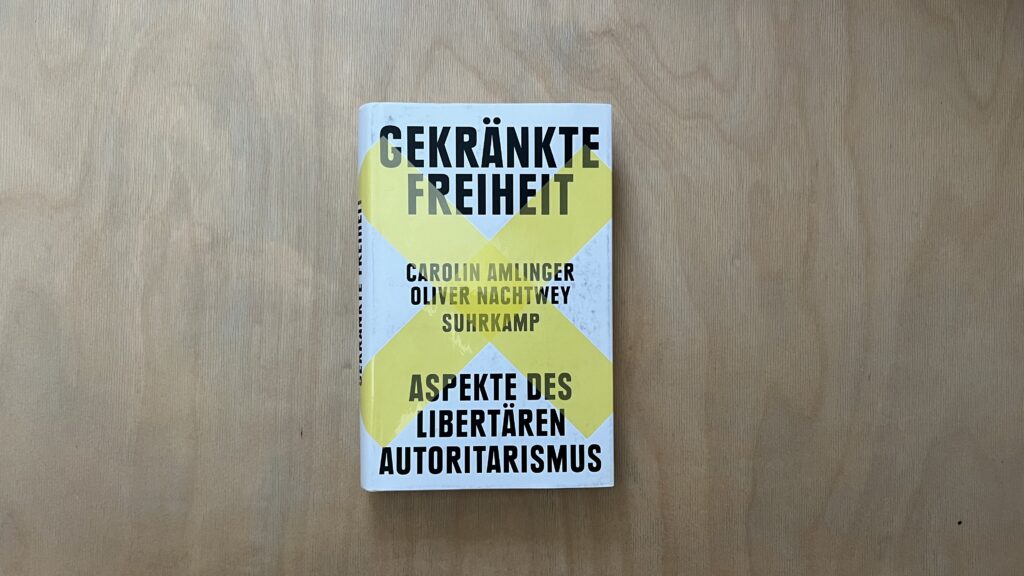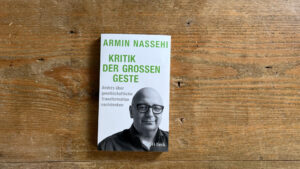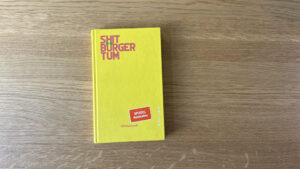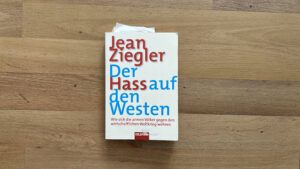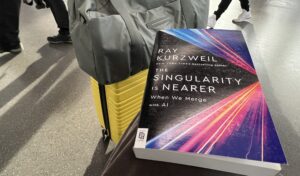Menschen, die man grundsätzlich als zurechnungsfähige Personen kennt, beharren mit der Sturheit von vollkommenen Idioten auf unsinnigen Behauptungen. Um der Aufregung willen beharren andere mit ähnlichem Talent auf sinn- und kontextbefreiten Wortklaubereien, um aktuell Unliebsamen Unsinn andichten zu können. Diese Konversationen vollziehen sich mit Ernst und Eifer in autoritärer Rechthaberei, in der Lösungen oder Wahrheiten das Uninteressanteste sind. Man kennt das von Politmobs auf Social Media, von Querdenkern und häufig auch bei vermeintlich hyperrational argumentierende Ökonomieinteressierten.
OLiver Nachtwey und Caroline Amlinger bezeichnen diese Form der radikalen Rechthaberei als libertären Autoritarismus. In der Studie “Gekränkte Freiheit” holen sie weit aus, um einer Reihe von Interviews mit dieser neuen Spielart von Autoritären einen Theorierahmen zu verpassen.
Die Grundzüge ihrer Diagnose:
Spätmoderne Freiheitsabsolutisten verdrängen Abhängigkeiten von gesellschaftlichen Institutionen, sie betrachten Freiheit als Ding, als isoliertes Objekt, das sie beanspruchen und besitzen können, nicht mehr als Beziehung. Libertär betrachtete Freiheit ist nur noch individuelles Handlungsvermögen ohne Bedingungen – also eine Illusion.Dieses Ausblenden von Bedingungen stellen Nachtwey und Amlinger auch in der Wissenschaftskritik fest: In einer komplexen Welt kann auch der Libertäre nicht alles wissen, er ist fremdwissensabhängig und dadurch entsouveränisiert. Das ist eine problematische Kränkung, die für die Betroffenen umso ärgerlicher ist, als sie auf Wissensinstitutionen angewiesen sind, denen sich gleichzeitig misstrauen.
Eine dritte Entwicklung die die von Andreas Reckwitz entlehnte Diagnose der Affizierung: Alles wird emotional aufgeladen und mit persönlichen Beziehungen verbunden, das drängt Meinungen in der Vordergrung und priorisiert den Meinenden, der wesentlicher Bestandteil jeder Aussage und aller Feststellungen ist. Nachtwey und Amlinger deuten dieses Verhältnis denn auch als Aggressionsverhältnis: Jemand ist auf Eroberungsfeldzug.
Im Theorieteil treten noch Alexis de Toqueville auf (mehr Gleichheit schärft das Ungleichheitsbewusstsein), Emile Durkheim (Bedürfnisbefriedigung ist unmöglich, wenn man nicht etwas, sondern mehr will), oder Otto Kirchheimer (Parteien sind heute entideologisierte Allerweltsparteien, die Machterwerb und -versprechen anstelle weltanschaulicher Massenintegration gesetzt haben) und Luc Boltanski (Menschen leiden zunehmend an Enthüllungssucht, die jede Aussage von Institutionen unter Generalverdacht stellt).
Die aus den Interviews herauskristallisierten Typen von Autoritären ergeben gewissermaßen Verschwörungssinusmilieus; die am häufigsten betroffenen Typen finden sich – umgelegt auf die üblichen Sinusmilieus – in der Gegend der Performer, teilweise auch in Postmateriellen Gegenden, weniger allerdings mit möglicherweise vermuteten hedonistischen Eck (dort fehlt das Geld für die zeitintensive libertär-autoritäre Pose).
Der eher praktischen Teil zerfällt ein wenig in einzelne Interviewbruchstücke, als Beleg herangezogene Teilsätze und verstreute Detailanalysen. Der vermutlich hinter dem Text liegende Datenreichtum bleibt verborgen, man würde sich streckenweise ein wenig mehr quantitativen Zugang wünschen. Möglicherweise sind die Daten für eine nützliche quantitative Analyse zu breit gestreut – libertäre Autoritäre gibt es in allen Altersschichten, in eher gebildeten und besserverdienenden Milieus und gleich verteilt in allen Geschlechtern.
Die grundlegende gemeinsame Figur, die alles verbindet, ist die Überhöhung der eigenen Autonomie, die ihre eigene Gesellschaftsabhängigkeit leugnet. Das haben Putin- und Trump-Versteher, Enttäuschte, die ihr Heil in Tierschutz statt in Beziehungen zu Menschen suchen, Impfskeptiker, Verschwörungsfreunde und hölzern argumentierende Vertreter politischer liberaler oder konservativer Jugendorganisationen gemeinsam.