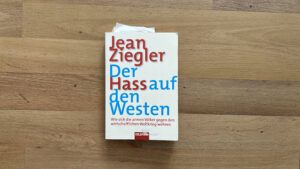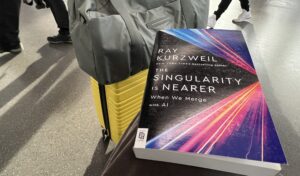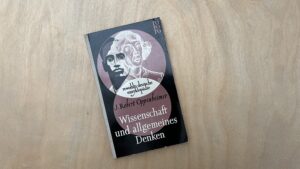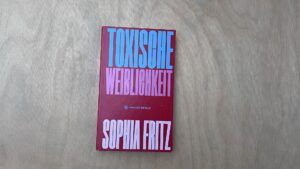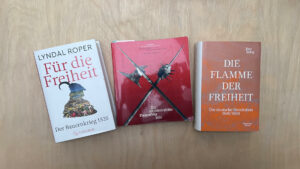Es ist erstaunlich, wie schnell manche Bücher altern, ohne deswegen zwingend an Gültigkeit zu verlieren. „Warum Nationen scheitern“ erschien im Original 2012, auf Deutsch 2013. Die Krim war noch nicht besetzt, die Ukraine war noch nicht überfallen, China und Indien boomten – das sind nur einige Aspekte, die sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert haben.
Acemoglu und Robinson entwickeln eine Theorie zur Entstehung von Wohlstand und Armut, die sich nicht an geographischen oder kulturellen Unterschieden oder an mentalitätspezifischen Vorurteilen orientiert. Einfach zusammengefasst: Institutionen, die Macht kontrollieren und beschränken, Beteiligung zulassen, Kontrolle ausüben und durchsetzen können, sind förderlich für die Entwicklung eines günstigen Gesellschafts- und WIrtschaftsumfelds. Sie bezeichnen das als inklusive Institutionen. Das Gegenstück sind extraktive Institutionen, die an Abschöpfung orientiert sind, sich der Kontrolle entziehen und so nur einer kleinen Schicht jener, die schon Macht haben, Macht und Wohlstand ermöglichen. Grundlage für inklusive Institutionen ist in der Regel ein zentralisiertes Staatswesen, das Regeln entwickeln und durchsetzen kann.
Verschiedene Faktoren begünstigen oder behindern diese Entwicklung. Systeme des Kolonialismus sind in alle Regel extraktiv und verstärken bereits vorhandene extraktive Institutionen – die Folgen sind korrupte Staatsgebilde, die vor allem bis in die 80er und 90er Jahre in Afrika und Lateinamerika besonders ausgeprägt waren.
Unterschiedliche Effekte hatte etwa die Pest des Spätmittelalters in Europa. Die enormen Todeszahlen und die dezimierte Bevölkerung sorgte in Westeuropa für Risse im rigiden Feudalsystem – es war nicht mehr selbstverständlich, dass überall Menschen verfügbar waren, die zur Arbeit gezwungen werden konnten und die keine Wahl hatten. Menschen hatten zumindest beschränkte Wahlmöglichkeiten. In Osteuropa schlug die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung aus. Die neuerdings knappe Ressource Mensch wurde strenger kontrolliert, Leibeigenschaft, vor allem in Polen wurde noch deutlich strenger.
Digitalwirtschaft und Digitalpolitik tragen heute auch, bemerken mehrere Autoren, Züge von Feudalherrschaft: Viele arbeiten ohne Entlohnung (indem sie Inhalte und Nutzungsdaten generieren), wenige kassieren. Die Nutzung ist rückläufig – wird auch hier in absehbarer Zeit die Entwicklung in die andere Richtung ausschlagen, sodass Plattformen sich wieder darum bemühen müssen, User zu bekommen? Was wird die Rolle der Pest übernehmen?
Andere Faktoren, die inklusive Institutionen ausbremsen, sind beispielsweise scheinbare Freiheiten. Acemoglu und Robinson führen die Robber Barons in den USA des 19. Jahrhunderts an – Vanderbilt, Morgan oder Rockefeller bauten schnell Monopole auf, die ihnen nützlich waren, der Entwicklung ihrer Branche aber nicht.
Auch das ist eine Entwicklung, die sich heute sehr deutlich am Beispiel des digitalen Kapitalismus nachvollziehen lässt. Die Dominanz von Plattformen steht in Wechselwirkung zu Alles-oder-nichts-Märkten, auf denen kein Platz für zweite oder dritte ist. Den Nachteil der so entstehenden Monopole für Innovation und Kunden haben beispielsweise Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge beschrieben.
Ein öfters missverstandener Aspekt in der Theorie von Acemoglu und Robinson ist das Verhältnis von inklusiven Institutionen und Freiheit. Freiheit per se spielt hier eine untergeordnete Rolle. Beteiligung ist relevanter – und die Möglichkeit, Grenzen zu bestimmen und durchzusetzen. Theoriefixierte Papier-Liberale übersehen das oft und gern und lesen die Theorie als eindimensionales Plädoyer für den Wegfall von Einschränkungen. Das ist ein Missverständnis.
Möglich ist, dass mit dem Wissen um dieses Missverständnis die Theorie von Acemoglu und Robinson auch als Inspiration zu Digitalgesetzgebung herangezogen werden kann. Digitalwirtschaft hat sich, zumindest im Umfeld der großen Plattformen, in den vergangenen Jahren zu einer extraktiven Institution entwickelt: Macht und Einkommen sind auf wenige verteilt, für Neue ist es schwer, Fuß zu fassen, das Wachtstums-Geschäftsmodell hat seinen Höhepunkt schon überschritten, problematische Auswirkungen werden sichtbar. Wie kommt man von hier wieder in ein inklusiveres Umfeld, so wie es die früheren Jahre des digitalen Kapitalismus versprochen haben?
Geht es nach Acemoglu und Robinson, dann braucht es dazu eine zentralisierte Macht, die Regeln gestalten und durchsetzen kann.
Die übliche Reaktion auf Ansätze zu solchen Überlegungen war, sie schnell vom Tisch zu wischen – das Netz ist global und es gibt nun mal keine globale Macht. Der erste Teil dieses Satzes stimmt allerdings nicht. Anu Bradford zeigt in „Digital Empires“ (mehr dazu in aller Kürze hier und bald ausführlicher auf diesem Kanal), dass es längst schon drei oder vier verschiedene Internetbereiche gibt. Das Netz in China hat wenig mit dem in den USA zu tun und auch in Europa entwickeln sich eigene Ausprägungen, in Russland ohnehin. Heute stehen einander mehrere konkurrierende Netzmodelle gegenüber. Politik hat die Möglichkeit, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass sich die eine oder andere Variante durchsetzt. Der Weg dorthin ist nicht vorgezeichnet und es ist auch überhaupt nicht klar, dass das funktionieren wird. Es ist nur absehbar, dass die aktuelle Entwicklung nur wenigen Menschen nützt. Ob das ein Problem ist oder vielleicht doch wünschenswert, das ist eine politische Entscheidung. Politik sollte allerdings die eigenen Grundlagen schaffen, um hier handlungsfähig zu bleiben.
Dazu gehören vor allem Kontrolle über die Infrastruktur als Mittel, Regeln auch durchsetzen zu können.
Alternativen zu den lähmenden Winner Takes it All-Modellen, die den Digitalmarkt aktuell plattgemacht haben, könnten neue inklusive Institutionen unserer Zeit sein.