Das Märchen, der ORF sei eben früher innovativer gewesen als andere Medien, ist schleicht ein falsches Märchen. Viele, die nicht dabei waren, erzählen die Gründungsgeschichte digtialer Medien in Österreich so, als sei orf.at das auf geniale Weise erste Onlinemedium mit einer Fülle von Inhalten, dessen Siegeszug in Reichweitenanalysennur eine logische Folge der visionären journalistischen Innovationskraft sei.
Das Problem: Der ORF war weder das erste noch das einzige Medium in Österreich, das früh digital experimentierte. Er war nur das einzige Medium, das sich nicht die kommerzielle Sinnfrage stellen musste. Auch die Frage der Kannibalisierung von Umsätzen oder anderen Reichweiten stellte sich nicht. Text-Informationen waren etwas gänzlich anderes als Fernsehen. Auch Bilder waren in den Frühzeiten des Internet noch ein gewichtigtes Ladeproblem.
Umfassende redaktionelle Information im Internet war für den ORF ein willkommener Werbekanal. Für private Medien war das von Anfang eine Gefahr. Schon früh stand die Frage im Raum: Wer soll das Heft kaufen, wenn wir schon alles ins Internet schreiben?

Gehen wir zurück in die späten Neunziger Jahre: News war damals als Wochenmagazin gefürchtet, verachtet und geliebt. Es gab häufig Donnerstage, an denen das Heft Gesprächsstoff lieferte – und es gab früh digitale Gehversuche. Ich erinnere mich, wie wir in der Redaktion diskutiert haben, ob Mailadressen der Redaktion öffentlich sein sollten. Das wirkte nach unliebsamer Nähe, als würde man Fremde zu sich nach Hause einladen. Digitalthemen waren in der Chronik-Redaktion angesiedelt, denn das Internet bestand aus Bombenbauanleitungen und Pornos (und ich als dienstjüngster Chronik-Redakteur bekam alle Digitalthemen umgehängt). Und es gab eine Webseite – mit Buttons, Frames und gifs.
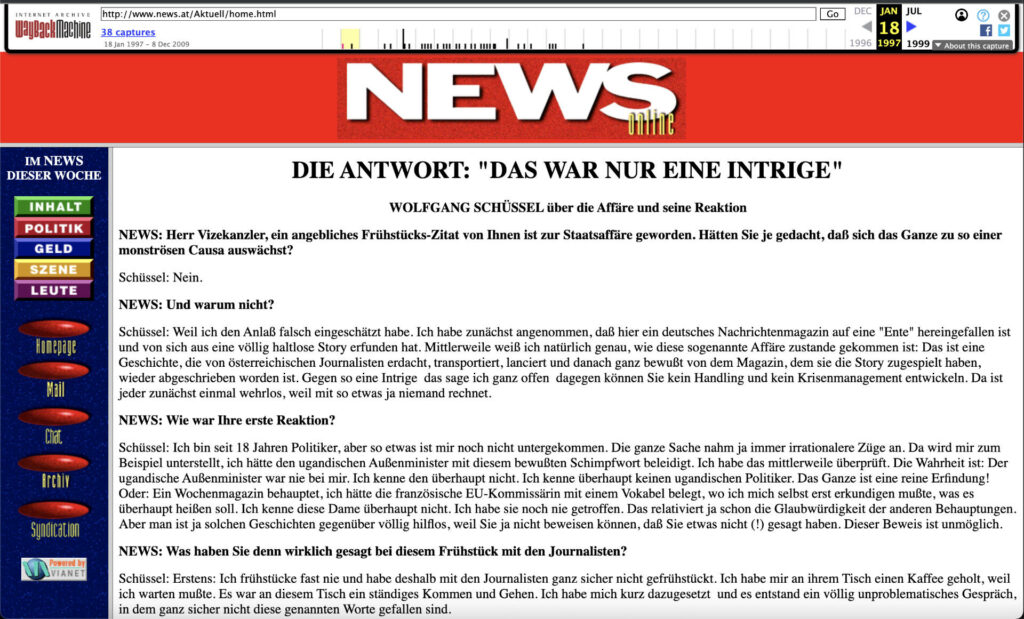
Eine Webseite, auf der auch schon früh die spannenden Geschichten zu lesen waren. „Lesen Sie diese Story in voller Länge und MAILEN Sie uns Ihre Meinung!“
Solange fast noch niemand im Internet war, war das egal. Aber kaum wurde die Webseite wahrgenommen, wurde das ein Problem.
Daraus entstanden viele interne Diskussionen. Und viele Zwischenphasen, in denen Onlinemedien Tummelplätze für Chat-Nerds, Singelbörsen-User und Moorhuhn-Spieler waren, und in denen das Internet die Müllhalde jener Beiträge war, die es nicht ins Heft geschafft hatten.
Umwege, die sich ein Öffentlich-Rechtlicher, der sich keine Gedanken über sein Geschäftsmodell zu machen brauchte, erspart hat.
Ein paar Jahre später, in den frühen 2000ern, war der ORF übrigens noch immer nicht die Nummer eins im Internet. Damals war aon.at (mit Ostbahnkurti-Werbung) das führende Onlinemedium Österreichs. Was für ein einzigartiger innovativer Zugang schaffte die Grundlage für diesen Erfolg? Die Seite aon.at war als Browserstartseite auf den CD Roms mit den Internet-Installationspaketen für alle Internet-Accesskunden Österreichs voreingestellt.
Als das Geheimnis um die Browsereinstellungen dann auch für breitere Bevölkerungsschichten keines mehr war (und nachdem die Bemühungen, aon.at als jet2web.net in ein „multimediales horizontales Destinationportal“ zu verwandeln, gescheitert waren), wurde der Platz an der Spitze für orf.at frei.
Auch bei diesen Entwicklungen steckten private Medien in der Zwickmühle. Während der Jahre rund um 2000, als Telekomunternehmen meinten, sie würden nun die besseren Medienhäuser, boten eben diese Telekomunternehmen schiere Unsummen für redaktionelle Inhalte. Und Zeitungen mussten sich der Frage stellen: Sollten sie sich dem Internet verweigern? Sollten sie ihre Inhalte verkaufen und damit die eigenen Konkurrenz füttern? Sollten sie auf diese Einnahmen verzichten und damit zwei Konkurrenten füttern, nämlich die Telekoms und die anderen Zeitungen, bei denen diese dann einkaufen würden? Oder sollten sie darum kämpfen, die in uninteressante Ablagen verwandelten eigenen Onlineauftritte ernst zu nehmen und Geschäftsmodelle dafür zu entwickeln?
Auch das ist nämlich eine Phase, die dem ORF bis heute erspart blieb: Im eigenen Unternehmen dafür kämpfen zu müssen, dass das mit dem Internet auch mal kommerziell (und nicht nur im Verdrängungswettbewerb um kaum monetarisierbare Reichweite) etwas werden sollte – zu einer Zeit, als Elektronik-Ketten in Österreich online den Umsatz einer halben kleinen Filiale erwirtschafteten, oder als Controller in der Telekom uns Onliner mit großen Augen fassungslos ansahen, wenn wir unsere Umsätze präsentierten: Nein, wir rechneten nicht in Tausendern, wie rechneten in einzeln Euros. Es waren keine 10 Millionen Umsatz im Quartal, es waren zehntausend Euro. Einzelne Euro.
Reichweite zu erzielen ist weniger das Problem, auch heute noch nicht. Die Hürde zur Bezahlung aber ist nach wie vor sehr hoch. Viele schwadronieren heute gönnerhaft zu ORF Gebühren und Haushaltsabgaben: „Niemand hat die anderen Medien davon abgehalten, slebst tolle Onlineversionen zu entwickeln“. Oder: „Nicht einmal ein Euro im Monat – das muss einem doch allein beste Radiosender der Welt einfach wert sein.“
Ich möchte all diese Überzeugten gern einladen, sich dem Realitätsscheck zu stellen. Nicht über Umfragen, nicht über Berechnungen, sondern über Geld. Und nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum – Abonnenten zu gewinnen ist um einiges leichter, als sie zu behalten.
Dann hätten wir wirklich angemessene Vergleichswerte, um Zugkraft, Innovation und Nutzen von Medienmarken gegenüberzustellen.
Die Geschichte von vor 25 Jahren spielt heute nicht mehr wirklich eine Rolle im Zustand der Medienlandschaft. Sie sollte allerdings, wenn sie schon erzählt wird, richtig erzählt werden. Und Reichweiten sind ein Maßstab aus dieser längst vergangenen Zeit, der heute weniger und weniger eine Rolle spielt.
Was sind schon eine Million Gelegenheitsuser gegen hundert aus eigenem Antrieb zahlende Kunden? Die Antwort auf diese Frage wird gerade konkreter.






