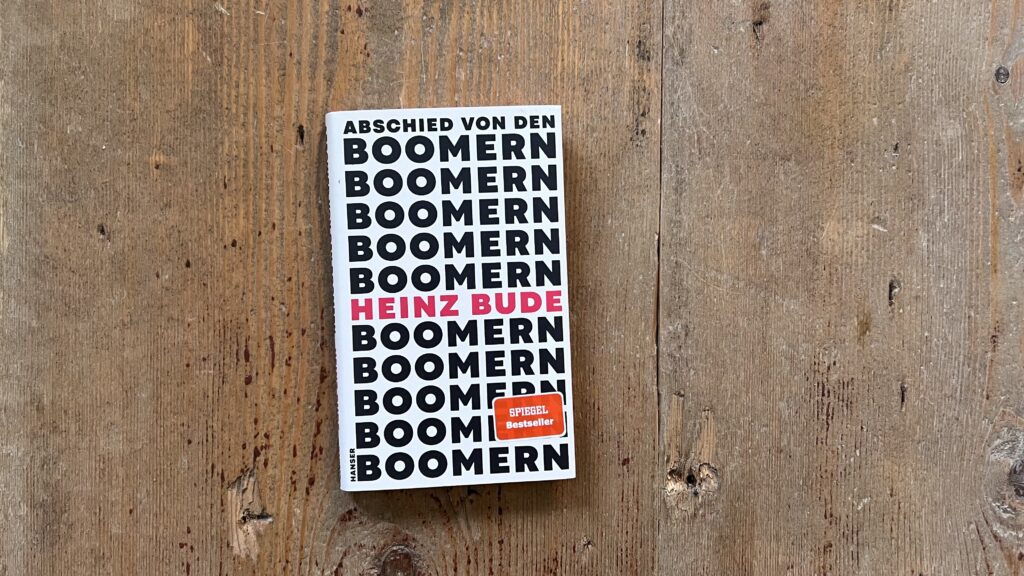Die Generation X kommt einmal mehr unter die Räder. Heinz Bude verabschiedet sich von den Boomern und begrüßt Millenials und Gen Z. Von X keine Rede. In den 90ern (als es noch fast keine Boomer gab), war ich als Anfang der 70er Jahre Geborener fast noch zu jungü für Generation X, heute schlägt Bude die Google-Gründer Page und Brin (beide mein Jahrgang) ungeniert den Boomern zu.
Eigentlich lese ich keine Generationen-Literatur der Austauschbarkeit halber. Jede Generation, wenn sie denn eine ist, sagt seit mindestens 40 Jahren: „Wir sind die ersten, die …“ Und sie sagen das zum gleichen Thema.
Bude beleuchtet etwa Krisenerfahrungen – etwas, das die coronageplagte Gen Z für sich beansprucht. Boomer haben die Kriegstraumen ihrer Eltern aufgesaugt, Umweltprobleme für sich entdeckt und Tschernobyl und Aids als Veränderungen erlebt. Vielen von ihnen wurde die Zwischenkriegszeit als die beste Zeit vermittelt, auch die Erzählungen meiner Großeltern haben, im Verbund mit Erich Kästner-Romanen, ein sehr friedliches Bild weniger Jahre um 1930 vermittelt. Der Krieg lag als schlimmste Zeit in der Vergangenheit, es gab Grund zu der Annahme, dass Zustände nur besser werden könnten.
In der Wahrnehmung der Gen Z, meint Bude, kommt das Schlimmste erst noch.
Die Generation X, die bei Bude ganz konsequent kein Thema ist, hat die Zeit vor Aids weitgehend verpasst, durfte wegen Tschernobyl ein oder zwei Tage nicht in die Sandkiste und musste sich nach 1989 mit der Idee anfreunden, dass es jetzt zwar keinen Ostblock mehr gab, damit aber eigentlich auch nichts gewonnen war.
Ein in Generationenthemen neuer, wenn auch nicht überraschender Punkt bei Bude: Boomer wurden weder alt noch altmodisch geboren. RAF und Deutscher Herbst waren ebenso Boomer-Erfindungen wie Anti-Atomkraft-Proteste.
Daraus kristallisiert sich letztlich eine möglichwerweise doch auf den Punkt gebrachte Esssenz in Budes etwas dahinschweifendem Essay: Boomer sind die, die immer zu viele waren. Für Boomer war trotz guter Wirtschaftsdaten Arbeitslosigkeit oder unternehmerische Erfolglosigkeit immer eine reale Option. Künstlerisches und Revolutionäres gab es an allen Ecken, es reichte nicht zum Distinktionsmerkmal. Leistungswille und Leistung, schreibt Bude, reichten einfach nicht aus, um aufzufallen oder etwas zu erreichen. Es gab einfach zu viele, die ähnliches machten, egal, was man machte. Weshalb Auffallen und andere außenorientierte Erfolgskriterien für Budes Boomer-Diagnose weniger relevant sind als „Wirkungswille ohne Letztbegründung“. Darin sieht Bude das zentrale Boomer-Paradigma, das sich auf Hausbesetzungen, Stricken und pflichtbewusste Erwerbsarbeit gleichermaßen anwenden lässt.
Die Abgrenzung zu Millenials lässt Bude bewusst offen – oder der Erfahrung der Lesenden überlassen.