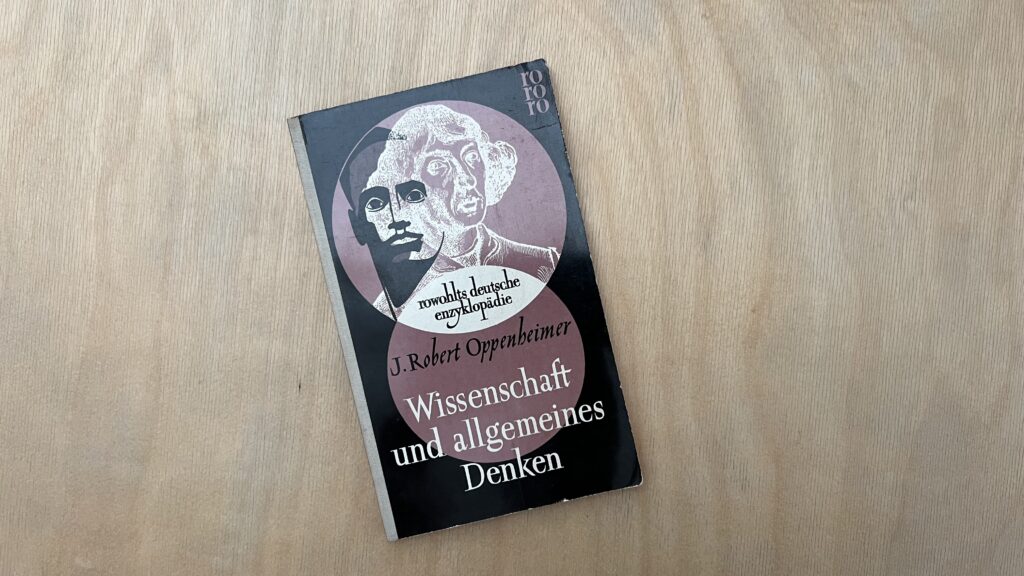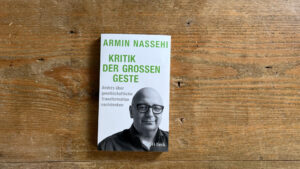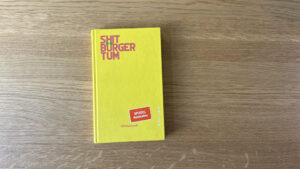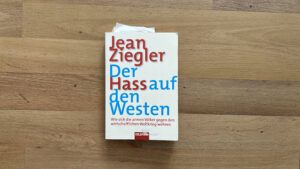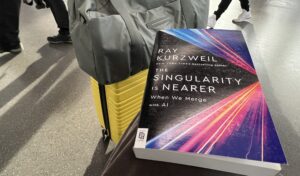Wie erlangt Wissenschaft Bedeutung im Alltagsleben? Können wissenschaftliche Ergebnisse alltägliche Anschauungen beeinflussen? Wie verhält sich Wissenschaft zu der Frage, wie Menschen Prioritäten setzen? Robert Oppenheimers Vorlesungsreihe aus den frühen 50er Jahren berührt eine Vielzahl heute noch brisanterer Fragen. Wo heute Verschwörungstheorien und Überschätzung der Wissenschaft ebendiese von zwei Seiten unter Druck setzen, waren es zur Zeit Oppenheimers Erkenntnisse aus Atomphysik und Quantentheorie, die Zweifel am Zusammenspiel von Forschung und Alltag säten. Diese Erkenntnisse sind bis heute nicht verdaut.
In der großen Welt, wir Oppenheiner es nennt, haben wir klar umrissene Objekte und können Vermutungen über Kausalitäten anstellen, die sich recht verlässlich argumentieren lassen und zu reproduzierbaren Ergebnissen führen. In der Welt der Atome wird die Beobachtung zunehmend schwieriger; Forscher müssen sich überdies mit ganz anderen Arten von Fragen beschäftigen. In der flüchtigen Teilchenwelt ist beispielsweise nicht ganz klar, wie lang etwas existieren muss, um als existent zu gelten. Kausalitöen lassen sich ebenfalls kaum begründen – welche Auswirkungen kann es auf die in der großen Welt vermeintlich beobachteten Kausalitäten haben, wenn ihre vermeintlichen Bauteile diesem Gedanken von Kausalität so gar nicht folgen? Und was sagt es über den Zusammenbau der großen Welt, wenn das Chaos in der Atomwelt die beobachtbaren und reproduzierbaren Abläufe gar nicht stört?
Oppenheimer sah darin einen Teil der Begründung dafür, dass Wissenschaft nicht darüber entscheidet, was Menschen wichtig ist und dass Wissenschaft Wege finden muss, sich mit Menschen in Verbindung zu setzen.
Die frühen 50er Jahre liegen etwa 30 Jahre vor dem Aufkommen der ersten Ansätze von Wissenschaftskommunikation. Thatchers Budgetkürzungen im England der 80er Jahre veranlassten Forschungsinstitutionen dazu, tatsächlich nähere Beziehungen zu Menschen zu suchen und den Nutzen von Wissenschaft zu begründen – um die Öffentlichkeit Wissenschaftsbudgets gegenüber positiver zu stimmen.
Aus heutiger Sicht stellt die Erkenntnis einen Knacks im Selbstverständnis von Wissenschaft als primärem Zugang der Welterfassung dar. Physiker von Bohr über Heisenberg bis Schrödinger haben ähnliche Grundsätze wie Oppenheimer formuliert, das verfälschte Ideal eine neutralen, rein an Fakten orientierten und von Wissenschaftlern und deren Werten und Lebenswelten unabhängigen Wissenschaft hält sich nach wie vor hartnäckig.
Oppenheimer kritisiert die Vorstellung der Welt als einer unveränderbaren Maschine, die vom Wissenschaftler nur beobachtet wird. Seine wesentlichen Einwände:
Wissenschaft ist kumulativ. Erkenntnisse bauen auf einander auf, Wissenschaft ist oft nur mit ausreichendem Vorwissen verständlich. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind daher auch immer von vorangegangenen Erkenntnissen abhängig; Wissenschaftsgeschichte beeinflusst die Zukunft der Wissenschaft und das wissenschaftliche Weltbild. Gibt es – im wissenschaftlichen Weltbild – einen Unterschied zwischen wissenschaftlichem Weltbild und der Welt „da draußen“?
Jede Messung, jede Beobachtung ist ein Eingriff und schafft eine „neue einmalige, nicht völlig voraussehbare Lage“. Denn die Art der Beobachtung legt fest, welche Eigenschaft der Situation genau bestimmt sein wird und welche weniger genau. Das ist eine nüchterne Beobachtung des Physikers, die heute häufig als esoterischer Wissenschaftszweifel kritisiert wird.
In der wissenschaftlichen Methode verwachsen Methode und Objekt mit zunehmender Spezialisierung miteinander. Methoden schaffen neue Objekte, Objekte, Erkenntnisse und Theorien erfordern Methoden – Wissenschaft ist nehr Gestaltung als Beobachtung.
Andere Wissenschaftstheorien kennen diese Überlegungen als Theoriebeladenheit von Beobachtung (Quine), Experimenters‘ Regress (Collins) oder induktives Risiko (Hempel).
Eine andere Feststellung von Oppenheimer kann als Variation zu Claude Shannons Informationstheorie gelesen werden: Wissen baut auf vorhergehendem Wissen auf und muss zu diesem in Beziehung gesetzt werden können. Es gewinnt aber vor allem dadurch an Bedeutung, dass es sich von vorhandenem Wissen unterscheidet. Alles andere bekommt keine Aufmerksamkeit, keine Relevanz – und ist letztlich möglicherweise auch kein Wissen. Bei Claude Shannon entsteht Information durch Vielfalt: Am informativsten ist die Zeichenkette, die die meisten verschiedenen Zeichen enthält. Rudolf Carnap und Yehoshua Bar Hillel haben die Überlegung als Bar Hillel-Carnap-Paradoxon auf die Spitze getrieben: Den größten Informationsgehalt enthält demnach die Information, die sich am deutlichsten von vorhandener Information unterscheidet. Das wäre der Widerspruch zu bekanntem Wissen. Solche Informationen senden sicher starke Signale und ziehen Aufmerksamkeit auf sich, letztlich bedeuten sie aber nichts, denn sie können nicht in Beziehung gesetzt werden, weder zur Ausgangsinformation, die sie verneinen, noch zu einer Beobachtung, denn sie entstehen nur aus der Verneinung. Insofern wäre die Leere am informativsten. Luciano Floridi als Interpret des Paradoxons versucht, diesen Widerspruch durch einen geschärften Informationsbegriff aufzulösen, der solcherart falsche Information (die sich auf Nichtexistierendes bezieht) nicht als Information gelten lässt.
Oppenheimer hätte vermutlich beides gefallen, sowohl das Paradoxon als auch der veränderte Informationsbegriff, denn Wissenschaft zeichnet sich für Oppenheimer dadurch aus, mit Antinomien, Unerwartetem und in der Alltagserfahrung scheinbar Umöglichem arbeiten zu können.
Wissenschaft klärt offene Fragen und löst Probleme – das ist auch hier Problem. Wissenschaft wird oft überschätzt und überfordert. Für Oppenheimer äußert sich das in der Überschätzung des beim einzelnen vorhandenen Wissens und in der Überschätzung der Einheitlichkeit in der Gemeinschaft. Einzelne verfügen, auch wenn sie sehr viel wissen, immer nur über punktuelles Wissen. Das kann ihnen zu sehr guter Orientierung in der Welt verhelfen und sehr nützlich sein, aber es ist trotzdem nur ein kleiner Auszug und aufgrund der kumulativen Eigenschaften von Wissen von anderen und anderem Wissen abhängig. Das Problem der überschätzten Einheitlichkeit äußert sich in der Annahme, Wissen wäre verbreitet und akzeptiert. Innerhalb der Wissenschaft kann es verschiedene Ansichten geben, wissenschaftlicher Konsens ist ein starkes Signal aber keine normative Verpflichtung, und Wissenschaft allein stellt keine politischen oder sozialen Regeln auf. Aus der Tatsache (oder der Vermutung), dass etwas wahr ist, geht keine Verpflichtung hervor, das kann nur innerhalb eines begleitenden Regelwerks oder im Rahmen anzuwendender Werte geschehen. Wissenschaft sollte sich allerdings den Fragen stellen, welche Entscheidungen vor welchem Hintergrund mit welchen neutral gemeinten wissenschaftlichen Ergebnissen argumentiert werden können. Das ändert nichts an der wissenschaftlichen Methode und ihren Ergebnissen. Aber es stärkt die Position von Forschenden, die ihre Ergebnisse verteidigen möchten.
Das Mißverhältnis zwischen Sein und Sollen, Wissenschaft und Politik, Diagnose und Handlung zeigt sich immer wieder im Verschwörungsumfeld, insbesondere im Corona-Zusammenhang. „Hört auf die Wissenschaft“ war die eine Extremposition – in der aber offen blieb, was „die Wissenschaft“ denn sagte. Virologen konnten Daten über die Verbreitung von Viren sammeln und auswerten, Bildungsforscher konnten sich mit der Auswirkung von Lockdowns auf Lernfortschritte beschäftigen, Ökonomen konnten diverse wirtschaftliche Szenarien berechnen. Alle Disziplinen konnten Empfehlungen zur Maximierung einzelner Ziele aus ihrer Disziplin berechnen. Die Abwägung zwischen Ansteckungs- und Krankheitsrisiken und wirtschaftlichen Verlustrisiken aber blieb der Politik überlassen. Die Priorisierung der einzelnen Ziele und Risiken ist keine wissenschaftliche Entscheidung, das ist eine Frage von Werten die politisch verhandelt werden.
Der Verhandlungsspielraum dabei ist gewachsen – und das ist nicht nur positiv. Überkommene Autoritäten mussten Platz machen und sich Argumenten stellen. Das sind Folgen von Aufklärung und Demokratisierung. Die Ausläufer heute sind spitze Einzelmeinungen, die in Talkshows als relevante Einwände gegen wissenschaftlichen Konsens dargestellt werden. Ähnliches kann Oppenheimer im Sinn gehabt haben, wenn er mahnend feststellt, dass sich die Einheit von Wissenschaft auf Gemeinschaft gründet. Wenn wir jeden Konsens jederzeit infrage stellen, Einzelmeinungen gleichberechtigt neben weitverbreitete und langerprobte Lehren stellen wollen, dokumentierte Ergebnisse durch Meinungen ersetzen oder aus einzelnen unter abgegrenzten Rahmenbedingungen durchgeführten Untersuchungen universelle Gesetzmäßigkeiten ableiten wollen, dann ist das eine Überstrapazierung wissenschaftlicher Methoden. Desinformation und Ignoranz tragen dazu ebenso bei wie die Überschätzung von Fakten und Evidenz. Information allein schafft noch keine Motivation, in einem bestimmten Sinn zu handeln.
Neben unterschiedlichen Zielen, Wertvorstellungen oder politischen Haltungen untergraben noch andere Entwicklungen Grundlagen gemeinsamen Wissens: Künstliche Intelligenz verkürzt für viele Menschen Denkwege und empfiehlt Ergebnisse, deren Grundlagen die Empfehlungsempfänger nicht kennen müssen. Wenn Menschen danach handeln, handeln sie nicht nach Grundlagen, die ihnen und ihren Mitmenschen gemein sind, sie handeln nach Grundlagen, die anderswo in Algorithmen verpackt wurden, die sich möglicherweise auch noch verändern. KI schwächt damit die Rolle offen gemeinsam ausdiskutierter Grundlagen und das common good, das im realen Leben eine relevante Rolle in menschlichen Entscheidungen spielte. Dieser letzte Gedanke stammt von Mark Coeckelbergh und beschreibt ein relevanteres und realeres Krisenszenario rund um KI als alle Dampfmaschinen-, Buchdruck- und Jobkiller-Metaphern zusammen.