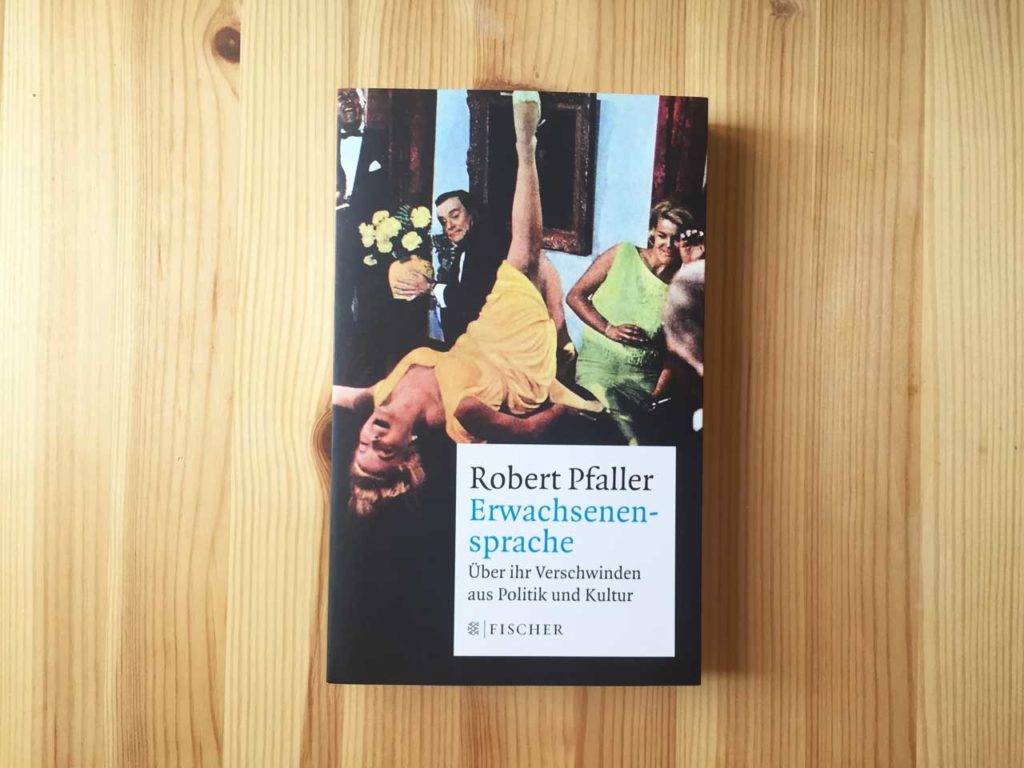Es ist schwer, in den Nebeln von Neoliberalismus und Postmoderne bei Laune zu bleiben. Wo diese Begriffe als Kampfbegriffe eingesetzt werden, um eine gefällige Abwehrhaltung als Vorbedingung zu suggerieren, fällt es mir schon sehr schwer, weitere Argumente noch ernstzunehmen. Robert Pfaller mischt in „Erwachsenensprache“ gekonnt einen dampfenden Giftcocktail, den er dann mit den dümmsten Klischees der von ihm kritisierten Sachverhalte garniert und genüsslich fragend, ob man das wirklich trinken wolle, serviert.
Es ist ein bisschen langweilig, Sachverhalte zu kritisieren, indem man die schlechtesten Argumente für sie hernimmt, auseinandernimmt und die Sache dann anhand der Kritik an den schlechten Argumenten durch den Kakao zieht.
Es ist ebenso wenig spannend, allgemein gehaltene Tiraden ohne konkrete Akteure zu lesen. Wenn Pfaller über political correctness schreibt, ist der Weg zur Verschwörungstheorie nicht weit: Nie wird klar, wer was gemacht haben soll, wo Ursachen oder Gründe zu sehen sind, oder gar, was eine angemessene Reaktion wäre; es bleibt stets beim nebulösen „die“, manchmal auch „wir“. Eines meiner K.O.-Kriterien bei Texten über political correctness ist der Verweis auf nicht näher genannte „amerikanische Universitäten“ und nicht näher beschriebene Auswüchse, die sich an diesen abspielen sollen. Pfaller braucht nur wenige Seiten, um darauf zu sprechen zu kommen.
Was möchte er eigentlich darstellen?
Neoliberale Identitätspolitik, die in Verbindung mit political correctness individuelle Schwächen und Vorlieben in den Vordergrund stellt, ist eine Verschleierungstaktik, die davon ablenken soll, dass die Verhältnisse rauer und das gesellschaftliche Klima unsozialer wird. – Das ist eine These, die man aus dem Buch herausdestillieren könne. Das könnte jetzt eine gesteuerte Aktion irgendwelcher Eliten sein. Es könnte aber auch eine Reaktion zur Selbsttröstung der zu kurz gekommenen sein – schließlich argumentiert Pfaller sehr gerne in der psychoanalytisch dominierten Nietzsche-Lacan-Žižek-Schiene.
Die psychoanalytische Version wäre mir da immer noch lieber als die verschwörungstheoretische; beide sind auch durchaus amüsant zu lesen. Abstrus wird es allerdings anhand der Beispiele, Zitate und Anspielungen, mit denen Pfaller seine Überlegungen illustriert.
So führt er etwa Ali G, die Kunstfigur des Comedians Sacha Baron Cohen, als Paradebeispiel für den Postmodernen Nichtskönner an, der auch für das Nichtskönnen Respekt einfordert. Ali G sagt jetzt zwar tatsächlich oft „Respect!“ – allerdings in den seltensten Fällen als Forderung für sich selbst, sondern als Äußerung des Erstaunens, der Bewunderung oder der Ratlosigkeit gegenüber anderen.
Auch für Mansplaining hat Pfaller eine eigene Theorie: Der Erklärreflex älterer Männer (die nicht immer biologisch alt sein müssen), sei Teil eines Spiels, einer Inszenierung von gepflegter amüsanter Konversation, in dem die Frau, der erklärt wird, die Kontrolle behalte – ähnlich wie der dominierte Part in SM-Beziehungen. Das ist sicher in gewisser Weise so – nur ist eben nicht das ganze Leben eine Cocktailparty, auf der man belanglose amüsante Konversation sucht. Manchmal müssen Entscheidungen getroffen, Budgets verplant oder Jobs vergeben werden. Schrecklich banale Dinge, aber leider oft wichtiger.
Keinen großen Bezug zur alltäglichen Praxis beweist Pfaller auch, wenn er sich über die Hochkonjunktur des Begriffs „Teamfähigkeit“ mokiert. Ich habe einige banal-wirtschaftliche Vorstellungsgespräche hinter mir, sowohl als Bewerber als auch als Vergebender, und noch nie, niemals ist dabei eine ähnliche Frage gefallen wie: „Und sind Sie auch teamfähig?“ Natürlich überschwemmt dieses Wort Stellenanzeigen, natürlich wissen alle, dass dieses Wort nichts bedeutet und natürlich steckt hier der unbezwingbare Widerspruch drin, dass das Teammitglied hervorragende Einzelleistungen bringen soll, um dann, wenn die nicht mehr gebraucht werden, widerspruchslos zurückzustecken – aber das ist Politik. Politik, die jedem, der mal gearbeitet hat, klar ist – kein geheimer Code, der die Unterdrückung der Massen im Mittelmaß befeuert. „Teams“ wie sie die Kooperationsforscher in der Verhaltensökonomie untersuchen, gibt es im übrigen abseits der klassischen Fließbandarbeit kaum.
Pfallers Überlegungen führen den Leser oder die Leserin immer wieder an den Punkt, an dem man unweigerlich schmerzlich-peinlich berührt denkt: „Ohje, was für ein Unsinn!“. Es ist ein Gefühl wie der grundsätzlich nette Wirtshausabend, an dem die grundsätzlich nette Bekanntschaft dann doch etwas zu weit ausholt, dahinschwadroniert und sich in Sackgassen redet, aus denen nur ein Weg mit sehr viel Selbstkritik und überraschenden Wendungen hinausführt.
Das bietet das Buch allerdings nicht.
Das ist schade, umso mehr wenn man der Diagnose der Überempfindlichkeit, der Konzentration auf Nebenschauplätze und des Verlusts von kulturellem Repertoire zustimmen würde. Das Problem ist aber, dass Pfaller kulturelle mit politischen und psychoanalytischen Schauplätzen mischt und daraus Argumente strickt, die eher Vorwürfe als Erklärungen sind.
Auch die Überlegung, dass Menschen möglicherweise vielmehr Haustiere als selbständige, selbstbestimmte, wilde und gefährliche Menschenraubtiere sind, ist eine nette Allegorie, die aber auch nur dann erhellend, anregend oder aufrüttelnd ist, wenn man innerhalb der engen Grenzen bleibt, innerhalb derer solche Altherrenwitze eben funktionieren. Es gibt schließlich auch andere Haustiere als Hamster. Ein ordentlicher Problemhund wäre da wohl schon viel eher nach Pfallers Geschmack – wild, gefährlich, ein unberechenbarer Troublemaker. Tragischerweise ziehen gerade solche Problemhunde noch viel mehr fürsorgliche Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen auf sich, wie Pfaller sie beklagt. Die Bilder hinken aber an allen Enden.
Schade, wie gesagt. Das Buch bleibt merkwürdig zusammenhanglos, eine mittelmäßig zusammengeschusterte Polemik, deren Prämissen bereits großteils so unglücklich argumentiert sind, dass man den Folgerungen kaum Beachtung schenken mag. Das ist die Krankheit der meisten Bücher rund um die Empfindlichkeit der Gegenwart.