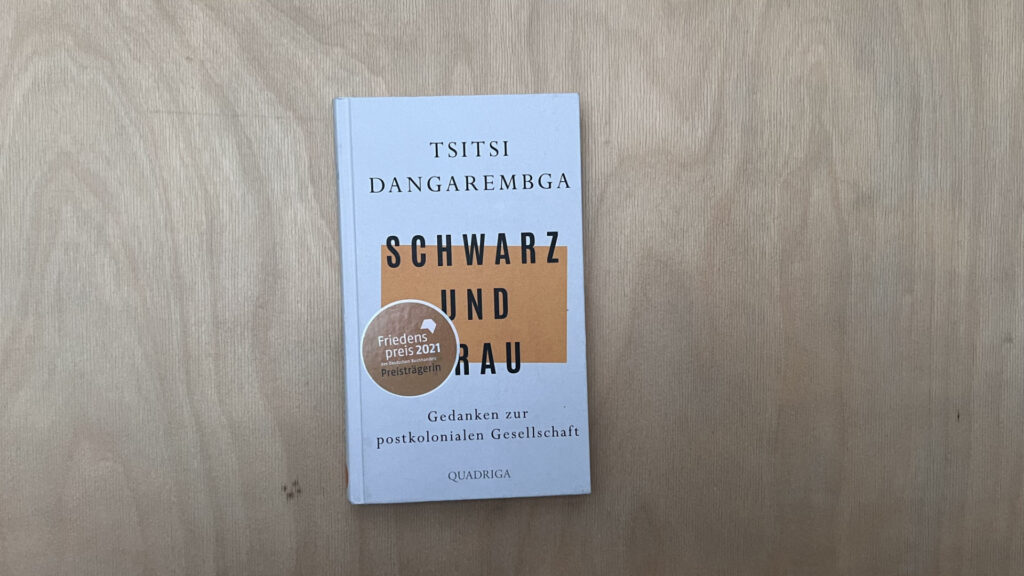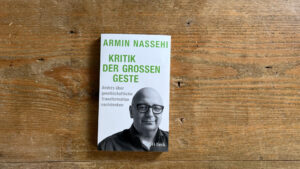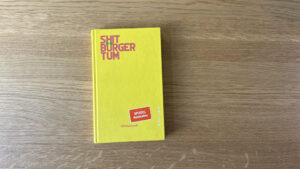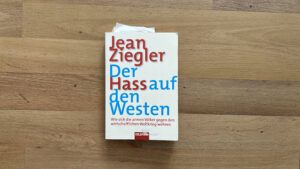Es gibt Bücher, die kann man als alter weißer Mann tatsächlich nur zur Kenntnis nehmen. In “Schwarz und Frau” beschreibt Dangaremba Hindernisse und Hürden auf ihrem Weg als schwarze Frau vom Pflegekind zur prominenten Autorin. Prägend sind Erfahrungen als Pflegekind in einer weißen christlichen Familie in Simbabwe. Simbabwe hat als ehemaliges Rhodesien eines der ausbeuterischsten Kolonial-Terrorregime hinter sich. Dangaremba wurde von ihren Eltern, die Ausbildungen in England absolvierten, in Pflege gegeben. Unkonventionelle Erzählstile und Dramaturgien entsprachen nicht dem Curriculum der Creative Writing-Klassen im College.
Unbestritten: Europäische Aufklärung ist voll von Rassismus, absurden Gender-Theorien und imperialistischen Ansprüchen. Weiße Europäer haben in den vergangenen 500 Jahren vielen Menschen im Süden und anderen neuen Welten das Leben zur Hölle gemacht.
Es ist aber doch etwas zu kurz gegriffen, die Geschichte von Ausbeutung und Imperialismus erst mit dem Römischen Imperium beginnen zu lassen und sie damit auf Europa einzugrenzen. China? Osmanen? Dangaremba selbst erzählt anekdotisch, dass römische Imperialisten in ihrem Imperiumsdünkel die eben unterworfenen Briten als wilde rückständige Untermenschen beschrieben. Konnte der Brite, Inbegriff des weißen Herrenmenschen der afrikanischen Kolonialzeit, Opfer von Rassismus und Imperialismus sein?
Einige Thesen taugen, wie öfters im identitätspolitischen Umfeld, einigermaßen als Diagnose, aber wenig als Handlungsempfehlung. Progressiver Separationismus, Standpunkttheorie und ähnliche Positionen helfen vielleicht bei der Problemfeststellung, aber nicht bei dessen Behebung.
Manchmal drängt sich auch die Frage auf, ob die Diagnose treffend ist – oder wie weit die Verknüpfung eines allgemeinen „Unbehagen in der Kultur“ (das auch ein anderer alter Mann beschrieben hat) mit spitzen Perspektiven zu mehr als persönlicher Erkenntnis führt. Den Wert dieser Erkenntnis zu beurteilen möchte ich mir nicht anmaßen.