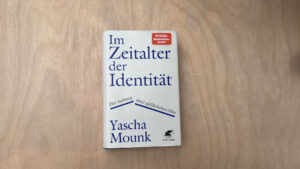Ein Sendbote aus der Zukunft, ein Wink (oder Anklopfen) Gottes, eine glückliche Fügung für die Natur – dem Corona-Virus hat man schon viel in die Schuhe geschoben. Dramatische Maßnahmen, drastische Einschnitte, Unsicherheit – das verlockt offenbar viele zu reflexartige großen Worten. Manche ergehen sich eben in Visionen einer Post-Krisen-Ära, andere beschränken sich darauf, dass alles anders wird (und sie die ersten sein werden, die es uns erklären – sobald es ihnen eingefallen ist), und wieder andere greifen eben nur zur großen Geste. Zur großen Geste griffen vor allem auch Regierungsmitglieder, als sie verkündeten, die Wirtschaft lahmzulegen und gleichzeitig zu retten: “Koste es, was es wolle.“ Da steckten gleich mehrere Versionen von Größe drin: Die Krise war groß, denn sie erforderte solche Maßnahmen. Die Maßnahmen waren groß. Und auch jene, die diese Maßnahmen verkündeten, waren groß.
Das ist knapp zwei Monate her. In der Zwischenzeit hat man gesehen, dass tatsächlich vieles auf dem Spiel steht. Schließungen, Sperren und Veranstaltungsverbote haben weite Kreise gezogen. Das hat Abhängigkeiten sichtbar gemacht, die vielen vielleicht nicht offensichtlich waren. An großen Industriemessen hängen nicht nur die Salesabteilungen der Industrieunternehmen, sondern auch Messebauer oder Tischler, die Messestände herstellen, Werbeagenturen, die Verkaufsfolder gestalten, Filmproduktionen, die Produktvideos erstellen. An Festivals und Konzerten hängen nicht nur Veranstalter und Bands, sondern auch Labels, Promoter und geplante Kampagnen, an denen hängen wiederum Medien, für die entfallene Veranstaltungen entfallende Inserate bedeuten. Klingt alles logisch und nicht weiter erwähnenswert.
Zufälle kann man nur schwer wiederholen
Aber die Hilfsmaßnahmen zur Rettung der Wirtschaft, ihre Lücken und das laufende Nachbessern haben durchaus auch offenbart, dass unsere scheinbar durchorganisierte und durchgestaltete Gesellschaft vielleicht doch eher nur zufällig funktioniert. Man kann sie, so wie die Wirtschaft, leicht sperren, abdrehen, herunterfahren. Aber es ist sehr schwer, sie wieder zu öffnen, ihr auf die Sprünge zu helfen.
Am deutlichsten zeigt sich das im Umgang mit den Kleinen: Kleinunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen kamen zuerst in den Hilfsprogrammen, die auf Kurzarbeit und Kredite setzten, nicht vor. Dann wurden sie in einem eigenen Härtefallfonds berücksichtigt, der betroffenen ein wenig Taschengeld zusichert. Dann wurde heftige Kritik laut, weil auch Kleinunternehmen genau so wie große laufende Kosten decken müssen und daher nicht nur ihre Gewinne, sondern auch ihre Umsätze brauchen. Schadenersatz für verlorene Gewinne hilft vielleicht beim Überleben der UnternehmerInnen, die Unternehmen selbst können aber nur mit zumindest teilweisem Schadenersatz für verlorene Umsätze überleben. Dann wurde mit dem Hilfsfonds nachgebessert, der auch für Kleine Zuschüsse zu Fixkosten bieten soll – diese werden aber mit Zahlungen aus dem Härtefallfonds gegengerechnet. Unter dem Strich bleibt also nichts. Ein-Personen-UnternehmerInnen konnten sich entscheiden, ob sie von den Hilft-Almosen ihre Betriebskosten zahlen – oder doch lieber was zum Essen kaufen. – Und dann wurde auch das noch mal über den Haufen geworfen und anders entschieden.
„Immer weiter“ ist auch eine Seitwärtsbewegung
Man kann das laufend notwendige Nachbessern als Zeichen der Realitätsferne der handelnden Personen sehen. Man kann es aber auch als ein besonders deutliches Beispiel dafür nehmen, wie wenig Politik eigentlich tun kann, wenn sie im positiven Sinn konkret werden soll, wenn sie etwas anderes tun soll, als entweder zu verbieten oder grobe Rahmenbedingungen zu schaffen.
Vieles funktioniert, weil es sich entwickeln konnte und so zu guten Lösungen geführt hat, die man am Reißbrett oder von der Kommandobrücke aus nicht hätte entwickeln können.
Das kann ein gutes Zeichen sein – aus dem Chaos entsteht etwas Funktionierendes, wenn man die Menschen nur machen lässt. Oder es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass das, was wir für verlässliche Entwicklungen halten, für eine laufende Erfolgsgeschichte, vielleicht nur auf dünnem Eis gebaut ist.
Ausnahmeszenario Stabilität
Die Corona-Krise hat jetzt mal etwas spektakulärer an Gewohntem gerüttelt. Die Crashs nach der Finanzkrise waren dagegen vergleichsweise klein. Jetzt sind alle in irgendeiner Form betroffen. Trotzdem tun die einen so, als ob man alles mit nur ausreichender Anstrengung wieder in den gewohnten Gang bringen könnte. Andere tun so, als sei jetzt endlich ein großer Einschnitt da, der uns zum Umdenken zwinge.
Die Perspektive, die mir fehlt, ist die, dass wir uns eigentlich seit längerem eher seitwärts als vorwärts bewegen. Wir waren es immer gewohnt, vor allem Europa als Erfolgsgeschichte zu betrachten: Menschenrechte, Freiheit, Wohlstand, Wirtschaftswachstum – das war die erklärte Richtung und das Vorbild für andere. Die Tatsachen, auf denen das Bild gründet, gehören allerdings schon länger der Vergangenheit an. Wirtschaftswunder gibt es hier schon länger keine mehr, wirtschaftspolitische Rezepte aus der Nachs- oder gar Zwischenkriegszeit empfinde ich eher als bedrohlich denn als lösungsorientiert (egal, ob sie jetzt mehr oder weniger Staat predigen).
Der Historiker Eric Hobsbawm beschrieb das 20. Jahrhundert im gleichnamigen Buch als “Zeitalter der Extreme”und war Anfang der Neunziger Jahre, als er das Buch schrieb, ungewöhnlich pessimistisch. Er empfand die Phasen des Wirtschaftsaufschwungs in der Nachkriegszeit als unerklärlichen Ausreißer, nicht als logische Folge kollektiver Anstrengung. Das endgültige Ende des Kalten Kriegs war für ihn auch eher ein Nebenschauplatz, der schon längst von neuen Krisenszenarien überholt war. Wem Hobsbawm zu eindeutig politisch exponiert ist, der kann sehr ähnliche Thesen auch bei Ian Kershaw und seiner Geschichte der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts lesen.
Wenn wir jetzt schon die Corona-Krise zum Anlass nehmen sollen, Dinge neu zu denken, dann würde ich gerne dort ansetzen. Vielleicht haben wir uns unsere eigene Geschichte die längste Zeit falsch erzählt. Vielleicht können wir auf gar keine Erfolgsgeschichte von immerwährendem Fortschritt, die wir auch in andere Kontinente exportieren müssen, zurückblicken. Vielleicht können wir uns, wenn wir Zukunftsperspektiven suchen, eher an anderen Kontinenten, in denen das Behelfsmäßige, Improvisierte seit jeher das bestimmende Element ist, orientieren.
Mit dem Durcheinander anfreunden
Gerade im Licht der Corona-Krise blicken viele aus Europa besorgt nach Afrika. Das Virus werde den Kontinent hart treffen, heißt es. Schwache Volkswirtschaften seien nicht dafür gerüstet, der dramatischen Wirtschaftskrise zu begegnen. Das ist eine Sichtweise. Bemerkenswert ist aber, dass diese Einschätzungen oft eher auf Gefühl beruhen und wenig auf Tatsachen gestützt sind. Der Kontinent sei dicht besiedelt, Wasserversorgung sei ein Problem – all das stimmt. Auf der anderen Seite haben viele Länder Afrikas Erfahrung im Umgang mit gefährlichen Viren, Einschränkungen können leichter durchgesetzt werden – und Händewaschen in Restaurants ist in vielen Regionen weiter verbreitet als in Europa.
Und was die wirtschaftlichen Einschränkungen betrifft: Viele Menschen sind es gewohnt, in kleinen Schritten zu denken und zu handeln. Man verlässt sich nicht darauf, dass alles so bleibt wie es ist, man verlässt sich nicht auf staatliche Hilfe oder Bankgarantien. Für Wachstum und Weiterentwicklung ist das schlecht. Aber es ist resilient und pragmatisch.
Vielleicht ist es ja auch für Europa an der Zeit, die Perspektive zu wechseln und sich von der Vorstellung langfristiger stetiger Entwicklung zu verabschieden – zumindest, sofern es das tägliche Leben der Menschen betrifft. Seit Douglas Coupland 1991 Generation X veröffentlichte, hat die Vorstellung vom ewigen Aufstieg ohnehin schon ihren Knacks. Kinder haben nicht mehr die stetigen Karrieren ihrer Eltern, Anlagemöglichkeiten sind weniger sicher, Eigentum ohne Erbschaft ist außer Reichweite. Trotzdem wurde diese Entdeckung seither alle paar Jahre neu gemacht, immer wieder sind neue Generationen der Meinung, sie wären die ersten, die schlechter aussteigen werden als ihre Eltern, immer wieder betrachtet man das als eine Zäsur. Offensichtlich hält diese Abwärtsbewegung seit nun über 30 Jahren kontinuierlich an und schafft es trotzdem, immer wieder Erstaunen hervorzurufen, immer wieder neu als aktuelle Entdeckung verpackt zu werden.
Ich sehe das als Indiz dafür, wie schwer wir uns tun, uns von der Wachstums- und Erfolgsgeschichte zu verabschieden. Immer mehr für alle – das ist das Versprechen, das, wenn wir Hobsbawm oder Kershaw folgen, auf einem Zufall, einem Irrtum beruht, aber trotzdem hartnäckig weitererzählt wird. Und immer öfter kommt man immer wieder erstaunt zu dem Schluss, dass es gar nicht gilt.
Alles oder nichts statt Wachstum
Die Wachstumsgeschichten haben sich verändert. In einer Alles-oder-nichts-Logik lassen wenige Giganten wenig Platz für andere Unternehmen. Durchschlagender Erfolg wird zum Ausnahmeszenario. Das Bild solider Familienunternehmen, die mit Qualität und Verantwortung reich wurden, ist durch das ellbogenaktiver StartUps abgelöst. Effizienz, Durchsetzungsvermögen, Einzigartigkeit – das sind die Kriterien, die die Vorstellung vom friedlichen Biotop, in dem genug Platz für alle ist, abgelöst haben. Das kann unterschiedlich gesehen werden. Eine Interpretation ist: Es geht ja doch. Es ist möglich, Erfolg zu haben, die gleichen Erfolgsstorys zu schreiben, die man sich im vergangenen Jahrhundert gewünscht hat – sogar noch mehr, schneller, weiter. Man muss es nur wollen und sich diesem Prinzip unterordnen.
Eine andere Möglichkeit ist es, unsolidarische Auslesen zu beklagen. Übrig bleibt, wer den anderen nichts übrig lässt.
Noch eine Interpretationsweise wäre es, das Augenmerk auf Kleinteiligkeit und Initiative zu legen: Wo sich etwas bewegt, dort kommt diese Bewegung nicht aus großen Programmen, es ist ein weitaus kleinerer Rahmen, in dem Aktivität stattfindet. Im klassischen Bild muss dieser kleine Rahmen immer verlassen, am liebsten gesprengt werden. Es muss wachsen, groß werden, Arbeitsplätze schaffen. Das ist notwendig, um die Erfolgsgeschichte für alle zu gewährleisten. Das waren wir so gewohnt. Das findet aber weniger und weniger statt.
Das wäre nun gar nicht so tragisch, wenn wir sozial und wirtschaftspolitisch damit umgehen könnten.
Damit landen wir wieder bei den Kleinunternehmen, die am Anfang der Überlegungen standen.Das sind diejenigen, die am längsten arbeiten können, auch wenn sich rundherum alles ändert, weil sie am wenigsten Ballast mitschleppen. Und diejenigen, die am schnellsten wieder arbeiten können, wenn man alles den Bach runtergegangen ist.
Das Problem: Bislang wurden Klein- und Einzelunternehmer eher als unterste Entwicklungsstufe gesehen, als etwas, das vielleicht mal eine Unternehmen werden kann. Mit Netzwerk- und Kommunikationstechnologien können aber gerade einzelne viel schnell bewegen. Kleine und agile Organisationen können sich gut anpassen, Entwicklungen vorwegnehmen und schnell umdisponieren, wenn sie doch falsch liegen.
Eigentlich sind sie das Modell der Zukunft – gerade dort, wo große Industrieproduktion nicht mehr stattfindet, weil sie zu teuer ist (wie in Europa) oder noch nie stattgefunden hat (wie in großen Teilen Afrikas) weil Transportwege und andere Infrastruktur nicht passen.
So schreibt man vielleicht keine großen Wachstums- und Erfolgsgeschichten, man kann schwer, meinetwegen kaum Kontinuität über Generationen hinweg schaffen (wobei das auch andere Ursachen hat) – aber es ist schlicht auch angemessen.
Die neue Kleinteiligkeit
Dafür gibt es aber noch wenig wirtschaftspolitisches Verständnis. Auch das hat sich vor allem in der Corona-Krise gezeigt, als es darauf angekommen wäre, gerade die Kleinen zu stärken und zu erhalten. Das war zwar erklärtes Ziel – die dafür getroffenen Maßnahmen gingen aber in mehreren Runden am Ziel vorbei.
Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge beschreiben in ihrem Buch „Das Digital“ eine von Unternehmen als Organisationsinstrumente menschlicher Arbeit zu Märkten als Koordinationsort von Informationen reichende Entwicklung. Als im wesentlichen Informationsmärkte sind Märkte dabei datengetrieben. Als weitaus kleinere und schnelle Einheiten haben sie so das Potenzial, die besseren Angebote zu schaffen.
Auch diese Perspektive verabschiedet sich vom Idealbild der großen Tanker und Flaggschiffunternehmen – und sogar von der Vorstellung, dass ein Markt, der immer größere immer erfolgreichere Unternehmen hervorbringt (oder zulässt), wenigstens für gute Kapitalgewinne sorgt, wenn schon Lohnquoten sinken. Mayer-Schönberger und Ramge zitieren Daten, denen zufolge auch Kapitalrenditen sinken – sie landen nur noch in Unternehmensgewinnen. In einer Alles-oder-nichts-Logik, die zum beherrschenden Modell von Erfolg, Aufmerksamkeit, Reichweite und anderen monetarisierbaren Elementen wird, fließen Gewinne zunehmend nicht in Forschung und Innovation, sondern darin, die Position abzusichern, indem Geschäftsmodelle exklusiver, ausschließender und kontrollierbarer gemacht werden. Das ist eine Entwicklung, gegen die auch das Marktmodell aus „Das Digital“ erstmal nur auf die Zukunft setzen kann.
Wenn wir jetzt tatsächlich über neue Zeiten nachdenken wollen und uns dabei nicht bloß in Glitzervisionen einer vagen neuen Welt ergehen wollen, dann wäre es wohl ein wichtiger erster Schritt, offen für eine neue Kleinteiligkeit, ihre Netzwerke und ihre Effizienz zu sein. – Das ist es ja auch, was TheoretikerInnen eines neuen datengetriebenen Kapitalismus beschreiben. Und das ist eigentlich, was bislang als Heilsbringer für eine in Schwierigkeiten geratene Wirtschaft gesehen wurde. Die Schattenseite dabei war bis jetzt aber auch, dass Flexibilität, Dynamik und Kleinteiligkeit eben nicht zu soliden, kontinuierlich wachsenden und Verlässlichkeit bringenden großen Strukturen führen. Das galt bislang als Schwäche. Eine reale zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik dagegen würde das als Realität akzeptieren – und sich damit anfreunden. Auch wenn es zu Lasten der bislang gewohnten Erzählungen geht.