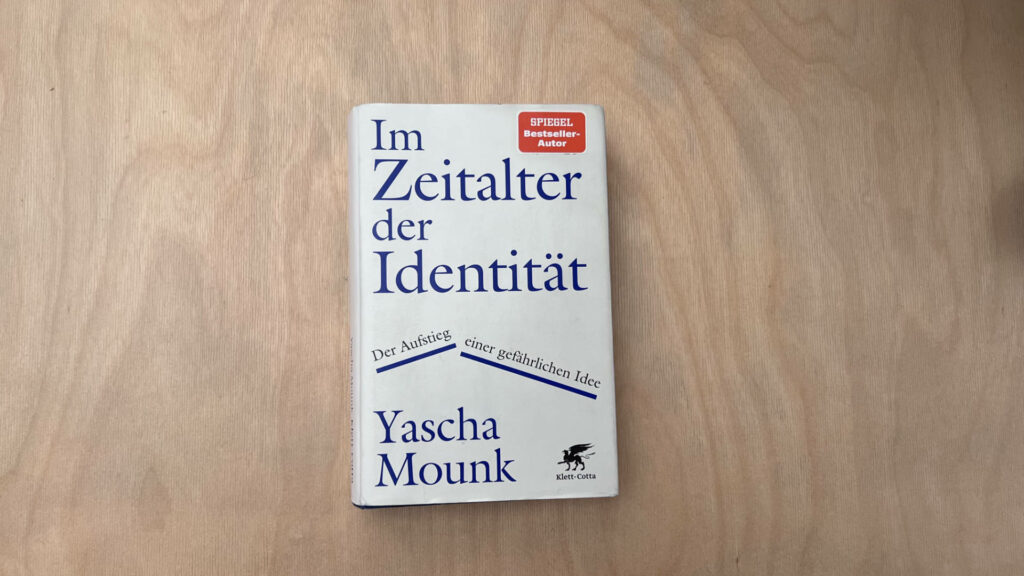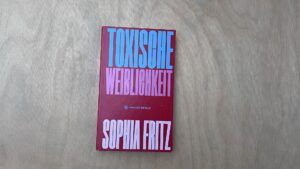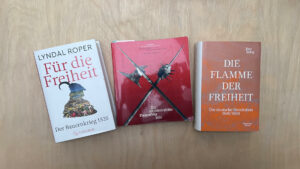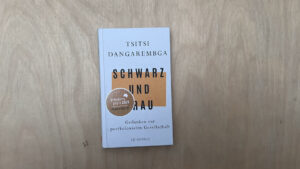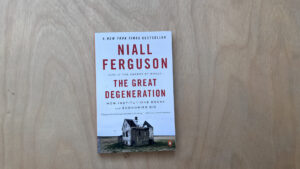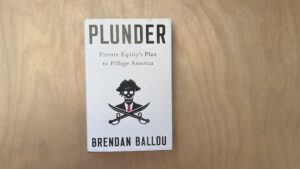Es ist ärgerlich, wenn Cancel Culture, PoMo-Politik oder eben Identitätsrants mit Foucault beginnen. Foucault war vermutlich kein angenehmer Mensch, eher problemverliebt als lösungsorientiert und durchaus auf die passende Pose bedacht, es wäre aber grobes Unrecht, ihm irgendeine Art des Hangs zum Universellen unterstellen zu wollen. Es ist der Kern von Foucaults Arbeit, sich gegen Essenz, Substanz, Wesen und andere Vorstellungen einer letzten, „hinter den Dingen“ liegenden Objektivität oder Wahrheit auszusprechen. Dabei ist Foucault nicht einmal Relativist. Er beschränkt sich auf die Analyse dessen, was wir für unser Verständnis heranziehen können und unterscheidet es von dem, über das zu spekulieren sinnlos wäre.
Gegen Ende seines Buches räumt Mounk das auch ein. Dennoch ist es ein wenig ärgerlich, in den ersten Kapiteln zu suggerieren, es ließe sich eine direkte Linie von Foucault, Lyotard oder Derrida zu den Auswüchsen aktueller Identitäts-Absolutismen ziehen. Beispiele für solche Absolutismen finden sich in akutellen Rasse-, Postkolonialismus- oder Transgender-Theorien.
Auch frühe postkoloniale AutorInnen werden von Mounk nicht ganz fair in die Ahnenreihe von PoMo-Identitären IdeologInnen gestellt. Edward Said verwehrte sich ganz entschieden gegen jedweden Essenzialismus, der obskure Faszination für das Orientalische schaffte und Menschen aus dem Orient von Personen zu Ausstellungsstücken in europäischen Salons verwandelte.
Gayatri Spivak bezeichnete ihren Essenzialismus ganz ausdrücklich als strategischen Essenzialismus und distanzierte sich später noch davon.
Dekonstruktion und philosophische Postmoderne sind keine gute Basis für konstruktive Kritik, sondern eben das Ende eine an sich nicht besonders konstruktiven Diskussion. Das macht Dekonstruktion als Methode nicht falsch, aber auch nicht unbedingt nützlich. Dekonstruktion kehrt Grundlagen und Funktionsweisen, die gern übergangen werden, nach außen, zerlegt sie, nimmt Begriffe und Ideologien auseinander. Dabei geht Dekonstruktion nicht vor wie jemand, der das alte Radio noch mal zusammenbauen möchte, auch wenn er es nicht reparieren kann, sondern eher wie jemand, der sich von dem Gerät schon verabschiedet hat, aber dennoch wissen möchte, wie es innen aussieht, bevor es auf dem Recyclinghof landet.
Dekonstruktion liefert keine Handlungsanleitungen. Aber Dekonstruktion vermittelt Wissen und schafft die Grundlage, sich frei für andere Wege zu entscheiden. Dekonstruktion schafft die Freiheit, alle möglichen Entscheidungen zu treffen. Aber sie liefert keine Mittel und Argumente, eine Entscheidung zu rechtfertigen oder über andere zu stellen. Das ist eines der großen Missverständnisse, wenn frühe Postmoderne herangezogen wird, um aktuelle Essenzialismus- und Absolutismus-Auswüchse zu kritisieren.
Ähnlich verhält es sich mit Standpunkttheorie und anderen um Differenzierung bemühten Methoden. Man sieht die Welt anders, wenn man sie von einem anderen Standpunkt aus betrachtet. Dass man Menschen nicht verstehen kann, die mit einem anderen Standpunkt aufgewachsen sind, ist Unsinn – wozu auch sollte man ihnen denn dann zuhören? Eine solche Interpretation der Standpunkttheorie ist absurd.
Beide, Standpunkttheorie und Dekonstruktion und viele andere kritisierte Theorien sind Diagnosewerkzeuge, keine Handlungsanleitungen, keine moralischen Prinzipien und politischen Paradigmen.
Mounk arbeitet sich trotzdem daran ab. Das ist die Schwäche dieses Buchs.
Die Stärke ist der Schnelldurchlauf durch allerhand zeitgenössische Rasse-, Klasse-, Gender- und Kolonialismuskonzepte, die allesamt ähnliche Karrieren von guten Diagnosen zu schlechten Handlungsanleitungen durchlaufen haben.
Tragisch ist vor allem die Karriere des Free Speech-Begriffs. Rede- und Meinungsfreiheit, eines der zentralen Anliegen frühbürgerlicher Revolutionen, dann Prunkstück jeder Demokratie, später Toleranzgrenzen herausforderndes Sorgenkind und von Rechten missbrauchte Tarnung für verlogene Ideologiepropaganda, ist heute ein Feindbild, dem unterstellt wird, in Diensten Konservativer zu stehen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich vor Augen hält, wer am lautesten „Das wird man doch noch sagen dürfen!“ ruft. Dennoch ist es eine der erschreckendsten Entwicklungen unserer Zeit, wie schnell sich jüngere Menschen mit Kontrolle, Überwachung und Verboten (für andere) anfreunden.
Progressiver Separationismus als als Förderung verstandene neue Rassentrennung, Trans vs. Feminismus-Kämpfe und neuer Klassenkampf sind weitere Beispiele dafür, wie aus guten Diagnosen schlechte Handlungsempfehlungen wurden. Allesamt können sie sich auf ein neues Feindbild einigen: Feind der neuen Rasse-, Klasse- und Gender-Essenzialisten ist der Liberalismus.
Liberalismus, der eigentlich nur alle sein lassen wollte, wie sie sind, ist zu wenig supportive. Liberalismus kritisiert die Vorstellung, dass etwas so sein sollte und nicht anders sein darf. Das verträgt sich schlecht mit der Idee, dass Identitäten sich zwar aus verschiedensten Elementen zusammensetzen, aber dennoch unhintergehbar prägende Merkmale unserer Menschlichkeit sind, denen wir ausgeliefert sind. Man müsse Identität an erste Stelle stellen, um gute Entscheidungen treffen zu können, und die Betonung bislang unterdrückter Identitäten aus Kosten der ehemaligen Unterdrücker sei wichtiger als altmodische Unterstellungen von Freiheit.
Mounk setzt nach seiner Ausarbeitung dieser Auswüchse zu einem Plädoyer für den Liberalismus an – aber er bringt nur schwache Argumente, die Wasser auf die Mühlen linksidentitärer Essenzialisten sind. Es ist ja eben die Tragik des Liberalismus, dass Argumente, die sich an jene richten sollten, die Liberalismus ablehnen, genau diese überhaupt nicht interessieren – oder eben ihre härtesten Kritikpunkte sind.
Liebralismus ist aus Prinzip ein schwaches Argument.
Was sich gegenüber grassierendem Identitätsessenzialismus durchsetzen müsste, ist die Einsicht, dass ähnlich wie im Fall von Dekonstruktion und Postmoderne, die Diagnose vielleicht stimmt. Aber die Werkzeuge, die zur Diagnose geführt haben, liefern denkbar schlechte Handlungsanleitungen.