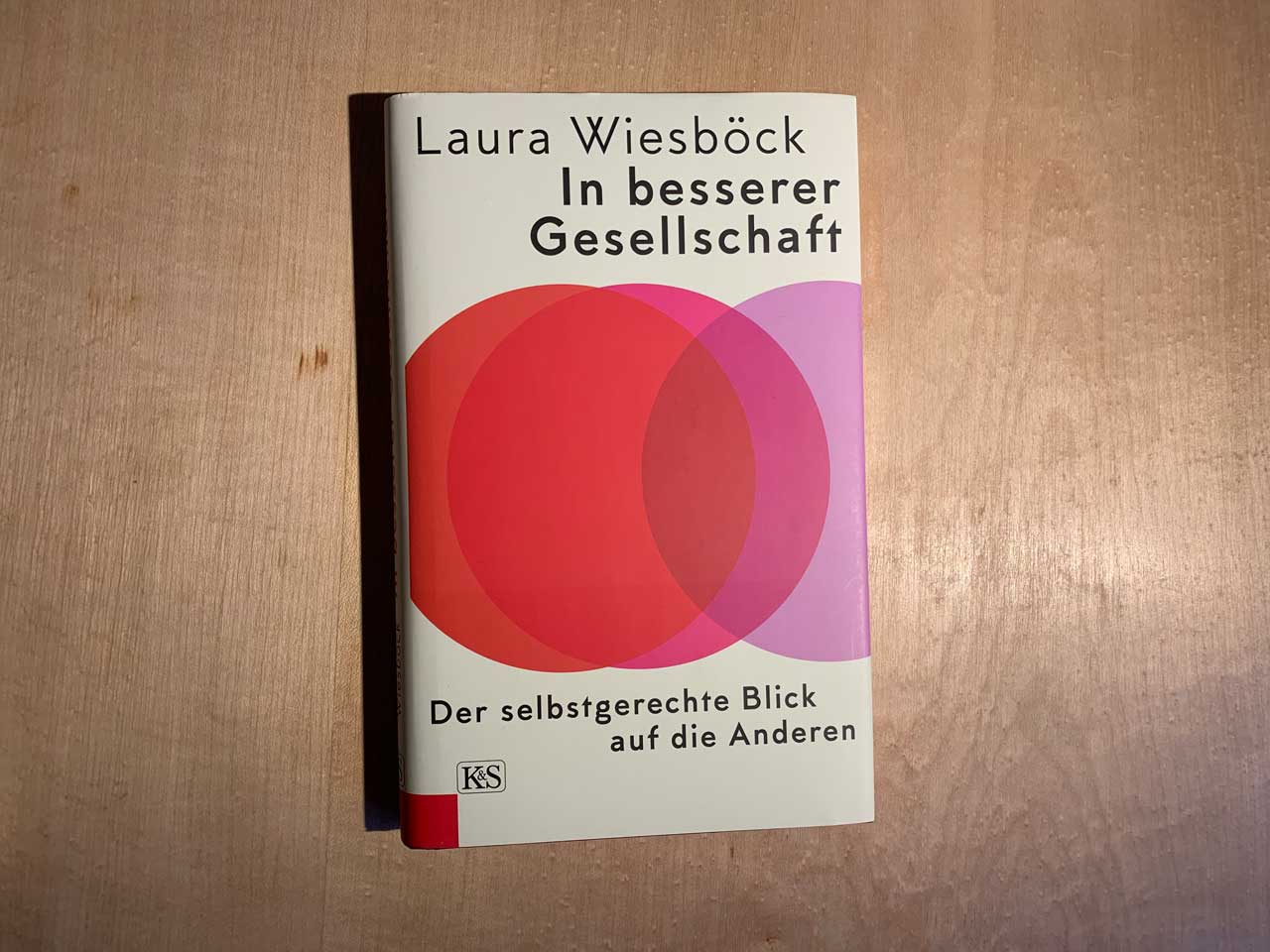Ich hatte mein Problem mit diesem Buch. Ein griffiger Titel, eine neugierig machende These – und das wars dann auch schon. Ich weiß, dass „Selbstgerechtheit“ ein zeitgenössischer Universalvorwurf ist, der sich sehr vielen machen lässt und eigentlich immer passt. Es gibt schließlich kein Entkommen – auch Selbstkritik ist selbstgerecht, schließlich wird sie vorrangig von Privilegierten geübt; außerdem dient sie auch der Distinktion.
Wiesböck beschreibt viele Szenarien, reißt viele Perspektiven und Themen an – und immer dann, wenn man auf die Analyse, die Essenz, den eigentlichen Gedanken wartet, ist das Kapitel auch schon wieder aus.
Ich konnte keinen roten Faden, keinen eigentlichen Gedanken finden, keinen Ansatz, der die im Buch beschriebenen Szenarien produktiv oder intellektuell nutzbar machen würde. Vielleicht war das auch der falsche Zugang zum Buch. Mir fehlt jedenfalls viel. Ein wenig kommt mir auch die hier beschriebene Fragestellung wieder in den Sinn: Was muss alles gesagt werden, was dürfen wir als bekannt und anerkannt voraussetzen, und was gilt nur dann, wenn wir es selbst gesagt haben? Wie weit müssen wir uns von einer anderen, einer alten, einer abgelehnten Welt abgrenzen, indem wir deren Geschichten und Theorien mit eigenen Worten wiederholen – auf die Gefahr hin, dann keine Zeit und keine Energie mehr für unseren eigenen, eigentlichen Punkt zu haben?
Ein Punkt, den man herauslesen kann: Für die Autorin wird Abgrenzung oft zu Abwertung. Die Enttarnung dieser Abwertung geschieht dann oft ebenfalls abwertend oder tendenziös. Das halte ich für problematisch und kontraproduktiv: Die Vorstellung von Abwertung als Abgrenzung funktioniert nur dann wirklich, wenn wir Normen und Ideale in den Raum stellen, die für alle gelten sollen. Abgrenzung ist aber oft etwas sehr persönliches: Manche Menschen fühlen sich in Gesellschaft nicht wohl, andere wollen sich lieber mit Modelleisenbahnen oder Fantasy-Rollenspielen, seltenen Comic-Ausgaben oder einer bestimmten Periode der Philosophiegeschichte beschäftigen, als von anderen, die sie nicht kennen, die ihnen nichts bedeuten, vor denen sie sich vielleicht ein wenig fürchten, toll gefunden zu werden. Darin steckt kein Werturteil, das ist in erster Linie eine persönliche Entscheidung. Eine persönliche Wahl sollte auch nicht als kritisierbares Werturteil über andere gesehen werden, wenn sich dieses Urteil nicht auch an konkreten Handlungen und Aussagen erkennen lässt.
Eine meiner bescheidenen Meinung nach spannende Fragestellung wäre es, die von Wiesböck beschriebenen Szenarien daraufhin zu analysieren, was sie konkret und aktiv über andere aussagen. Ein Beispiel: Wiesböck sieht in einer von Erfüllung, Selbstverwirklichung und „Do what you love“ geprägten Arbeitswelt die Abwertung des Brotjobs. Möglicherweise handelt es sich aber auch eher um die Abwertung des Individuums, das sich nicht mehr genügt, das Sorge hat, anderen nicht zu genügen, und deshalb auch vermehrt symbolisches Kapital ansammeln muss.
Vermutlich ist das eine Frage der Perspektive. Manche Menschen beginnen mit jeder Form der Kritik bei sich selbst. Andere richten Kritik immer zuerst an andere. Und wieder andere verstehen alle möglichen Reaktionen von anderen zuerst mal als Kritik an sich selbst, auch wenn sie weder angesprochen noch gemeint waren. – Dazwischen tun sich Abgründe auf, die zu überwinden es einer neuen Gesprächsgrundlage bedürfte, die genau diesen Fallen ausweichen kann.
Das klingt reichlich kompliziert. Die Kurzfassung: Ich weiß auch nach 200 Seiten nicht, welches Problem Wiesböck in ihrem Buch thematisiert. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass ich eine grundlegend andere Auffassung von Problem habe.