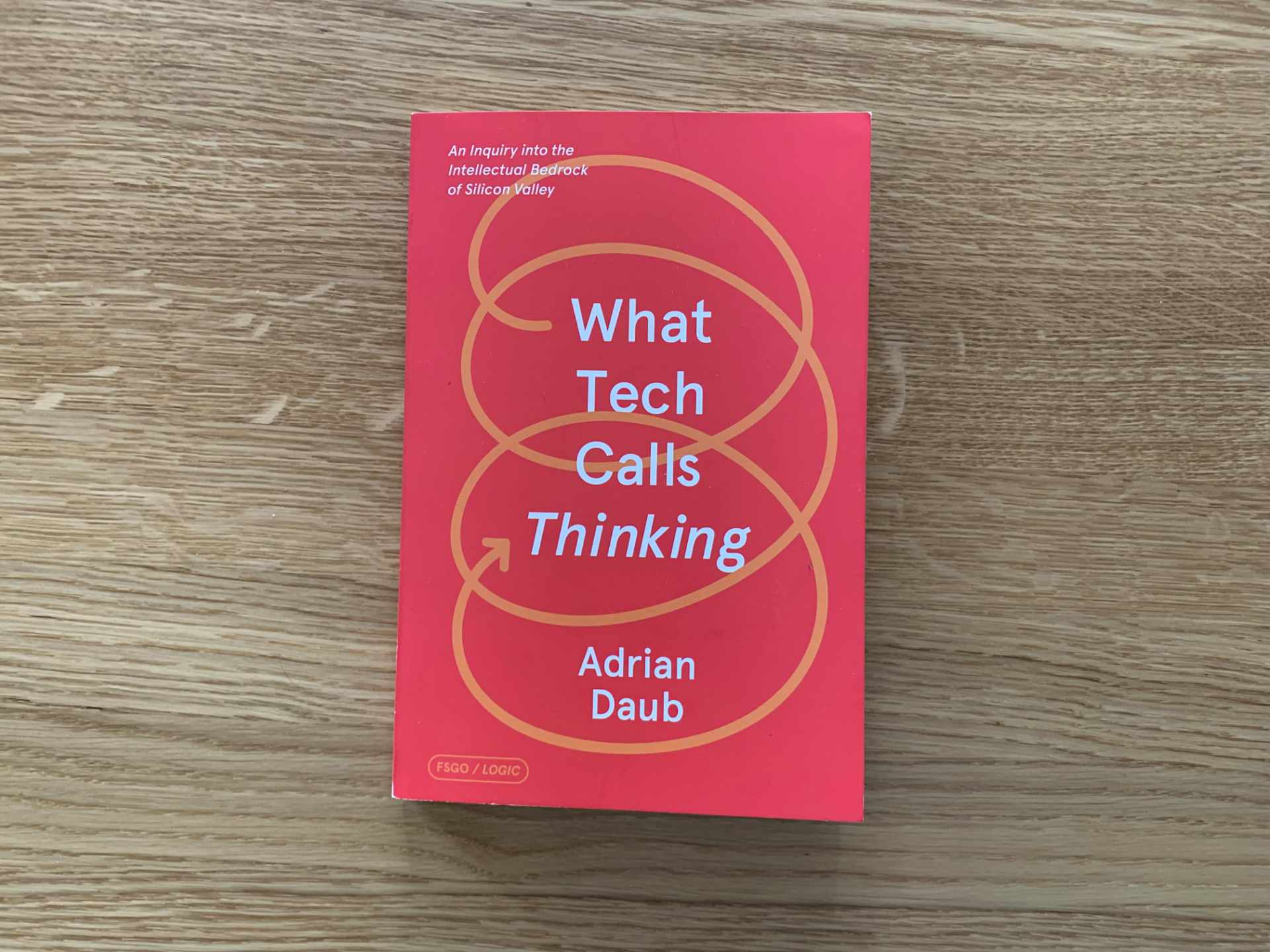Informatik ist eine Kulturtechnik – computational know how hilft, sich besser in der Welt zurechtzufinden. Dieser Gedanke setzt sich zunehmend durch und findet seinen Niederschlag in bildungspolitischen Forderungen nach mehr, früherem und besserem Informatikunterricht in den Schulen, im Verlangen nach Interdisziplinarität, die Informatik nicht nur als hilfreichen Problemlöser wie einen Taschenrechner betrachtet und im Anspruch, Informatik als die Grundlagenwissenschaft unserer Zeit zu betrachten (so wie es früher Astronomie, Theologie oder Physik waren).
In diesem Fahrwasser schwimmt eine neue Technikgläubigkeit mit, die nicht nur digitale Technologie als Problemlöser schlechthin verehrt, sondern im Tech-Marketing auch eine neue intellektuelle Messlatte sieht, die das geistige Leben bestimmt. Die weit ausholenden Pitches von Tech-Giganten oder Startups und deren Versprechen und ideologische Visionen gelten als neue Philosophie, die erklärt, warum und wie plötzlich so vieles möglich wird. Dass diese Pitches und Predigten gemeinhin nichts erklären, sondern bestenfalls Behauptungen in den Raum stellen, bleibt dabei gern unbeachtet auf der Strecke.
Adrian Daub untersucht diese Entwicklung in „What Tech Calls Thinking“ und macht sich auf die Suche nach den Vorläufern dieser Erfolgsgeschichte.
Zentrale Figuren in dieser Linie sind Ayn Rand und der eigentlich schon wieder vergessene René Girard. Ayn Rand ist für Daub die Urmutter der rebellischen Pose, die sich weniger mit Verhältnissen oder Grundlagen beschäftigt, gegen die es zu rebellieren gelte, sondern mit der Inszenierung als Rebell. Dabei reichen persönliche Veränderungen, Beschriftungen – und Konsum. Wer ungern Steuern zahlt ist mit Ayn Rand kein korrupter Steuerbetrüger, sondern ein Rebell, der Zeichen gegen die totalitaristische Gleichmacherei des Staats setzt. Wer die richtigen wiederbefüllbaren Trinkflaschen verwendet, ist ein Öko-Aktivist. Wer die richtigen Tech-Gadgets verwendet, die alle verwenden, ist ein reflektierter Individualist, dem man nichts vormachen kann.
Die Pose des Rebellen kann vor allem dann umso leichter eingenommen werden, wenn die passende Ideologie alle anderen als gleichförmige graue Masse betrachten kann, von der man sich selbst dank bestimmter Einsichten abheben kann.
Das Rüstzeug dafür lieferte René Girard, der laut Daub vor allem Peter Thiel beeinflusst haben soll. Auf Wikipedia wird Girard als „Historiker und Polymath“ bezeichnet – Polymathie ist eine freundliche Umschreibung für Universaldilettantismus; die Herausgeber früher wissenschaftlicher Zeitschriften des 17. Jahrhunderts, die sich buchstäblich mit Gott und der Welt beschäftigen, galten als Polymathen (einen Überblick zur wissenschaftlich literarischen Medienbubble des 17 und 18. Jahrhunderts gibt es übrigens hier, eine punktuelle Auseinandersetzung mit einigen Polymathen der Aufklärung hier).
Als Polymath entwickelte Girard die Theorie des mimetischen Begehrens. Kurz erklärt: Alle wollen das gleiche. Das ist nun kein unplausibles Phänomen, auch der mimetische Aspekt (wir sehen (oder glauben), dass jemand dank der Erfüllung seines Begehrens glücklich wird und begehren ähnliches) ist nicht weltfremd.
Fragwürdig ist allerdings, darauf weist Daub hin, wie sich die Verabsolutierung dieser Diagnose argumentieren lässt, noch fragwürdiger ist, wie sich, wenn das Prinzip absolut gilt, dann doch einzelne Wissende diesem entziehen können.
Daub sieht in dieser kunstvollen Inszenierung den Archetyp des Pitches, wie es ihn seit den Zeitalter der Homeshopping-Fernsehkanäle gibt: Ein belangloses Problem wird zur unüberwindlichen Hürde erhoben, eine beliebige Idee wird zum allgemein gültigen Prinzip stilisiert, aus einer punktuellen Problemlösung wird die Zukunftsvision der Menschheit destilliert (wobei dahingestellt bleiben muss, ob das gelöste Problem eines war).
Das verlockende und gleichzeitig besonders perfide an diesem Spiel ist: Alle können mitmachen. Wenn Form, Stil und Pose passen, steht es allen offen, in diesem Chor der Begeisterung mitzusingen. Es wäre in Gegenteil überaus unsportlich und ein Zeichen von schlechtem Benehmen, auf Schwächen in der Erzählung hinzuweisen, Fragen zur Relevanz zu stellen oder die allgemeine Begeisterung nicht zu teilen.
Einer der zentralen Begriffe des Tech-Diskurses, an dem diese Phänomene mühelos durchdekliniert werden können, ist etwa „Disruption“: Vom großen Versprechen, alles von Grund auf zu ändern, bleibt in der Regel eine Ayn-Rand-hafte Pose, die Bestehendes ein wenig anders arrangiert und eventuell neu einfärbt.
Wo es um Technik zu zeitgemäße Medien geht, ist natürlich auch McLuhan nicht weit. Daub schlägt dabei vor, McLuhans Diagnose des Primats von Medium über Message (was zählt, ist die mediale Form, der Content ist Nebensache) auf Plattformen und Social Media anzuwenden: Reich und berühmt wird nicht, wer Inhalte schafft und Medien am Leben erhält – die Erfinder und Betreiber der Plattformen gelten als die Medienvisionäre der Zukunft. Ihre Relevanz beruht dabei auf formalen Kriterien wie Reichweite, Reichtum und Wachstum. Inhalte und Innovation sind nebensächlich.
Daub analysiert mit großer Schärfe, detaillierter Recherche und viel Wissen Kommunikationsmodelle, die wohl vielen BeobachterInnen schon übel aufgestoßen sind, die aber kaum noch so klar beschrieben und vor allem so stringent hergeleitet wurden. Seine Untersuchung lässt erahnen, wie weit diese Kommunikations- und Denkmuster auch andere Bereiche beeinflussen: Journalismus, Politik, politische Analyse verfallen zunehmend Alles-oder-nichts-Mustern, in denen die eigenen (im Sinn von Ayn Rand selbst geschaffenen) Weltbilder die letzte Instanz sind, die über Realität oder Illusion entscheiden – und in denen gegen Feindbilder angeschrieben wird, die zuvor selbst erstellt wurden. Man denke nur an den Alltag auf Plattformen des sozialen Allwissens wie Twitter oder an „Journalisten“, die den Kommentar für die wichtigste Mediengattung halten.
Ich habe ähnliche Strategien als Kulturtechnik des Behauptens beschrieben – allerdings nicht so klar und kulturwissenschaftlich fundiert wie Daub. Ich freu mich jetzt auch darauf, mit diesen neuen Anstößen an diesem Konzept weiterzuarbeiten.