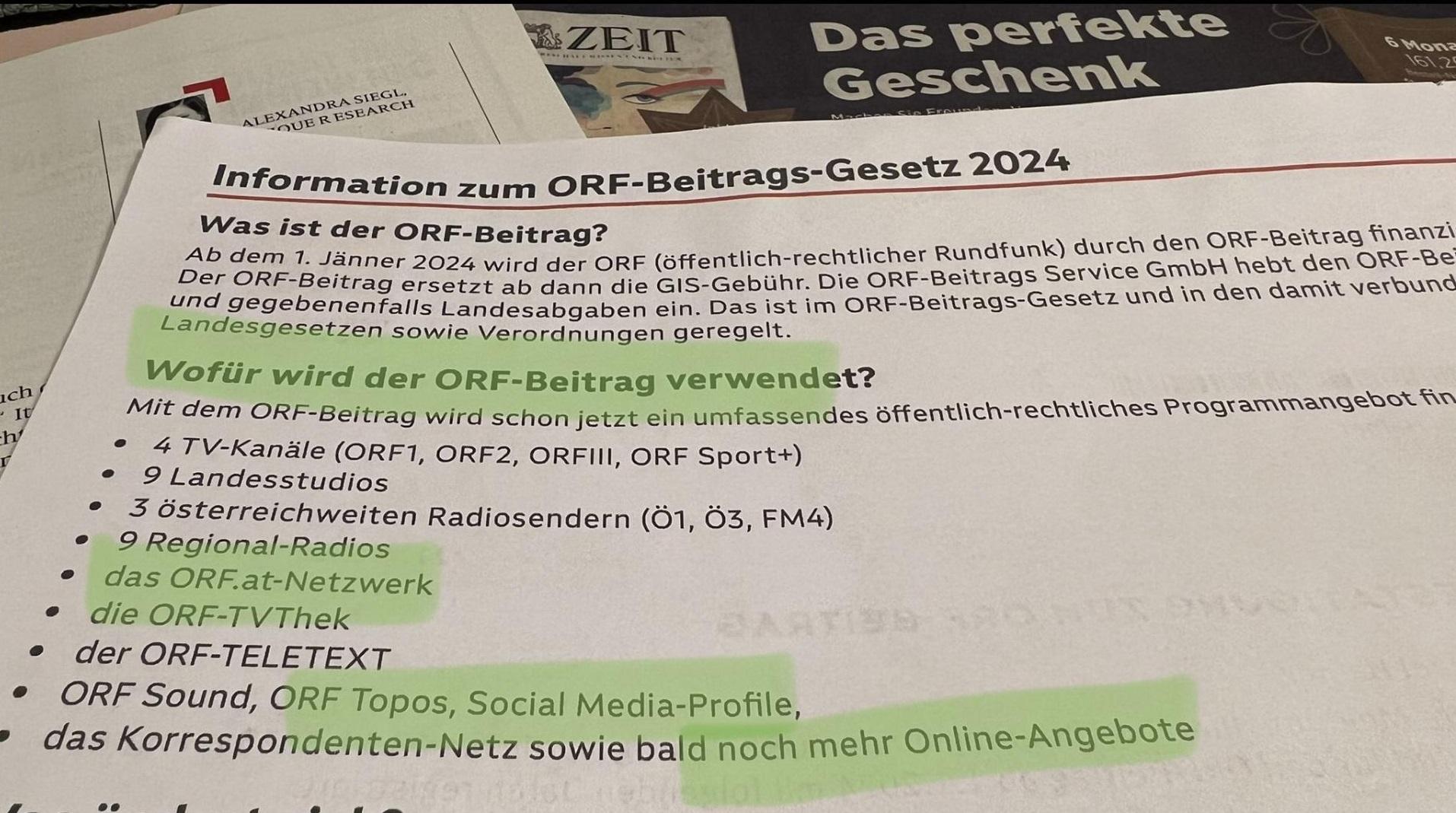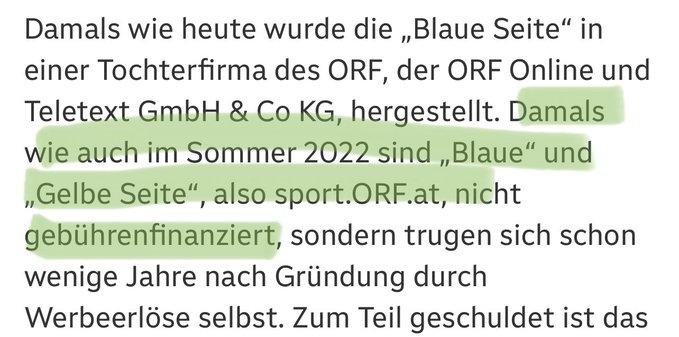Die Zukunft kommt nicht mehr. Sie ist schon da, sie ist insofern vorweggenommen, als wir so tun müssen, als hätten wir alle Mittel, sie zu steuern und zu gestalten. Digitalisierung schafft Phantasmen universellen Wissens, in denen keine Frage offen bleibt, auch nicht die nach der Zukunft. Wir finden auf alles eine Antwort, es bleibt kein Raum für Unbekanntes. Das verkleinert die Welt – die Welt hat ihre Grenzen erreicht. Wir müssen uns der Tatsache stellen: Das ist es. Da kommt nichts anderes mehr. Dieses Bewusstsein von Endlichkeit ist die Ausgangslage für harte Verteilungskämpfe, die Normalisierung von Extremsituationen und ständig neue Versionen der Vorstellung von Essenz und Zweck des Menschen.
Das ist in etwa die Kernthese von Mbembes sehr dichtem und komplexem Brutalisme-Text. Mbembe schreibt wortgewaltig und radikal, betont diverse und außereuropäische Perspektiven, verwendet (hier und noch öfter in anderen Texten) das N-Wort, um das andere zu kennzeichnen, und war wegen seiner Ausführungen zu Biopolitik und Machttechniken gelegentlich mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert.
Brutalisme ist eine Fortführung der Überlegungen zu Biopolitik und Nekropolitik und beschreibt ein von Digitalisierung und Berechenbarkeit geprägtes Weltbild as Diagnoseframework unserer Zeit. Brutalismus muss etwa in der Dimension des Begriffs Humanismus verstanden werden. Der Begriff bietet eine Perspektive auf globale Entwicklungen.
Mbembes Perspektiven sind großteils keine freundlichen. Hoffnung ist kein Wert, Werte als anzustrebende Leitbilder, als Essenzen, auf die man hinarbeiten kann, haben generell eher ausgedient. Was zählt, ist Berechenbarkeit. Digitalisierung und Rationalisierung sind wesentliche Grundpfeiler des Brutalismus. Berechenbarkeit schafft Gemeinsamkeiten. Diese sind allerdings keine verbindenden Elemente, sie sind Gemeinsamkeiten im Sinn von Gemeinheiten oder Banalitäten – es gibt nichts anderes. Vernunft ist ökonomisch, biologisch, algorithmisch – sie berechnet und entscheidet mehr, als sie entdeckt. Das gehört zu den Grundzügen technologischer Vernunft.
Weil Technik entscheidet und definiert (und sich dabei nicht um Ideen wie Wahrheit kümmern muss) entstehen andere Versionen von richtig und falsch. Richtig ist in technisch dominierten Weltbildern was funktioniert. Dieser Pragmatismus findet sich in frühen Technologiekonzepten von John Dewey bis Don Ihde und erfährt bei Mbembe eine weitere Zuspitzung: Sieger müssen recht haben.
Das stellt den Sinn von Begriffen wie richtig und falsch infrage – und es wird für Mbembe zur Startrampe für einen Essay über Machtmechanismen.
In welcher Beziehung stehen Brutalismus und Migration? Mbembe ist geneigt, ein Recht auf Migration zu postulieren, ein Recht, das in weiten Teilen der Welt nicht verankert, aber teilweise Praxis ist, bis es in Europa an harte Grenzen stößt. Er greift marxistische Motive auf und dehnt den Begriff der Überflüssigen auf jene auf, denen im Rahmen von Migrationsregelungen keine Rolle gegeben wird, jenen, die weder erwünschte Zuzügler noch zu duldende Flüchtlinge sind. Migrationspolitik im Zeichen des Brutalismus ist für Mbembe Lebensraumpolitik – ein NS-belasteter Begriff. Etwas verschwommen ist allerdings der Adressat dieser Diagnose. In vielem beschreibt Mbembe Maßnahmen und Zustände aus außereuropäischen Migrationsrouten, greift aber die Europäische Union an. Die Einteilung von Menschen in nützliche und überflüssige, von Weltregionen in lebenswerte, sichere, bewohnbare und lebensfeindliche und die Erstellung von Matrizen, die bestimmte Arten von Menschen auf bestimmte Regionen verteilen und sie dorthin verschieben wollen, ist ein kerneuropäisches Anliegen, aber eines, das ohne den Rest der Welt nicht umsetzbar sein wird. Brutalismus als Nutzenkalkül jedenfalls verändert die Rolle der Überflüssigen – für Mbembe haben sie nicht einmal mehr Fleischwert.
Von hier aus schlägt Mbembe eine nicht ganz leicht nachzuvollziehende Brücke zu Kunst und Restitution. Das verbindende Element: Die (europäisch-)brutalistische Perspektive kategorisiert und rationalisiert ohne Sinn für ihr verborgene Essenzen. Das ist ein Erklärungsansatz für Migrationspolitik, das ist auch ein Leitmotiv in der Debatte um afrikanische Kunst und Restitution.
Mbembe ist ein klarer Befürworter der Restitution afrikanischer Kunst aus europäischen Museen. Restitution bedeutet allerdings nicht nur die Rückgabe von Gegenständen. Er verbindet mit Restitution auch die Auseinandersetzung damit, was die geraubten oder gekauften oder ertauschten Gegenstände bedeuten. Unrechtmäßige Aneignung ist für Mbembe nicht nur mit Gewalt verbunden. Sie liegt auch dann vor, wenn Kunstgegenstände entfremdet, (falsch) interpretiert, aus einer europäischen Perspektive bewertet wurden und damit dazu beigetragen haben, falsche Bilder von afrikanischer Kunst, Philosophie und Technik entstehen zu lassen. Die Kunstgegenstände wurden missbraucht und zu Zeugen einer nie stattgefundenen Geschichte gemacht. So erzählen sie – für Europäer stringente – Geschichten, die Sinn ergeben und Wirkung entfalten und damit, auch wenn sie zurückgegeben werden, falsche Perspektiven produzieren.
Auch das ist Brutalismus.
Was sind Gegenpositionen? Mbembe erwähnt einen möglicherweise anderen afrikanischen Begriff von Technologie, der Technik weniger als Werkzeug und Mittel zum Zweck sieht. Im Vordergrund steht mehr die Auseinandersetzung mit dem, was ist, nicht mit dem, was durch Technik geschaffen wird. Dabei bleibt Mbembe allerdings vage und Andeutungen verhaftet.