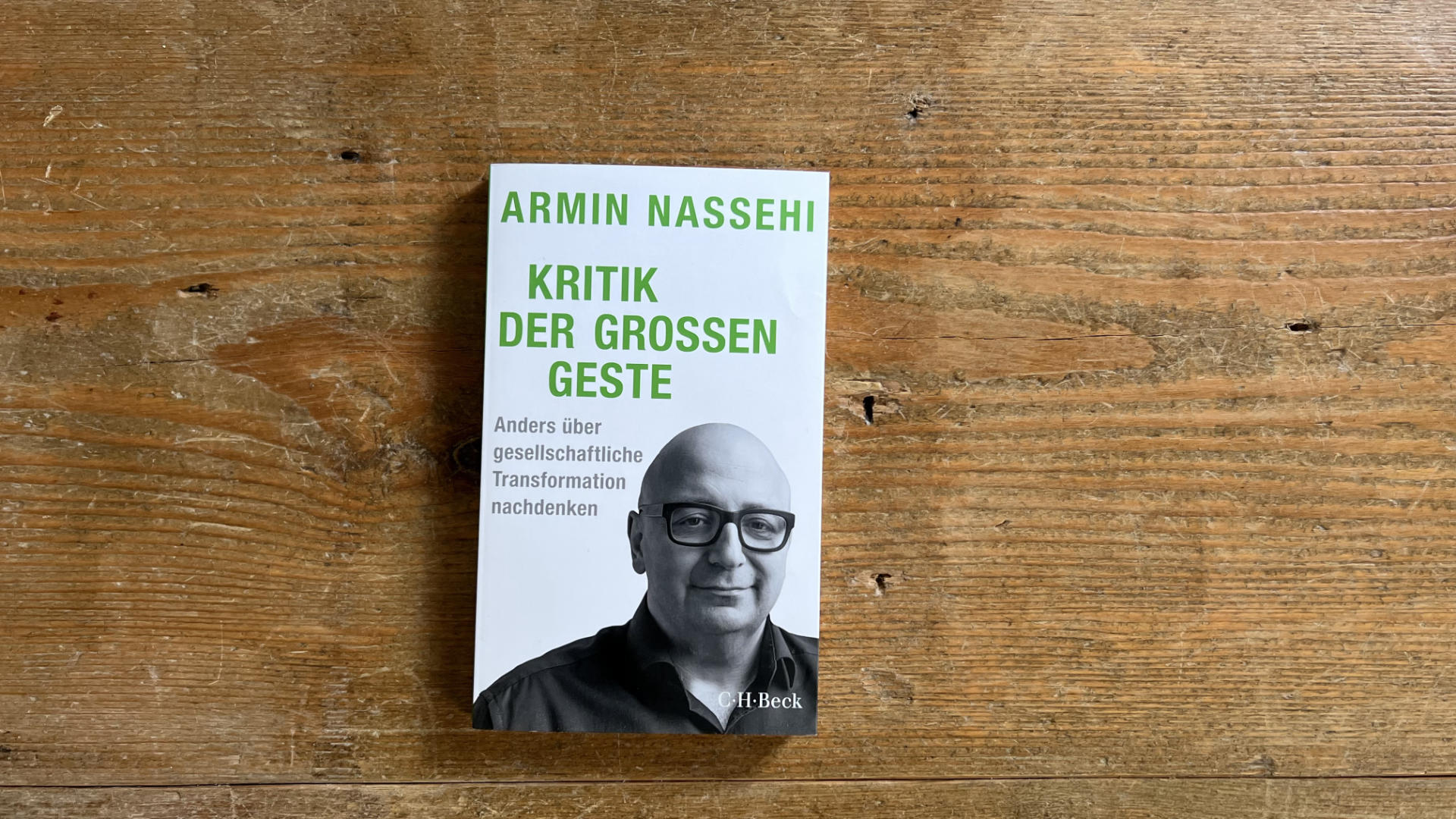Gefahren und Ursachen der Klimakrise sind bekannt, man müsste doch nur. KI, Big Data – Visionen sind schnell gezimmert, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alle müssen agieren. Transformationsprozesse sind so allgegenwärtig und dabei so unberührt von Transformationen konstant wie die Trafo-Hütten der lokalen E-Werke. Alle predigen Veränderungen und kennen die Lösungen – aber nichts passiert.
In etwa dieses Szenario steigt Armin Nassehi mit seiner „Kritik der großen Geste“ ein. Transformation ist ein häufig bemühter Begriff. Dem steht allerdings hartnäckige Trägheit gegenüber, die der Soziologie in der Gesellschaft beobachtet. Verhaltensmuster und Meinungen ändern sich nur sehr langsam, es ist nicht einmal eine anständige Spaltung zu diagnostizieren. Nassehi beruft sich dabei auf Steffen Maus Triggerpunkte.
Die Macht von Wissen wird überschätzt, nur weil man etwas weiß, muss man nicht danach handeln. Eine schöne Beobachtung zur Trägheit ist die Feststellung, dass die Erwartungen an die Disruptivität von KI, vor allem in ihrer Ausprägung als Large Language Models, auf der Unerschütterlichkeit ihres Gegenstands beruhen. LLMs können deshalb so effizient lernen, weil so viele Menschen so oft das gleiche sagen und sich daraus wunderbar konstante Muster bilden lassen.
Krisen, so eine Erwartung, könnten an dieser Trägheit etwas ändern. Klima, Corona und der Ukraine-Krieg haben viele Prediger und Visionäre auf den Plan gerufen, Welten von Selbstverständlichkeiten (Wir müssen das! Wir brauchen dies! Alles wird so!) sind aufeinandergeprallt und haben trotz ihres Energie- und Aufmerksamkeitsverbrauchs wenig bewegt.
Was allerdings etwas deutlicher geworden ist: Unterschiedliche Legitimationssysteme, Erwartungshaltungen, Wertvorstellungen oder Ziele sorgen dafür, dass aus den gleichen Voraussetzungen unterschiedliche Schlüsse gezogen werden – und wenig passiert, weil sich vieles Gegenseitig aufhebt.
Nassehi nennt es Visibilisierungserfahrung, wenn Grundlagen so unterschiedlich offenbar werden. Unterschiede lassen verstehen, dass wenig schnell passiert, dass Motivation und die Chance, Dinge durchzusetzen, für jede Einstellung anders funktionieren, dass Vernunft weniger mächtig ist als vernünftig wäre. Was Nassehi schließlich durch den gesamten Text öfters wiederholt: Gesellschaften sind kein Kollektiv. Sie können nicht als Kollektiv reagieren, auch wenn Herausforderungen kollektive sind.
Transformationsaufrufe und -visionen ignorieren das. Wissenschaftler, die mit Fakten Verhaltensprobleme lösen wollen, Politiker, die populistische Kurzfassungen predigen, Verschwörungstheoretiker, die gegen die da oben wettern, Kapitalismuskritiker, die das Böse im Profit sehen, sie alle bedienen sich einer Zinnsoldatenlogik, in der sie die Handelnden sind, gezielt einzelne Parameter steuern können und alle anderen sich danach richten wie die Zinnsoldaten. Zinnsoldaten sind ohne diese Erweckungsrufe in die Irre gelaufen, jetzt wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen – nichts davon passiert in der Regel.
Diese Art der Interaktion tarnt sich häufig als Gespräch, in dem Offenbarungen und Überzeugungen vermittelt werden, ausgetauscht werden sie ja nicht. Denn, Nassehi zitiert Gadamer, Gespräche sind nur dann prinzipiell möglich, wenn beide Seiten einräumen, dass der andere auch Recht haben könnte. Wo andere immer falsch liegen müssen, verfällt man wieder in die Zinnsoldatenlogik.
Lineare Darstellungen, ob in wissenschaftlichen Texten oder in Influencer-Kanälen, die Dinge in Abläufe bringen, Reihenfolgen und damit gar Kausalitäten suggerieren, verstärken das Missverständnis einer einfachen und geordneten Problemlage. Wenn alles so schön ordentlich erzählt werden kann, ist nicht einzusehen, warum Probleme nicht auch einfach gelöst werden können.
Diese großen Sätze, so Nassehis Gesamtdiagnose, sind allerdings zu groß und zu pathetisch für die vielen kleinen und kontingenten Reallösungen, die sich auch viele kleine und konkrete Probleme beziehen könnten.
Nassehis Diagnose stimme ich uneingeschränkt zu; über das Problem der großen Gesten habe ich schon mal ein ganzes Heft geschrieben. Nassehi bleibt auch ausdrücklich beim Problem und vermeidet Lösungen, allen voran politische Rezepte. Vielleicht liegt es auch am Verzicht auf die große Geste, dass die Argumentation streckenweise etwas zäh und redundant wirkt, denn die Geste ist schließlich auch Entertainment. Dem realistischen Erbsenzähler hört man nicht so gern zu. Brauchen wir jetzt mehr Achtung für Erbsenzähler? Oder müssen wir große Gesten auch für kleine und konkrete Lösungen entwickeln? Aber ist letzteres nicht die Königsdisziplin des Bullshittens?