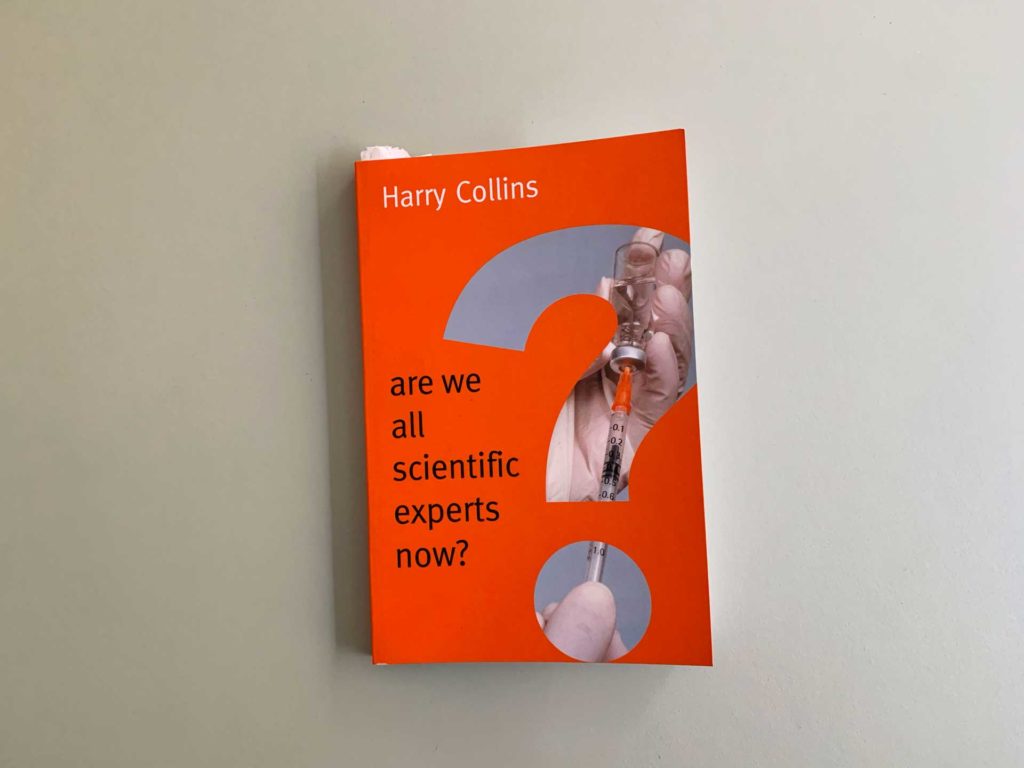Die Politik haben wir glatten Karrieristen ohne Idee überlassen, in den Medien arbeiten überwiegend ungebildete Menschen mit mangelhaften Rechtschreib- und Grammatikkenntnissen, die Wissenschaft wird als nächstes die große Wurschtigkeit nicht überleben. Dem müssen wir etwas entgegensetzen, meint der Wissenschaftssoziologe Harry Collins in seinem aktuellen Buch „Are we all scientific experts now?“.
Müssen wir? Und ist die Frage nicht eher: Können wir?
In Wissenschaftssoziologie und anderen Feldern der Science Studies gibt es schon länger Debatten über Formen der Beteiligung an Wissensproduktion, die sich auch um eine potenzielle Aufweichung des Expertenbegriffs drehen: Haben zu Fragen des täglichen Lebens nicht alle Menschen etwas beizutragen? Fließt nicht in vielen Feldern Know-how aus der Praxis in die Wissenschaft ein und sollte die Zusammenarbeit hier nicht enger sein?
Harry Collins: Es ist nicht alles Expertise
Collins schärft hier etwas nach. In seinem aktuellen Buch arbeitet er eine Expertisen-Matrix aus, die helfen soll, verschiedene Formen von Expertise zu schärfen und zu klären, welche wo angewendet werden können.
Die allgemeinste Ebene von Expertise ist ubiquitous expertise. Hier haben wir etwas gründlich gelernt – es verschafft und aber keine besonderen Fähigkeiten. Gehen gehört dazu, das Sprechen der Muttersprache, oder die Fähigkeit, sich anhand von Straßennamen und -nummern in einem Ort zu orientieren.
Specialist expertise beschäftigt sich mit speziellen Formen des Wissens. Im Idealfall ist specialist expertise die Form von Wissen über ein spezifisches Themengebiet, die wir nicht nur lernen, sondern auch freihändig anwenden können, um dieses Themengebiet zu erweitern. Allerdings wirkt es auch wie specialist expertise wenn jemand wissenschaftliche Quellen liest, ohne sie einordnen und interpretieren zu können. Deshalb unterscheidet Collins hier noch einmal zwischen verschiedenen Formen allgegenwärtiger (ubiquitous) specialist expertise und der specialist expertise jener, die über ein wissenschaftliches Thema diskutieren oder etwas sinnvolles beitragen können.
Meta expertise als dritte Form richtet sich weniger auf Sach- und Fachwissen, hier zählen etwa soziale Kriterien, die es uns erlauben, zwischen ehrlichen und verlogenen Politikern oder Verkäufern zu unterscheiden.
Die letzte und gefährlichste Form von Expertise bezeichnet Collins als default expertise. Das ist die Einstellung, die Abstufungen innerhalb dieser Formen von Expertise oder Nuancen der specialist expertise ignoriert und davon ausgeht, dass wir ohnehin alle den gleichen Verstand haben und mit Hausverstand bei auch den komplexesten wissenschaftlichen Fragen mitreden können. Das ist die Expertise jener, die an YouTube-Universitäten promoviert haben, von Dr. Google beraten werden und Insider-Information aus Telegramm-Channels beziehen.
Zurück zu Expertise-Idealen – geht das?
Schlüssig, aber wie weit hilft das der Wissenschaft? Hier muss Collins seine bislang analytische Perspektive verlassen. Es gebe keinen anderen Weg, als Wissenschaft und WissenschaftlerInnen für ihr Ideal zu respektieren. WissenschaftlerInnen als Nerds auf der Suche nach der bestmöglichen Wahrheit oder der wahrscheinlichsten Theorie, die nur vorsichtig Schlüsse ziehen und mit Empfehlungen und Entscheidungen zurückhaltend umgehend, sind nicht diejenigen, die griffige Positionen formulieren.
Relevante Kulturtechniken, mit denen man sich schnell Reichweite, Beachtung und Aufmerksamkeit verschafft, gehören nicht zum wissenschaftlichen Standardrepertoire. Wahrheiten werden von jenen bestimmt, die Macht haben, ihre Ideen zu verbreiten oder die die griffigste Medienstory erzählen – Collins beschreibt das als unerwünschte Zukunftsvision. Der zeitgeist müsse sich ändern, wenn wir unsere Gesellschaft bewahren wollten, wir müssten einfacher Wissenschaft (wieder) einen größeren Stellenwert einräumen.
Zurück in den Elfenbeinturm?
Ist das die richtige Perspektive? Ist das eine Perspektive, die man überhaupt noch einnehmen kann? Ist nicht der Zug schon längst abgefahren, haben sich nicht schon lang neue Kulturtechniken etabliert, für die Wissen irrelevant ist?
Und das war lange Zeit ein Versprechen: Wir müssen nichts mehr wissen, wenn wir wissen, wo wir nachschlagen können. Wir brauchen nicht mehr warten, bis wir gefragt werden oder bis jemand unser Anliegen interessant findet, wir können uns selbst Gehör verschaffen. Wir können an etablierten Kommunikation- und Publikationskanälen vorbeipublizieren. Wir können Unmengen an frei verfügbarem Wissen konsumieren – und es verarbeiten, wie es zu unseren Interessen passt.
Wir haben Techniken zur Außenwirkung perfektioniert – das entbindet uns von der Notwendigkeit, an Inhalten zu arbeiten. Wer mehr macht, als sich verkaufen lässt, ist selber schuld.
Der Weg zurück, den Collins vorschlägt, ist verlockend. Es ist auch plausibel, dass viel Kritik an der Wissenschaft darauf zurückzuführen ist, dass Wissenschaft oft langweilig, platt und mit Fehlern behaftet ist. Das liegt in der Natur der Wissenschaft, die erst Wissen schaffen möchte und nicht vorgibt, schon alles zu wissen. Das verstärkt den Eindruck, dass auch hier nur mit Wasser gekocht wird und dass ohnehin alle mitreden können. Das Problem mit der Zukunft ist allerdings, dass Rückschritte nie verlockend sind, dass der Weg zurück in bessere Zeiten praktisch kaum funktioniert. Alternative und stellenweise radikalere Ansätze, die Wissenschaft weiter öffnen, waren bislang auch wenig erfolgreich darin, der Wissenschaft Respekt oder auch nur Luft zum Reden zu verschaffen. Deren Proponenten wie Bruno Latour haben offenbar auch ein weit weniger ideales Bild von WissenschaftlerInnen – für Latour ist das, was Collins als Deformation diagnostiziert, untrennbarer Bestandteil des Wissenschaftsbetriebs.
Wichtigste Expertise: was auch immer der Beachtung dient …
So lang wir alle berühmt werden wollen und uns gegenseitig den Eindruck vermitteln, dass wir auch auf einem guten Weg dorthin sind, wird das nichts werden mit dem Rückzug zu idealen und an Ruhm, Erfolg und Vorteil desinteressierten WissenschaftlerInnenwerten (dazu habe ich anderswo schon einiges geschrieben).
Die vielversprechendste Gegenbewegung sehe ich in dem Trend, dass jene Beliebigkeit, der Lärm, das direkte Feedback, das schnelle Aufeinanderprallen haltloser Meinungen zunehmend jenen auf die Nerven gehen, die bislang am meisten davon profitiert haben. JournalistInnen, Twitter-AktivistInnen, ExpertInnen für eh alles, die die Kulturtechnik des Behauptens perfektioniert haben, sind dann auch nicht mehr ganz zufrieden damit, nur eine von vielen gleichwertigen Stimmen zu sein, die problemlos übertönt werden kann. Es sind also alle unzufrieden. Wohin das führt, das wird sich noch zeigen.