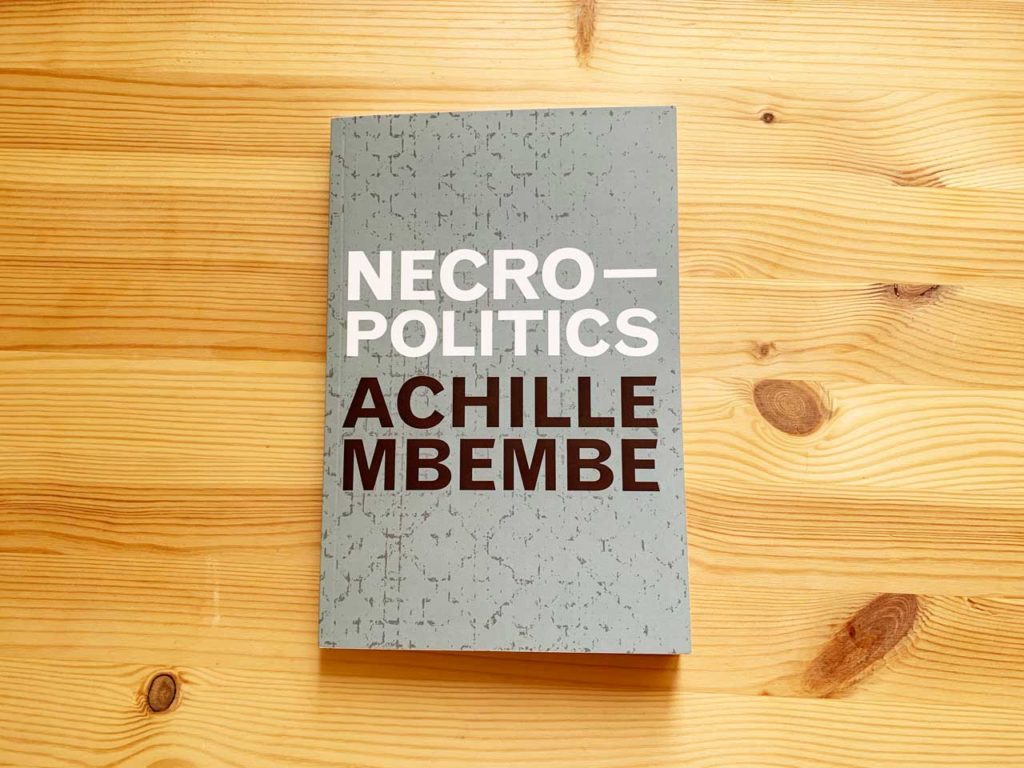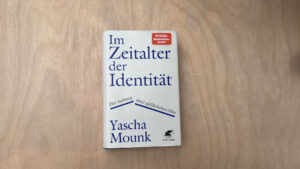Macht bestimmt darüber, wer lebt und wer nicht. – Lebensbedingungen im buchstäblichen Sinn zu gestalten, nicht nur soziale Bedingungen, sondern die Möglichkeit biologischen Lebens, darin kulminiert Politik. Das ist eine der Kernthesen von Achille Mbembes „Necropolitics“, und es könnte eine der Kernfragen unsere Zeit sein, in der die Politik der Pandemie so tief und so offensichtlich wie selten in Lebensmöglichkeiten eingreift. So ausdrücklich hat Politik in den vergangenen 50 Jahren noch selten mitbestimmt, wer wo wie leben – buchstäblich am Leben bleiben – kann.
Es kam allerdings anders: Weil Mbembe Israel als plakatives Beispiel für ausgeübte Biopolitik anführt, weil Israel in seiner Politik gegenüber Gaza viel weiter in Lebensmöglichkeiten eingreift als wir das von Politik gewohnt sind, sah sich Mbembe vor allem in Deutschland mit Vorwürfen des Antisemitismus konfrontiert.
Diese Unterstellungen sind haltlos. Sie zeugen von einem tiefgreifenden Unverständnis gegenüber dem, was Mbembe eigentlich herausarbeiten möchte. Sie lassen sich auch nicht über Umwege oder über latenten oder in Kauf genommenen Antisemitismus erhärten. Wo die Entstehung der Vorwürfe anhand einzelner herausgegriffener Zitate noch annähernd erahnt werden kann, werden sie bei der Lektüre des gesamten Texts vollkommen haltlos.
Worum geht es dann in Mbembes Essay?
Mbembe sucht nach zeitgemäßen Grundlagen von Demokratie und Freiheit. Zeitgemäß, weil beides, Demokratie und Freiheit, nicht mehr so selbstverständlich ist. Und weil beides für einen großen Teil der Welt nie selbstverständlich war. Mbembe knüpft in seinen Überlegungen vor allem an Foucault und Fanon an. Foucault brachte den Begriff der Biopolitik auf und beschäftigte sich mit der Effizienz von Macht, Frantz Fanon ist einer der deklariertesten Kritiker und Erklärer kolonialer Macht und antikolonialer Perspektiven. Letzteres brachte Mbembe zusätzlich zur Unterstellung des Antisemitismus auch noch den Vorwurf ein, als intellektuelles One-Trick-Pony alles mit den Folgen kolonialer Gewalt erklären zu wollen.
Auch Letzteres stimmt nicht nur nicht, es wäre für den Großteil der Weltbevölkerung auch eine legitime Perspektive.
Demokratie der Spezies
Aber der Reihe nach. Macht hat mit Gewalt zu tun, das bildet Demokratie keine Ausnahme. Demokratie legitimiert, wo Gewaltausübung stattfinden kann. Und weil – aus philosophischer und aus banaler Perspektive, Gesetz nicht mit Gesetz legitimiert werden kann (auch wenn Rangordnungen zwischen unterschiedlichen Normen dafür sorgen, dass Bürokratie und Justiz funktionieren), werden letztlich diverse, oft ins Mystische abgleitende Begründungen herangezogen. Diese Begründungen funktionieren in Kolonien weniger, sie prallen dort auf andere Mythen und sie sind nicht aus kulturellem Vorverständnis heraus erklärbar. Das ist ein Grund, warum in Kolonien der Weg zur Gewalt kürzer war: Die da kennen unsere Regeln nicht, also gelten sie auch nicht für sie.
Wie, und das ist die zentrale Frage in Mbembes Essay, lassen sich dann Regeln für eine globale Demokratie schaffen? Mbembe nennt das eine Demokratie der Spezies, die für alle Menschen funktionieren kann.
Die Anderen bleiben draußen
Eine wesentliche Voraussetzung dafür sind die Möglichkeiten des Begegnen und Verstehens. Mbembe sucht Situationen der Begegnung, in denen andere nicht nur zum Objekt gewordene Andere sind – oder in denen zumindest klar ist, dass sie die Anderen sind, von denen wir nichts wissen (und umgekehrt). Für solche Begegnungen, vor allem für die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin, für die Hürden, die dem vielleicht hartnäckig im Weg stehen, sind koloniale Fantasien natürlich ausgiebiger Stoff. Man fürchtet sich voreinander, man hat kein Bild vom anderen, andere sind Objekt, Rohstoff, Ware, sie sind Fläche für Phantasien, oft bedrohlich, jedenfalls ganz anders Das andere, das andere Denker über psychoanalytische Umwege festzumachen versuchen, ist bei Mbembe der N* (vor allem in seiner Kritik der Schwarzen Vernunft hält er hartnäckig an diesem Begriff fest). Der N* ist nicht durch Hautfarbe oder Herkunft bestimmt, er ist das ganz andere, das sich den üblichen Kategorien entzieht, auch wenn es vielleicht genau nach diesen erfasst werden möchte. Je mehr etwas unfassbar anders ist, desto stärker ist das Bestreben, es zu erfassen und zu regulieren, desto mehr konzentrieren sich jene, die es regulieren möchten, auf das Erfassbare, desto wichtiger werden Biopolitik und Nekropolitik in ihrer einfachsten, auf den Körper ausgerichteten Form.
Mbembe umkreist seine Themen in mehreren auch unabhängig voneinander lesbaren Kapiteln. Manche beschäftigen sich eher mit Demokratie, Freiheit und kolonialen Perspektiven, andere auch mit sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, andere verfolgen Spuren der Rechtfertigung von Gewalt weiter. In all diesen Linien steht für Mbembe die Frage nach dem Umgang mit dem Anderen im Vordergrund. Das Andere, das können Menschen sein (das sind die Passagen, in denen Kritiker dann Kolonialismus als Universalkeule sehen), das können Fragen sein, auf die wir keine Antwort wissen, oder auch ungeklärte Gründe. Mbembe diagnostiziert dabei auch einen gewissen Hang zum Anderen. Das Andere ist nicht immer nur bedrohlich, es ist auch praktisch – gerade seiner Bedrohlichkeit wegen. Es ist ein Argument, es ist ein Grund, es ersetzt letzte Gründe. In einem der Kapitel etwa stellt Mbembe Parallelen zwischen Animismus und Kapitalismus fest: Werden sie infrage gestellt, ziehen sich beide auf mysteriöse Mächte zurück, die im Hintergrund wirken, die keine Gegenwehr und keine Gegenargumente dulden und Zusammenhänge herstellen und erklären. In einem anderen Kapitel beschäftigt er sich mit dem Umgang mit Andersartigkeit, mit dem Bedürfnis nach Lösungen im Umgang mit dem Anderen, die auch schnell auf Sehnsucht nach großen Entscheidungen hinausläuft. Das ist das Thema populistischer Politik, die klare und eindeutige Lösungen verspricht – und die Symbolfigur jener, die sich große und endgültige Entscheidungen wünschen, ist der Selbstmordattentäter, der Entscheidungen und ihre Endgültigkeit auf die Spitze treibt.
Ethik des Passanten
Ist das lösbar, lassen sich Verbindungen und ein Boden für gemeinsame Entscheidungen finden, wenn die Beschäftigung mit dem Anderen derart im Mittelpunkt steht? Im letzten Kapitel stellt Mbembe knapp auf wenigen Seiten das Konzept einer Ethik des Passanten vor. Passant ist in diese Fall eine Figur, die vorübergeht, manchmal stehenbleibt und sich einmischt, manchmal solidarisch ist, manchmal losgelöst, manchmal nah dabei oder doch auf Distanz, „aber niemals gleichgültig“. – Das lässt sich als Beschreibung ebenso lesen wie als Aufruf, als Problem ebenso wie als Lösung. Und das ist einer der Kritikpunkte an Mbembe, die ich gelten lassen würde: Die Feststellung des Anderen allein bringt uns nicht weiter. – Aber sie ist trotzdem so lange wichtig, solange es für einige neu ist, dass es das Andere oder die Anderen gibt, ebenso wie uns selbst.