 Ich habe vom Digital Media Day vor allem eins mitgenommen: Es kristallisiert sich tatsächlich ein gewisser Trend zu konvergenten Meinungen heraus. Das ist sehr vorsichtig formuliert und mag auch immer noch an meinem generell integrativen Approach liegen, aber in meinen Augen hatten die meisten Referenten, mich eingeschlossen, eine recht konkrete Vorstellung hinter ihren auf diverse Schwerpunkte ausgerichteten Ausführungen:
Ich habe vom Digital Media Day vor allem eins mitgenommen: Es kristallisiert sich tatsächlich ein gewisser Trend zu konvergenten Meinungen heraus. Das ist sehr vorsichtig formuliert und mag auch immer noch an meinem generell integrativen Approach liegen, aber in meinen Augen hatten die meisten Referenten, mich eingeschlossen, eine recht konkrete Vorstellung hinter ihren auf diverse Schwerpunkte ausgerichteten Ausführungen:
Diese Vorstellung handelt von Systemen, Universen, Sümpfen – wie auch immer man das nennen möchte. Heisst: Spass und Sex alleine reichen im Medienbusiness auch nicht mehr, Exklusivität, Aktualität, alles, was ein einzelkämpferischer Verlag – sei er auch noch so groß – gegen den Rest der Welt bieten kann, ist Schnee von gestern und kein Diversifizierungsmerkmal mehr. Es ist schon gar nicht etwas, wofür bezahlt werden wird.
Die erfolgreichen Businessmodelle der Gegenwart sind nicht nur Apple, sondern auch Nespresso. Beide werben mit schönen Maschinen – und einem sehr vereinnahmenden Sumpf. Warum kaufen wir praktisch portionierten Verpackungsmüll rund um ein paar überteuerte Gramm Kaffee? Weil wir die Garantie haben, dass das System mit deppensicherem Input zu kontrolliert konstanten Ergebnissen – gutem Kaffee – führt.
Einschliessen alleine reicht nicht, das Universum (System, Sumpf) muss dem User helfen, ein Problem zu lösen oder einen Task zu erfüllen. Vervollständigen statt Ausschliessen ist die Devise. Für die vielschichtige Darstellung dieser Zusammenhänge bin ich noch immer ein Fan von Umair Haque.
Apple und Nespresso kontrollieren die Userexperience; wer mitmachen will, hat wenig Auswahl. Dennoch – oder gerade deswegen – fliesst Geld. Die Ergebnisse sind klar, der Nutzen ist klar, der Bedarf wurde geschaffen.
Das Pendant dazu gibt es im Medienbusiness noch kaum. Nur solcherart nachvollziehbarer Nutzen, zumindest habe ich das so mitgenommen, wird aber User dazu bewegen, Medien überhaupt einmal zu verwenden, und dann vielleicht auch noch dafür zu bezahlen.
Nutzen, und das ist im Mediengeschäft vielleicht neu, hat nicht nur mit Inhalten zu tun. Nutzen hat auch eine funktionale Komponente. Was kann ich mit den Informationen, mit den Inhalten machen?
Tablets gelten als große Hoffnung – eventuell, weil sie noch derart stark mit Klischees behaftet sind, dass allein die Nutzung eines Tablets schon als Nutzen erscheint: Nachrichten anytime on demand online lesen? Ist ein alter Hut. Mobil über leistungsstarke Laptops kommunizieren und konsumieren? Was man dafür alles schleppen muss. Aber mit leichtgewichtigen Tablets ausgerüstet in bequemer Couchposition Inhalte lesen, Videos ansehen und Mails verschicken? Nüchtern betrachtet nutzlos, aber sexy.
Das reicht noch nicht ganz, um die gewinnbringende Medienzukunft zu sichern, aber – erstes Geld fliesst. Oft zur Überraschung der kostenpflichtige Apps anbietenden Verlage selbst. Teilweise, scheint mir, greifen dabei dann auch immer wieder Verkaufs-Argumente, die schon bei der ersten Generation von Onlinemedien Mitte der Neunziger gezogen haben: Wir vermeiden Papier und Abfall (vor allem bei kurzlebigen Produkten), wir können auch im Ausland heimische Medien lesen, …
Und vielleicht führt dieses Sich-Einlassen auf komplexere Technologien in der Verbindung mit konkreten Lebenssituationen und Ansprüchen dazu, neue Medien und deren Businessmodelle in genau diesem Spannungsfeld zu suchen: Wie schaffen sie konkret verwertbaren Nutzen, der sich meinem Leben anpasst, flüssige und sinnvolle Technologien einsetzt, und – ja, das auch noch – nützliche und interessante Inhalte liefert.
Zumindest würde ich in dieser Richtung suchen.
Noch eins ist mir aufgefallen, einerseits beim DMD, andererseits beim gedanklichen Aufräumen danach: Jedes Land hat die Medien, die es verdient. Alter Hut. Wir haben die Medien, für die wir bezahlen, hat unlängst auch Seth Godin geschrieben. In Österreich kehrt Oberbasher Staberl aus der Pension zurück.
Dazu kommen auch die Blogger, die wir verdienen. Berühmt sind grenzcharmante Raunzer, aus dem Vollen schöpfen die, die mit Verve andere attackieren und hinlänglich bekannte Schwächen zelebrieren. Die real konstruktiven Visionäre der nahen Zukunft nehmen sich dagegen aus wie stotternde Schulkinder, wenn man sich nicht die Mühe macht, ihren Gedanken zu folgen.
Ist so. Ist nicht unbedingt gut so. Aber wir sind ja im Showgeschäft.


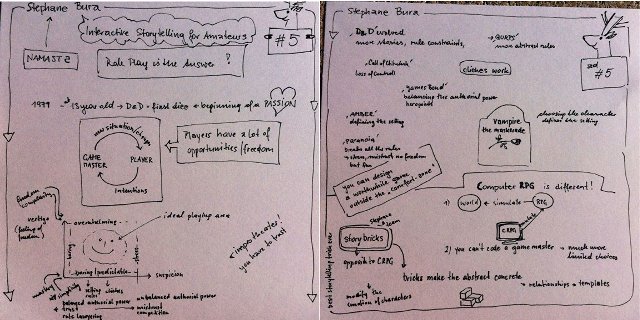



 Ich habe vom
Ich habe vom