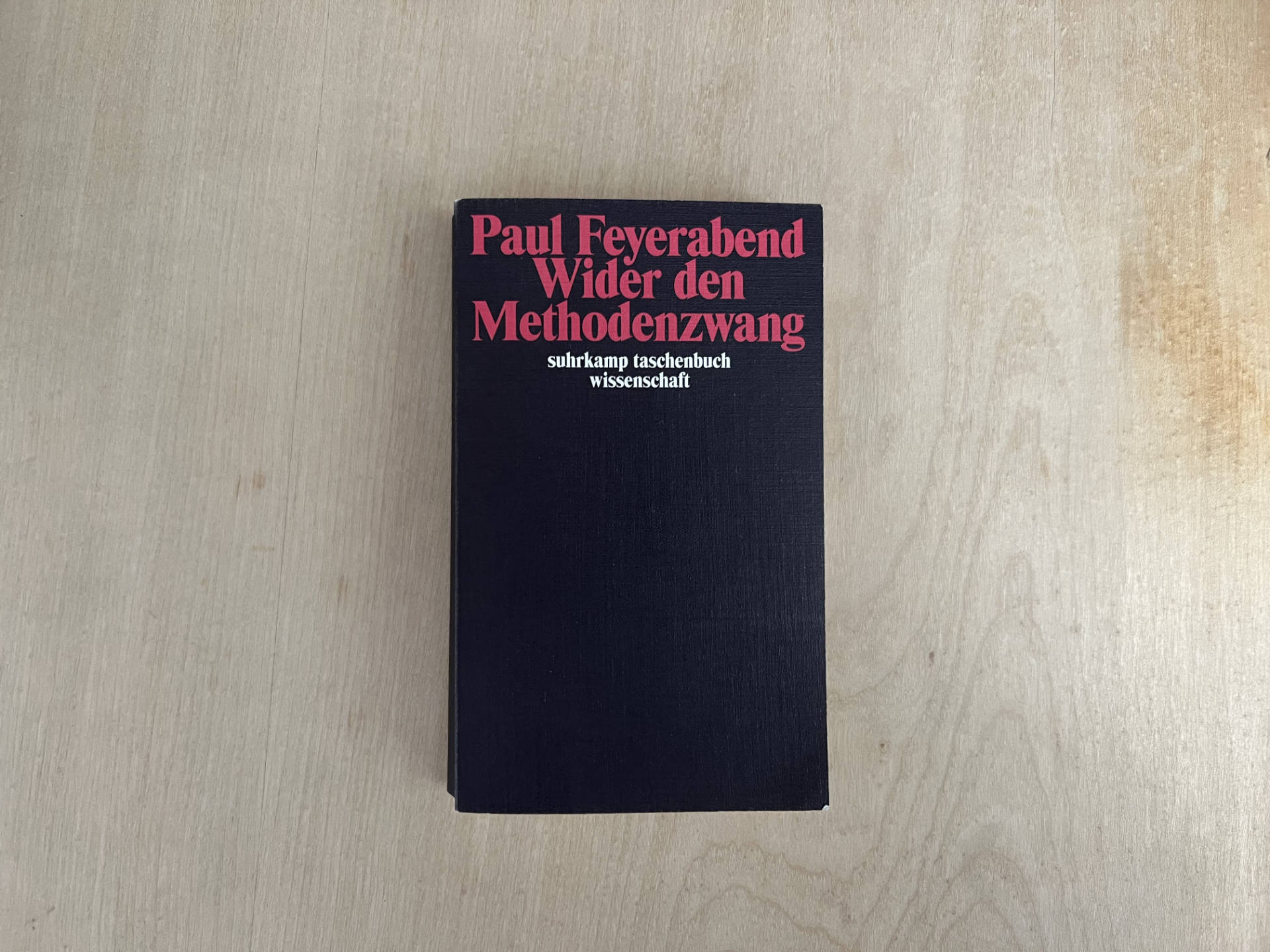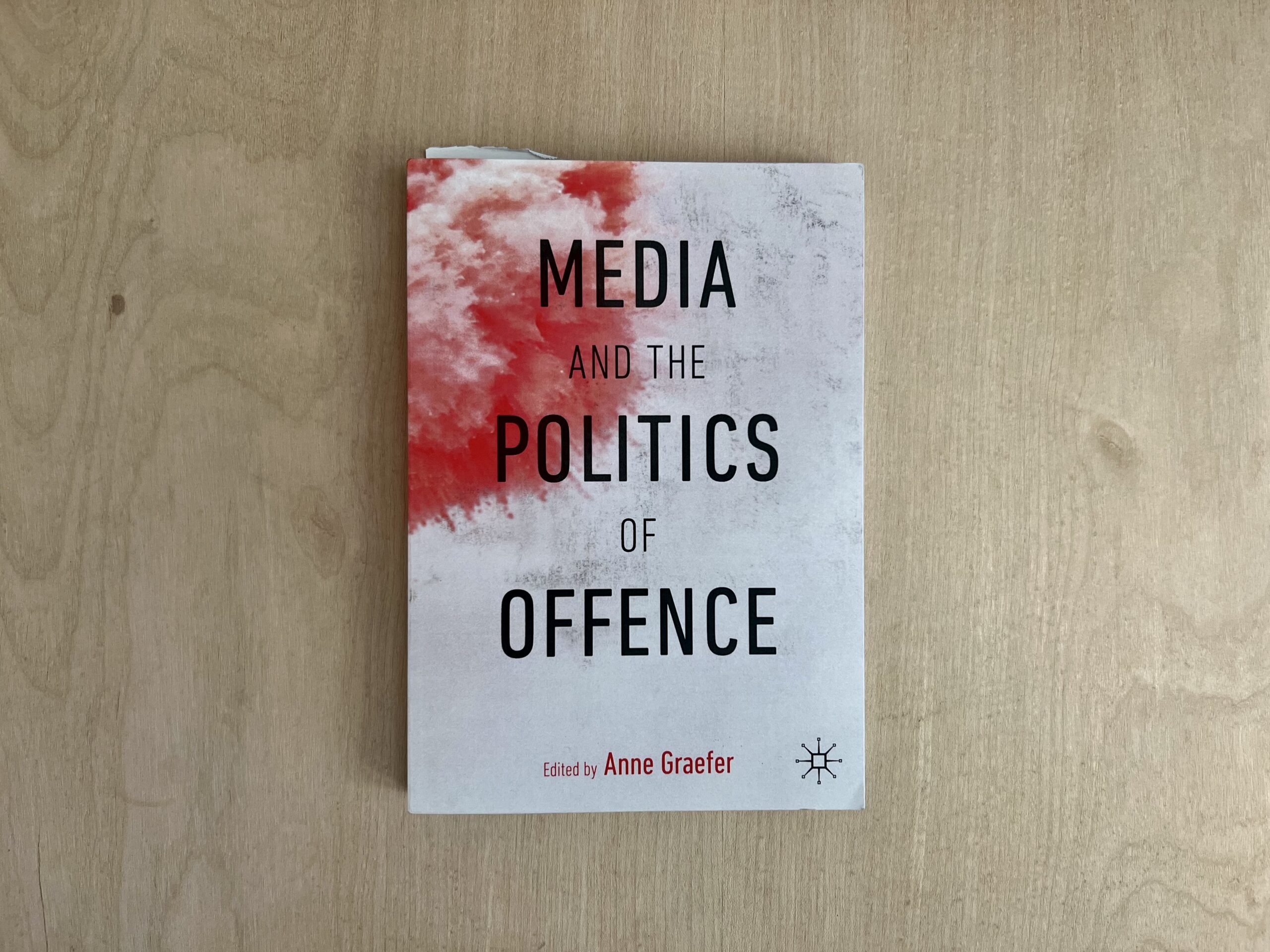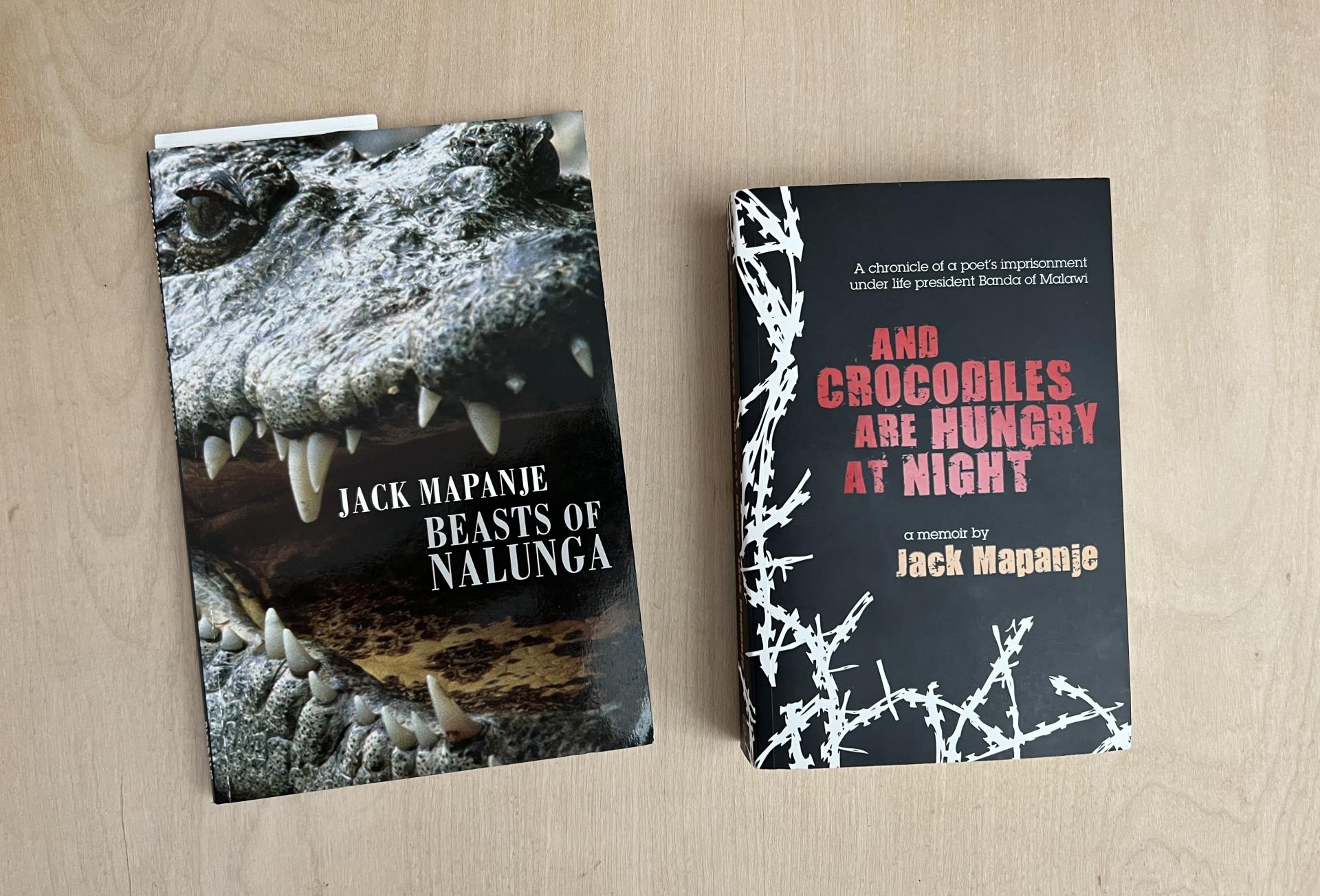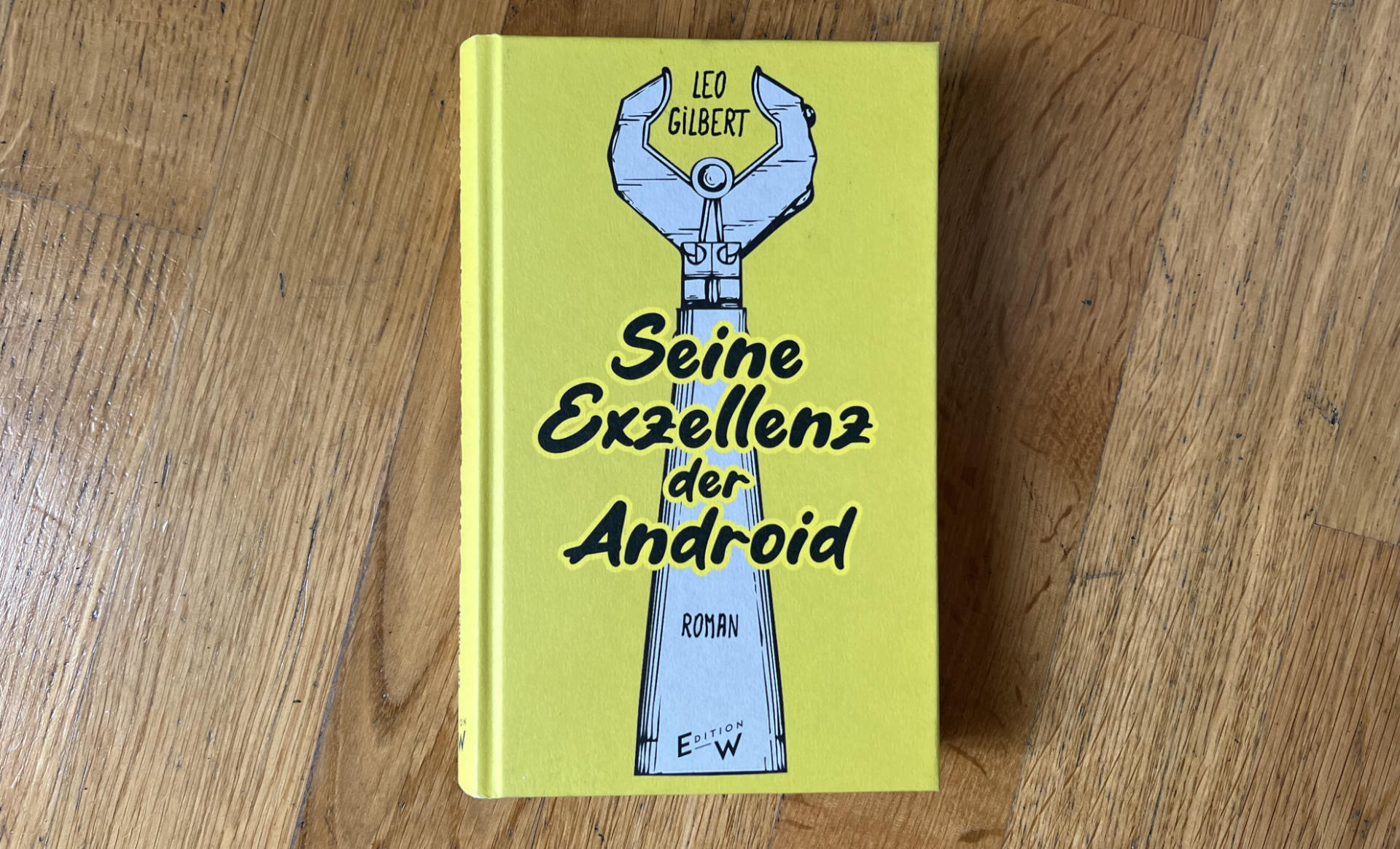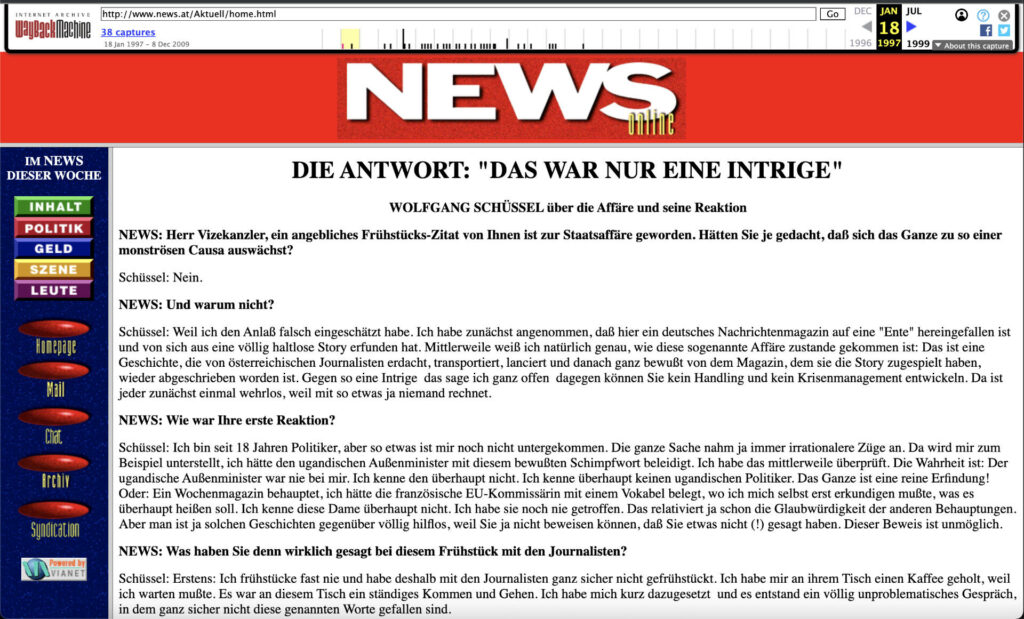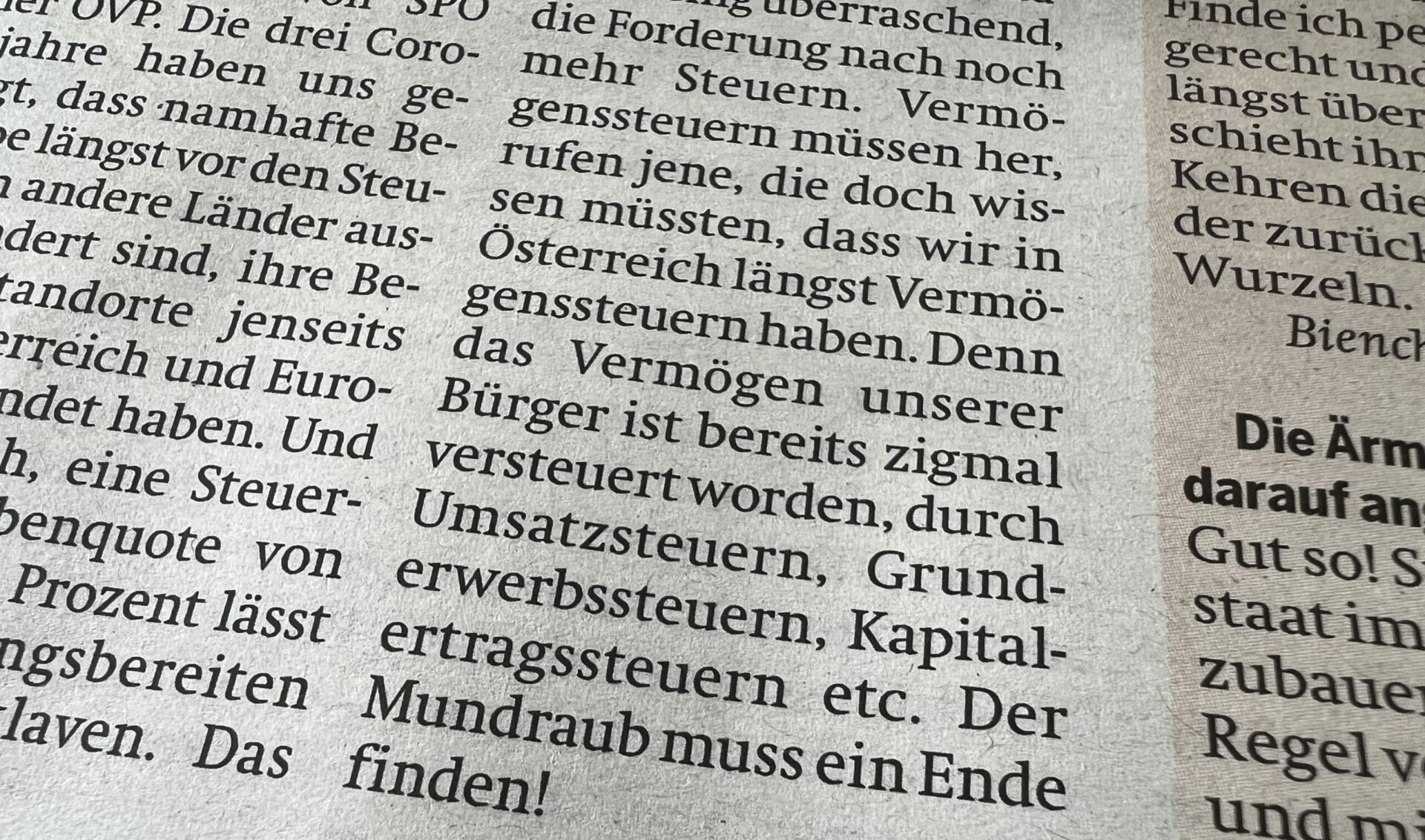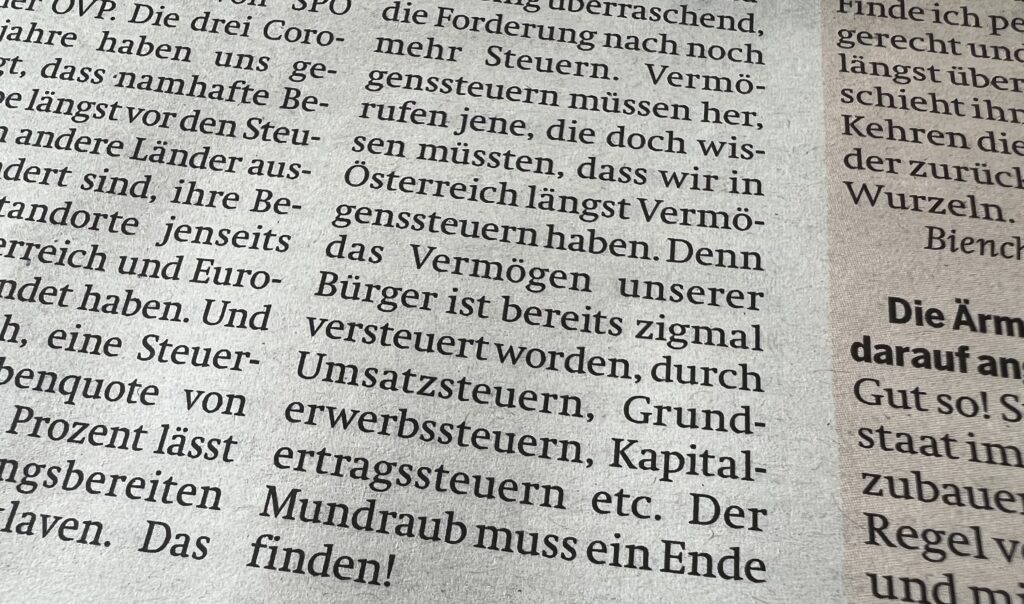Feyerabend wehrt sich gegen eines der ihm am häufigsten zugeschriebenen Zitate, lustiger weise schon bevor es ihm noch flächendeckend zugeschrieben werden konnte: Er distanziert sich von “anything goes”. Das sei die Diagnose zur Bewertung unterschiedlicher konkurrierende Theorien, kein Aufruf, jegliche Methode über Bord zu werfen.
Feyerabends Text ist weniger Programmatik als eine detaillierte Analyse der großen Wendungen in der Astronomie. Wie konnte sich ein heliozentrisches Weltbild durchsetzen; hätte Galilei mit als heute wissenschaftlich anerkannten Methoden seine Beobachtungen etablieren können? Eine der zentralen Rahmenbedingungen traditioneller Wissenschaft hätte das verhindert. Die Konsistenzbedingung verlangt, dass neue Forschung mit anerkannten Theorien übereinstimmen müsse – das rettet alte Theorien und verhindert neue. Ähnliche Schwierigkeiten in der Erkenntnis und Bewertung von Neuem haben Carnap und Bar Hillel in ihrem Informationsparadoxon formuliert. Für Feyerabend ist das eine der großen Hürden beim Versuch, neues durchzusetzen.
Eine zweite Hürde bauen sogenannte natürliche Interpretationen auf. Das sind Annahmen und Vorurteile, die so etabliert sind, dass sie unhinterfragt angewendet werden. Sie nehmen aber nicht nur Zusammenhänge vorweg, deren Erkenntnis auch neu hergeleitet werden könnte, sie beruhen auch auf einem Gerüst von Annahmen und Voraussetzungen, die viel weitreichendere Bedingungen mit sich bringen. Interpretationen funktionieren nur vor einem ganzen Horizont von Gerüsten und Vorentscheidungen – und es ist auch nicht möglich, hinter diese Gerüste und Vorentscheidungen zu kommen.
Feyerabend kritisiert Bacon und dessen Vorstellung, mit wissenschaftlicher Analyse den Schleier dieser Vorentscheidungen lüften zu können. Eine modernere Anwendung dieser Kritik ist die Skepsis gegenüber dem Glauben, Bias in Algorithmen und Data Science Methoden beseitigen zu können. Gerade weil Bias nicht eliminiert werden kann und weil der Schleier nicht entfernt werden kann, gilt “anything goes” – als neutrale und beobachtende Diagnose, nicht als auffordernde Programmatik.
Kritik und die Hervorhebung von natürlichen Interpretationen führen zu neuen natürlichen Interpretationen, die ihrerseits wieder durch Gewohnheit versteckt werden. Dem liegen Entscheidungen zugrunde – und diese Abläufe wiederum erinnern an Dewey und dessen Beharren darauf, dass stets, in jedem Forschungs- und Erkenntnisschritt, Entscheidungen notwendig sind. Allerdings, meint Dewey, gebe es eben manche Entscheidungen, die das Bewusstsein betäuben, dass Entscheidungen getroffen wurden.
Welchen Regeln folgen wissenschaftliche Entscheidungen? Für Feyerabend sind es keine wissenschaftlichen Regeln; Entscheidungen zwischen konkurrierenden Theorien werden mit Propaganda und psychologischen Tricks herbeigeführt. Feyerabend diskutiert das wieder an Galilei; Harry Collins lieferte – meines Wissens ohne auf Feyerabend zu verweisen – in seiner Diskussion der Wieder- bzw. Nichtentdeckung von Gravitationswellen einen Beleg dafür, wie sehr psychologische Tricks hochwissenschaftliche Konkurrenzen entscheiden.
In Collins Beispiel waren es Konkurrenz und Macht, die Tricks auf den Plan riefen, für Feyerabend sind es auch Inkommensurabilitäten zwischen verschiedenen Kosmologien. Es gibt nicht immer eine Basis, auf der man sich überhaupt verständigen könnte.
Theorien werden über Interpretationen entschieden, weniger über Fakten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Fakten uns für Feyerabend auch eher in Interpretationen begegnen. Zuletzt verweist er auf seine Dissertation, in der er sich auf die Suche nach dem “Gegebenen” machte und zu dem Entschluss kam: “Das ‘Gegebene’ ist phänomenologisch nicht auffindbar.”
Nicht zuletzt deshalb lese ich Feyerabends Methodenkritik heute auch als Kritik an neu eingeforderter Wissenschaftsorientierung, an Technikgläubigkeit und and der Überschätzung von Daten als neue Orientierung gebende Universalmythologie einer spätmodernen Welt. Nichts davon – Wissenschaft, Technik, Daten – funktioniert per se und ohne sich auf ein Beziehungsgeflecht zu stützen, dessen Wurzeln mitunter weit entfernt von ihren eigenen sachlich neutralen Ansprüchen sind. Vieles davon stützt sich auf Voraussetzungen, die es eigentlich ablehnt. Darauf hinzuweisen, das ist die Essenz von “anything goes”.