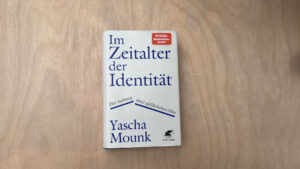Walking Dead ist schon länger uninteressant. Die Dichte an Negans und Lucilles hat unter den CosplayerInnen auch deutlich abgenommen, der Superbösewicht und sein stacheldrahtumwickelter Baseballschläger laufen kaum noch auf Cons herum.
Trotzdem redet man wieder oft von Zombies. Diesmal verdanken wir das nicht Nerds und Comics, sondern ÖkonomInnen und allen, die sich dafür halten. Sie werfen UnternehmerInnen, die jetzt in der Krise Unterstützungsuchen vor, Zombiekult zu betreiben: Sie seien nämlich darauf aus, etwas nicht mehr lebensfähiges mit aller Gewalt am Leben erhalten zu wollen. Geschäftsmodelle, die nun nicht mehr funktionieren, seien Untote, von denen man sich besser trennen solle.
Die Idee der Zombieconomy ist alt. Sie jetzt in der Krise wieder auszugraben, ist ein wenig riskant. Als erstes müssten wir ja dann Gastronomie, Hotellerie und jegliche Form von Zusammenkünften über Bord werfen. Alles ist dank Virus unangemessen und von Streetfood bis Streaming gibt es funktionierende Alternativkonzepte. Vielleicht hilft ja auch ein Blick zurück auf die Geschichte der Zombies. In der populär gewordenen Form tauchten Zombies zum ersten Mal in William Seabrooks „Magic Island“ auf, einem etwas fiktionalisierten Reisebericht über Haiti. Zombies waren scheinbar willenlose, leicht steuerbare Menschen, die am Rande der Gesellschaft existierten. Die rationalisierte Entstehung für ihren Zustand: Es waren Delinquenten, die zur Strafe und um sie unschädlich zu machen, mit Drogen und vielleicht ein wenig Magie in diesen Zustand versetzt worden waren.
Entgegen allen Vorstellungen von Gewalt und Blutrausch, die das moderne Zombiekonzept bestimmen, waren Zombies also eine Variante der Sicherheitsverwahrung, möglicherweise auch der Sklaverei – denn die frühen Zombies hatten auch Herren.
Vor diesem Hintergrund lässt sich ganz gut erklären, warum ich einen ganz anderen Blick auf Zombiezucht in der Wirtschaftspolitik habe. Förderprogramme wie wir sie kennen, sind in der Regel Werkzeuge zur Zombiezucht. Sie sind in der Regel zu spät und zu konkret. Eine öffentliche Institution hat einen Trend erkannt, beschrieben und in ein Programm gegossen. Das passiert im Nachhinein, Webb schon viele Unternehmen in dieser Schiene erfolgreich waren. Mit Förderungen werden dann viele weitere Unternehmen auf den gleichen Weg geschickt – auf dem sich dann schon einiges drängt. Förderbestimmungen und -quoten binden dann Energie und verhindern flexible Entwicklung. Bis Programme beschrieben und verabschiedet, Förderanträge geschrieben und genehmigt sind, hinken geförderte Projekte in der Regel ihrer Zeit zwei Jahre hinter.
Wäre es also besser, ganz auf Förderungen zu verzichten? Offene Programme, die mehr inhaltlichen Entscheidungsspielraum bei den Unternehmen lassen, wären ein Schritt. Förderungen, die auf lebensnahe und zeitgemäße Entscheidungen anwendbar wären, ebenso. Gerade in Krisenzeiten könnte es ja sinnvoll sein, mehr auf UnternehmerInnen, ihre Einschätzungen, Erfahrungen und Perspektiven zu achten. Die reflexartig heraufdräuenden Vorwürfe einer wiedererstarkenden Zombieconomy dagegen sind eher selbst Wiedergänger einer vergangenen Zeit – und selbst wenig mehr als Zombies. Umso mehr, als der Großteil der Förderungen hier eher Schadenersatz als Prämie sind.
Was Förderungen im übrigen nicht leisten und auch nicht leisten sollen, ist Absicherung. Soziale Absicherung ist ein Feld, auf dem sich besonders deutlich zeigt, wie unangemessen und unzeitgemäß politische Konzepte heute sind.