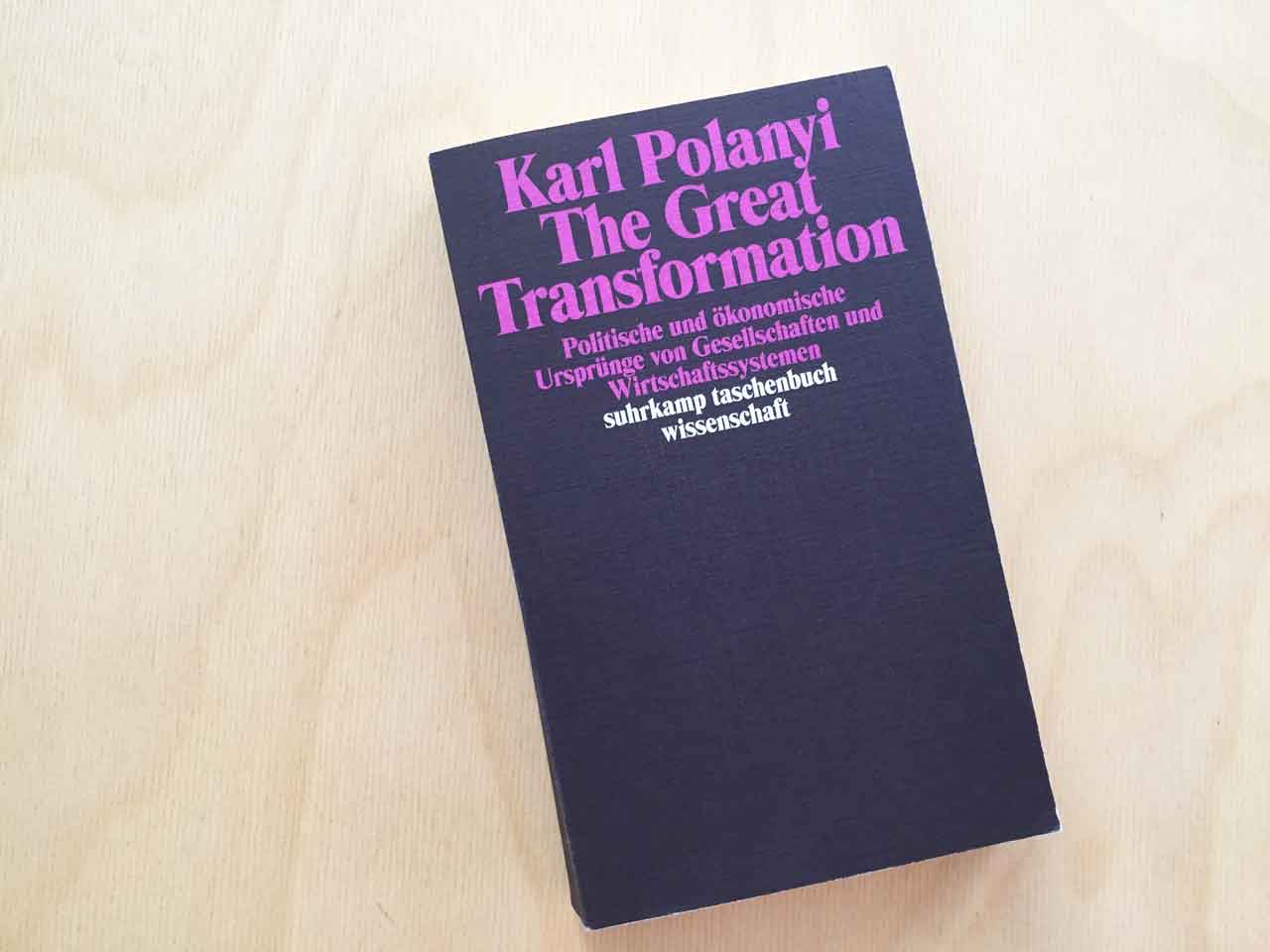Es ist auch ein Worst Case-Fall, ein Negativbeispiel für ein besserwisserisches, sektiererisches Elfenbeinturmbuch. Andererseits: An welches über siebzig Jahre alte Fachbuch stellt man noch den Anspruch, auf allen Ebenen auf der Höhe der Zeit zu sein?
Karl Polanyis „The Great Transformation“ erschien 1944, wurde schon damals eher skeptisch beäugt und verschwand dann recht bald in der Schublade jeder wissenschaftlichen Arbeiten, die man weder kennen noch verbreiten noch bekämpfen muss. In den vergangenen zwanzig Jahren allerdings erlebten Polanyis Theorien allerdings ein großes Revival. Ein Höhepunkt zwischendurch ist der Sammelband „Die große Regression“, in dem sich fast jeder Autor auf Polanyi beruft.
Worum geht es im Kern: Polanyi argumentiert, dass der Kapitalismus zwangsläufig Auflösungserscheinungen traditioneller Gesellschaftsformen mit sich bringe und damit den Boden für autoritäre Regime aufbereite. Dazu argumentiert er, dass der Handel keineswegs einem „Drang“ des Menschen entspringe oder entspreche (so wie frühkapitalistische Theorien argumentierten), sondern in soziale Strukturen eingebunden gewesen sei. Tausch und Handel waren für Polanyi ritualisierte Interaktionsformen, die überlieferten Regeln folgten und nicht auf individuelle Neigungen zurückzuführen seien. – Frühere Soziologen haben genau diese ritualisierten Tauschformen dann ja eher als irrationalen Gegenentwurf zum Kapitalismus interpretiert, als geradezu zerstörerische Verpflichtung: Die Stammesführer, die in Marcel Mauss’ „Die Gabe“ im Podlatch (der ritualisierten Tauschform) Güter austauschen, stehen einander in Mauss’ Interpretation in einem eher kriegerischen Verhältnis gegenüber, indem sie den anderen zu immer größeren Gegenleistungen verpflichten.
Polanyi sieht die Dinge anders. In seinem Drang, andere dumm aussteigen zu lassen, ergeht er sich in seitenlangen Anspielungen und Andeutungen über historische Fakten, Zusammenhänge und deren vermeintliche Fehlinterpretationen, die seine eigene Argumentation völlig in den Hintergrund treten lassen. Es ist dieser besserwisserische Tonfall, der fremde und vermeintlich schlechte Theorien lang ausführt, deren eigene Argumente gegen sie sprechen lassen möchte und dabei den Leser, der vielleicht nicht von vornherein Polanyis Standpunkt teilt, etwas ratlos zurücklässt.
Seine eigenen Fakten (oder deren Interpretation) erklärt Polanyi kaum – nicht weil sie nicht stimmten, sonder anscheinend ebenfalls aus einem starken akademischen Dünkel heraus. Es finden sich viele Formulierungen wie „es ist offensichtlich“, „es kann nicht sein“, „es liegt auf der Hand“ ,“man kann sich darauf einigen“, die seine Argumente eher in Frage stellen als sie zu stärken. Seine These von der Zerstörung traditioneller Gesellschaften durch die Marktwirtschaft mag nachvollziehbar sein, seine Argumente sind allerdings meist so universalistisch platt wie die jeder Totalitären gegen die er argumentieren möchte.
Besonders schlimm und entlarvend ist das, wenn Wissenschaftler mit dem gleichen Eifer in Fachgebieten wüten, in denen sie definitiv keine Expertise haben. Bei Polanyi sind das Afrika und der Kolonialismus. Beide zieht er im Vorbeigehen in wenige Absätzen heran, um seine These von der Zerstörung traditioneller Gesellschaften durch die Marktwirtschaft zu erhärten. Dass die Marktwirtschaft im kolonialen Afrika nur als Zerrbild in den letzten Ausläufern durch jene, die abstrahierte und unmenschliche Ziele durchsetzen musste, präsent war und nirgendwo sonst auf der Welt marktwirtschaftliche Ziele durch das Abhacken von Gliedmaßen befördert hat oder dass Sklaverei nicht gerade dem Idealbild des Tauschgeschäfts entspricht, übergeht Polanyi zugunsten seiner Theorie in einem Nebensatz. Allerdings waren es im Kolonialismus gerade diese direkten und blutigen Maßnahmen, die wohl um einiges mehr zur Zerstörung von Gesellschaften beigetragen haben, als das Aufkommen von Tauschgeschäften oder anderen Handelsbeziehungen.
Hier wird also deutlich, wie sehr Polanyi alles seiner Theorie unterordnen möchte.
Was bleibt dann und warum bewegt dieses Buch noch heute? Jeder Versuch der Erklärung totalitärer Strömungen ist heute wichtig und verlockend (auch wenn Zeitdokumente eher belegen, wie sehr und oft man sich dabei auf die letztlich falschen Momente konzentriert).
Polanyi beschreibt allerdings auch einige Grundsätze und historische Beobachtungen, die fast in Vergessenheit geraten sind und dennoch wichtige Leitbilder für aktuelle Diskussionen wären.
Eine dieser historischen Perioden, um die sich vieles in Planyis Buch dreht, sind die Speenhamland-Beschlüsse, die in England Ende des 18. Jahrhunderts zunehmende Armut bekämpfen sollten. Armut war damals auf den Rückgang der kleinteiligen Selbstversorger-Landwirtschaft zurückzuführen; Grundbesitzer wollten ihr Land effizienter und vor allem für Schafzucht nutzen – das kostete viele kleine Pächter ihre Existenzgrundlage.
Die Speenhamland-Beschlüsse waren eine Art Mindestsicherung, die vorsah: Sollte eine Arbeiter zu wenig verdienen, da musste sein Einkommen aus der Gemeindekasse aufgebessert werden. Diese schöne Vorstellung zur Vermeidung von Armut in schwierigen Zeiten führte dazu, dass Löhne ins Bodenlose fielen: Arbeitgeber mussten nichts mehr bieten, weil Arbeiter ohnehin die Aufzahlungen bekamen, Arbeiter mussten es sich drei Mal überlegen, ob sie als selbstständige Handwerker kleines Geld verdienen oder als landwirtschaftliche Arbeiter das garantierte Mindesteinkommen in Anspruch nehmen wollten, und ein fehlgeleitetes Fördersystem führte dazu, dass Arbeitgeber, die eine Mindestzahl an ohnehin schon geförderten Arbeitern beschäftigten, zusätzliche Förderungen erhielten, um die für ihren Aufwand zu entschädigen. Die Konsequenz waren die wirtschaftliche Stagnation der Arbeiter auf sehr niedrigem Niveau, schlechte Qualität der Arbeit, weil es keine Leistungsanreize gab, schlechte Arbeitsbedingungen, weil Arbeitgeber Arbeitskräfte gleichsam wie Zwangsarbeiter behandeln konnten, und ein Verfall landwirtschaftlichen und handwerklichen Wissens, weil sich die Mehrzahl der Arbeiter auf das Grundsicherungsmodell einließ.
Der Gegenentwurf einer Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat, wichtige Beiträge leistet und dafür geachtet wird, ist eine schöne Vision. Praktisch wurden die Speenhamland-Beschlüsse (die eigentlich nie als formelles landesweites Recht erlassen, aber trotzdem so betrachtet wurden), als man griffige Handhaben gegen revoltierende Arbeiter brauchte. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, als sich in Europa Arbeiterunruhen abzeichneten, kehrte in England so der Hunger als politisches Druckmittel zurück – teilweise als Liberalismus verbrämt, der die Freiheit des Menschen achtet und sie deshalb nicht entmündigen und ihrer Pflichten entheben möchte.
Polanyi landet auch immer wieder bei Liberalismus-Diskussionen. Für ihn ist der klassische Liberalismus ein vorrangig wirtschaftliches Konstrukt, dass die anderen Dimensionen von Freiheit und deren ethische Fragen gern mal außer acht lässt. Dieser Liberalismus, der es sich einfach macht und das Fehlen von Einschränkungen idealisiert, steht – und hier kann ich Polanyi wieder zustimmen – in einer gefährlichen Nähe zum Faschismus: In beiden Fällen werden Trugbilder idealisiert, beide Gegensätze nehmen in Kauf, das Unfreiheit zunimmt. Einmal geschieht das eben direkt durch Verbote, einmal durch Utopien, die übersehen, dass Freiheit, die nur für wenige gilt, oft vielen schadet.
Als eine Ideologie, die schlichte einseitige Maximen von Wachstum, Mehr, Fortschritt, Modernität und Freiheit als Fehlen von Einschränkungen predigt, kann Marktwirtschaft so gesehen tatsächlich zerstörerische Tendenzen haben.
Was genau dabei zerstört wird, dabei bin ich mit Polanyi weniger einer Meinung: Die bei ihm durchklingende Vision einer traditionelleren, wertebestimmten und christlichen Gesellschaft, die als Heilmittel wieder Halt und Orientierung gibt, unterscheidet sich nur graduell von den Visionen, die Faschisten und Totalitäre predigen. – Das kann aber auch wieder am Alter des Textes liegen.
Worauf man sich einigen kann: Die Wirklichkeit ist zu kompliziert und zu wichtig, um sie Politik, Medien und anderen Besserwissern zu überlassen. Es braucht persönliche Haltungen, Positionen, Orientierungen und Argumente. Fakten sind dabei wichtig. Aber ohne Moral wird es nicht gehen.