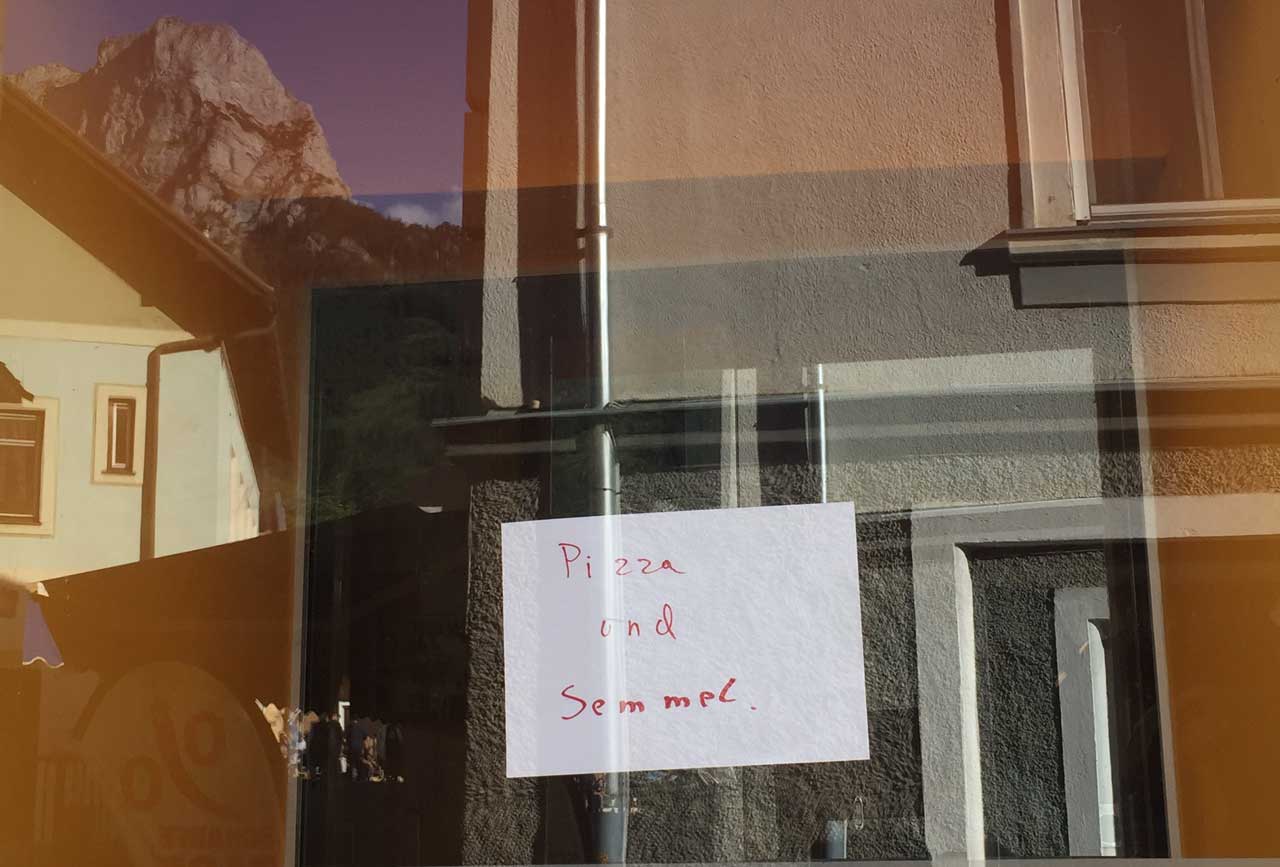Wer ist normaler, einfacher und hat das Herz am richtigeren Fleck? Vom rechteren Fleck reden wir mal noch nicht. Seit – spätestens mit Brexit und Trump – das „einfache Volk” zurückgeschlagen hat, rätseln Politiker_innen, was denn mit diesem los sei und wie sie es wieder für sich gewinnen könnten. Die einen inszenieren sich als Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich zwischen Kindergarten, Gute-Nacht-Lied und langen Familienwochenenden schnell noch ein wenig Zeit für Politik abknöpfen. Die anderen setzen auf die einfachen und niedrigen Tugenden, das heißt sie arbeiten vor allem mit Neid und Opfern – die Opfer sind abstrakte andere, die nicht zum Volk gehören. Wieder andere, die schon fast von der Bildfläche verschwunden sind, entdecken plötzlich den Hass als tolles Instrument für sich und möchten damit jenen das Wasser abgraben, sie sonst mit Neid arbeiten. Dann gibt es die diffusen Zukunftsprediger, die Inhalte möglichst vermeiden und gut damit fahren, solange die Lichtstimmung auf den Fotos nur schön genug ist und der Himmel wolkenfrei ist. Diese Typen und Strategien finden sich bei fast allen Gruppierungen bunt durchmischt in unterschiedlichen Gewichtungen. Und dann gibt es noch die, die anscheinend jeden Tag aufs Neue mit sich selbst um eine Positionierung ringen. Und dabei die eigenartigsten Kapriolen fabrizieren.
Bliebt doch lieber bei den Phrasen
Der Ablauf dabei ist in aller Regel ungefähr so: Jemand bringt eine neues Thema aufs Tapet und ist damit erfolgreich. Dieses Thema muss dann aufgegriffen, adaptiert und gekapert werden. Abschreiben war für viele Menschen jetzt immer schon eine erfolgversprechende Strategie, durchs Leben zu gehen. Dumm ist nur, wenn man das Abgeschriebene dann noch etwas erweitern und verbiegen muss, um es in eigene Positionen einfügen zu können.
Das österreichische Beispiel der Gegenwart dafür ist das Schnitzel: Im EU-Wahlkampf 2019 wurde es von der Volkspartei herangezogen, um gegen EU-Bonzen zu wettern, die auf mafiöse Weise heimische Koche beim Bräunegrad der Panier bevormunden wollten, so die Legende. Das konnten die Rechten von der FPÖ nicht auf sich sitzen lassen und setzten in der Vorphase des Nationalratswahlkampfs noch eins drauf: Schnitzel gehöre fix auf den Speiseplan von Kindergärten, man wolle sich schließlich nicht von muslimischen Schweinefleischskeptikern dreinreden lassen. Dass die Forderung fallweise mit dem Bild eines panierten Fischfilets statt eines Schnitzels illustriert wurde, ist eine nette Fußnote. Das hat Potential, dachten sich dann wohl auch andere Politiker_innen und machten aus dem heimischen Schnitzel ein Bollwerk gegen billige Fleischimporte “aus dem Ausland“ und für den Klimaschutz. Wieder andere witterten da aber sträflichen Elitarismus und Verrat am einfachen Volk: Das Schnitzel dürfe nicht zum teuren Statussymbol werden, es können nicht sein, dass ökologische Vernunft mit einem Preiszettel versehen werde. Einschränkungen kommen nicht infrage – das ist absurderweise ja wieder ein Argument, bei dem sich radikalere Linke mit viel Vision, aber wenig Plan, und Stockkonservative mit am Auto hängendem Traditionsbewusstsein und fest zugeknöpfter Geldbörse freundschaftlich die Hand reichen könnten.
Sozialdemokratie, neuerdings moralfrei
Ein Spannungsfeld wie geschaffen also für eine Partei, die ihr Programm sucht. Das ist in diesem Wahlkampf nicht etwa eine der kleineren Parteien – nein, die alte Dame SPÖ eiert tragischerweise personell und programmatisch am Rand des Abgrunds und nutzte daher folgerichtig die Chance auf den Sprung ins Frittierfett.
Erst verkündete die Parteichefin ihren Willen, das Schnitzel nicht zum Luxusobjekt verkommen zu lassen. Das wurde begrüsst, belächelt, als ernährungswissenschaftlich und klimakrisentechnisch problematisch diskutiert und schließlich auch als historisch unrichtig diagnostiziert. Zumindest in der Kindheitserinnerung österreichischer Twitterer war das Schnitzel immer Luxus (in meiner übrigens auch, wenn auch kein besonders wichtiger). Zeit also für das dialektische Schwergewicht Max Lercher, ehemaliger Geschäftsführer und heute Stimme eben jener Erdigen, um die man sich bemühen müsse, in einem epischen Facebook-Kommentar auszureiten. Anfangs berührt er darin viele aktuelle Diskussionspunkte zwischen Handelspolitik, Klimakrise und Tierschutz. An den Absichtserklärungen ist woe so oft in der Politik nichts falsch, weil sie auch nichts sagen. Die Absicht, Dinge zu verbessern, ist ehrenwert; die Details bleiben unausgesprochen – damit sie von jedem anders verstanden werden können. Ein Großteil politischer Texte könnte, so meine These, beliebig ausgetauscht und anderen Parteien untergeschoben werden, man würde es nicht merken. Das liegt weniger am Formulierungsgeschick der Autor_innen, als daran, dass man in den wenigsten Texten so weit kommt, konkret argumentieren zu müssen. Politische Texte befinden sich immer schon in einer Sphäre des Vorverständnisses. Wir haben Bilder von Parteien oder Politiker_innen, die den eigentlichen Sinn stiften und bestimmen, was wir verstehen. Das ist eine Folge der Markenbildung, die nicht nur für Politik gilt. Wir wundern uns allenfalls über Prioritäten (Warum redet gerade die/der gerade darüber?), die Bedeutung reimen wir uns schon irgendwo zurecht.
Jenseits der geschützten Werkstätten wird es gefährlich
Ein Problem wird das nur dann, wenn dieser geschützte Raum einmal verlassen werden muss. Dieses Bedürfnis verspürte offenbar auch Max Lercher am Ende seines Textes und lieferte damit ein schönes Beispiel für die absolute Verwirrung und Vernichtung einer Idee in wenigen Zeilen. Er möchte sich von der Moral verabschieden. Also nicht wirklich von der Moral, aber von der „Moral“ die man Klimakrisenwarner_innen, CO2-Steuer-Befürworter_innen oder Feminist_innen heute vorwirft, die man jeden vorwirft, denen man unterstellt, etwas verbieten zu wollen. Er fordert Gerechtigkeit und Fairness und sagt dann: „Wir (…) sollten die Moral dort lassen, wo sie hingehört (nämlich in der Kirche).“ Man muss sich also von der Moral verabschieden, um ungestört Schnitzel essen zu können. Das ist eine starke Ansage. Üblicherweise sind Momente, in denen es für angemessen gehalten wird, Moral hintanzustellen, Notsituationen, in denen das Überleben auf dem Spiel steht. Kleinere Geister erweitern das gerne auch insofern, als sie Stärkeren/Mächtigeren/Reicheren nicht den gleichen moralischen Respekt zugestehen wie allen anderen. In diesen Notsituationen (oder weil es dem anderen ohnehin nicht weh tut, es trifft ja keine Armen) nimmt man sich, was man kriegen kann und rennt (oh, da klingelt ja noch ein anderer SPÖ-Slogan im Hinterkopf: Holt euch, was euch zusteht! – Erinnert sich jemand? Auch das war übrigens eine beistrichtechnisch sehr geforderte Kampagne.) Was spricht sonst noch gegen Moral? Manche ewigen Gymnasiasten stricken sich nietzscheanisch angehauchte Amoralitätskonstrukte. Nicht weit entfernt davon sitzen dann die Rechner und Rationalisten, die für jede Theorie eine ökonomische Erklärung bei der Hand haben, dann gibt es noch die Erfolgreichen, für die alles recht ist, was zu Wachstum verhilft – es gibt viele Spielarten amoralischer Zonen. Allesamt sind eher unerwünschte Randerscheinungen, die sich gegen etwas stellen, von etwas abgrenzen. Nichts davon ist solidarisch oder sozialdemokratisch. Im Gegenteil. Moralische Komponenten sind wohl die wichtigste Grundlage, wenn ein Konstrukt rund um Fairness und Gerechtigkeit jemals laufen lernen soll.
Sollen sich die Sozialdemokraten aber selbst überlegen, warum Moral plötzlich zu ihren Feindbildern gehört. Unabhängig davon ist auch der Konnex zwischen Moral und Kirche schlicht sachlich falsch. Moralische Überlegungen sind nicht nur älter als Kirchen, sie sind auch unabhängig von konkreten Ausprägungen von Kirchen und Religionen und sie lassen sich auch sehr gut ohne religiösen Überbau begründen. Und das klappte auch im stärker kirchlich dominierten Zeiten ganz gut: Der anarchistische Denker Peter Kropotkin feierte unter anderem Adam Smith als denjenigen, der den Grundstein für moralische Argumentation ohne den Bezug auf göttliche Wesen geschaffen habe – das ist ziemlich ideologieübergreifende Anerkennung.
Eingeklemmt in Worthülsen
Lassen wir das. Denn schließlich sind solche Behauptungen nur Symptome. Aus Worthülsen bestehende Kommunikation, in der Argumentation, Logik, Konsistenz, Stringenz oder auch nur historische Fakten vollkommen irrelevant sind, ist der Normalzustand. Wir bewegen uns in Bedeutungskreisen – die zu schaffen ist eine der Kernaufgaben politischer Bewegungen, es ist eine der wesentlichen Funktionen von klassischen Medien, die diese Bedeutung über ihre Marke verstärken (und umgekehrt). Und auch scheinbar offenere Medien wie Social Media haben diese Bedeutungskreis über so einfache Mechanismen wie Auswahl und Ausschluss schnell abgeschlossen. Für viele Menschen gilt: Je mehr Auswahlmöglichkeiten sie bei Information haben, desto eher beschäftigen sie sich stets mit demselben. Manche werden dadurch zu Expert_innen, andere zu Fachidiot_innen, wieder andere vermeiden so, neues zu erfahren.
Ein Problem wird das vor allem dann, wenn einmal die eigenen Bedeutungskreise durchbrochen werden müssen. Das kann der Fall sein, wenn man einmal etwas anderes sagen möchte – nicht das, was immer von einem erwartet wird. Das ist selten ein bewusster Vorgang. Öfter passiert das einfach: Man möchte weiter ausholen, die Aufmerksamkeit auf andere Punkte lenken, einen Punkt deutlich machen, der scheinbar augenscheinlich ist, aber offenbar übersehen wird.
Buchstabensuppe
Stattdessen entstehen Worthülsenaneinanderreihungen ohne Bedeutung; die Regeln von Logik, Grammatik und Semantik reichen nicht aus, um diesen Buchstabensuppen den Sinn zu verleihen, den der oder die Absender_in gerne für sie reklamieren möchte. Um verstehen zu können, muss man schleunigst wieder zurück in die alten Bedeutungskreise, und die Absurdität des Gesagten wird dann, sofern sie überhaupt thematisiert werden konnte, als Vorstoß, eine Diskussion anzuregen, abgetan. Man könnte da jetzt informationstheoretisch anknüpfen und über die Bedingungen der Möglichkeit des Neuen in der Sprache nachdenken. Ich habe aber den Verdacht, dass auch das nicht passiert. Das jahrzehntelange Dogma, Dinge kurz und einfach zu halten, langweilt jetzt offenbar sogar schon die, die es predigen. Sie haben allerdings verlernt, anders zu kommunizieren. Der viel geschmähte Elfenbeinturm hat lang als Steinbruch gedient, aus dem man sich nach Belieben Bruchstücke herausgeholt hat, und sie kontextfrei zu verbraten. Da ist halt nicht viel übrig, wenn man jetzt einfach mal schnell zurück in höhere Sphären möchte. Die Gefahr, in dem baufälligen Turm auf einer Treppe ohne Geländer auszurutschen, ist zu groß.
Aber Gottseidank ist diese Region der sinnvollen Kommunikation, in der man über Neues reden könnte, so verlassen, dass kaum jemand dabei beobachtet wird. Ausgerutscht? Kein Problem, Staub aus der Kleidung klopfen, blaue Flecken ignorieren und so tun als wäre nichts. Die Geste ist ausreichend, notfalls kann sie mit der nächsten empörten Behauptung wiederholt und untermauert werden. Fraglich ist nur, wie lang man dieses ignorante Spiel weiterspielen kann, ohne im völligen Chaos zu landen. Wobei – schaut nach England, schaut in die USA.