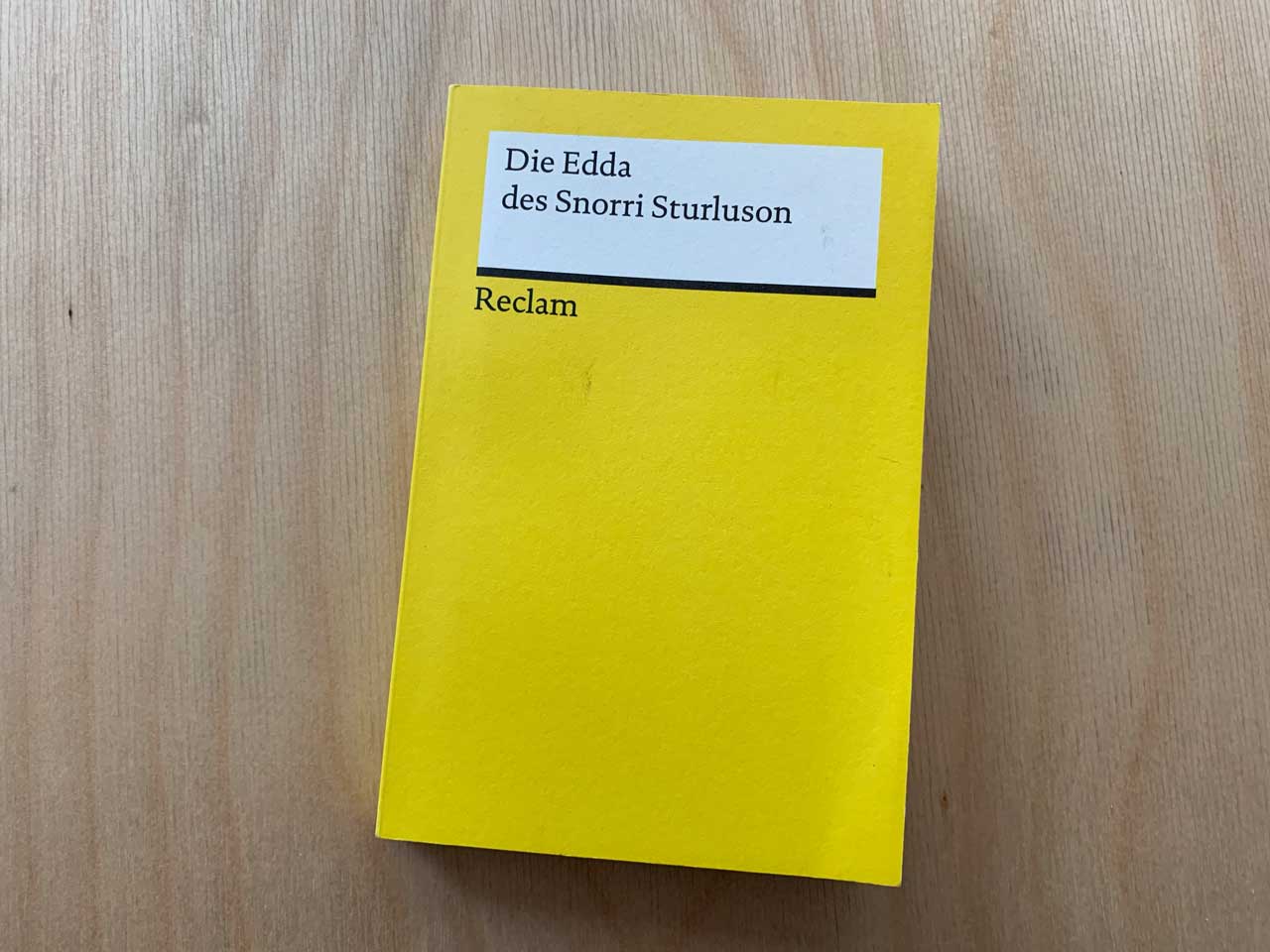Es ist ein Dämon aus der Zukunft, ein Wink des auf seine Chance lauernden Kommunismus, eine Folge eines zügellosen Kapitalismus, eine Chance, so vieles zu ändern – dem Coronavirus wird vieles nachgesagt.
Viele erleben Ausnahmesituationen, gerade diejenigen, die vielleicht am wenigsten Ausnahme erleben, machen sich gerade deshalb, weil sie nichts tun können, weil nach dem ersten Schreck wenig reale Einschnitte vorhanden sind, um so mehr Gedanken über die Dramatik der Situation. Unsicherheit ist da, das lässt sich nicht bestreiten. Und sie betrifft alle. Noch profitiert kaum jemand von dieser Krise. Den einen droht Arbeitslosigkeit, den anderen drohen Geschäftsrückgänge, nicht einmal Vermieter als Inbegriff des gierigen kapitalgetriebenen Bonzen können sich ihrer Sache sicher sein – denn wer soll noch zahlen, wenn niemand mehr (ungestört) arbeiten kann?
Die Unsicherheit ruft Propheten auf den Plan.
Sie sind jetzt schon überzeugt, dass „nachher“ nichts mehr so sein wird wie zuvor. Sie sehen jetzt Zeichen für das, das sie immer schon gewünscht oder gefürchtet haben – je nach persönlicher Disposition. Jene, deren Kerngeschäft professionelle Vagheit ist, produzieren nebulöse Fließbandprophezeiungen.
Es ist ja auch eine ideale Zeit, um den legeren Umgang mit Widersprüchen zu pflegen: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn sich die Lage täglich mehrfach ändert?
Die Krise offenbart Ratlosigkeit
PolitikerInnen reagieren mit demonstrativer Entschlossenheit. Das heißt: Sie werfen mit Milliardenbeträgen um sich. Dabei scheint niemand so recht zu wissen, wofür. Es ist unklar, was auf dem Spiel steht – gut, die Folgen in der Zukunft kann man schwer abschätzen.
Man will Arbeitsplätze bewahren, man will in Zeiten fehlender Einnahmen Liquidität sichern, also stundet man Zahlungen, pumpt Geld in Kurzarbeitslösungen und sichert Hilfe in Härtefällen zu. Für Selbstständige und kleine Unternehmen sind das schlechte Zeiten. Hier jongliert man nicht mit Krediten, die gestundet werden könnten, man hat auch keine Scharen von Angestellten, deren Kosten man auf andere abwälzen könnte. Kleinen Unternehmen und Selbstständigen gegenüber herrscht große Ratlosigkeit – offenbar hat niemand einen Plan, wo einzugreifen wäre. All die demonstrative Entschlossenheit kann die reale Ratlosigkeit nicht überdecken.
Die aktuellen Notfallspläne offenbaren vor allem, dass kleine Unternehmen für Bettler und Almosenempfänger gehalten werden: Bei einem Umsatzrückgang von 50-75 Prozent sind Mietzuschüsse von ein paar hundert Euro vorgesehen, bei Umsatzrückgängen von mehr als 75 Prozent gibt es direkte Zuschüsse von bis zu 1000 Euro.
Wenn diese 1000 Euro 75 Prozent des Umsatzes ersetzen sollen, geht man also von Monatsumsätzen in der Höhe von 1300 Euro für kleine Unternehmen aus – davon kann man in normalen Zeiten nicht einmal die Sozialversicherung bezahlen.
Überdies wird der Nachweis des Umsatzrückgangs im Vergleich einzelner Monate mit den Vorjahresmonaten verlangt. Das ist vielleicht für Cafés, Boutiquen und ähnliche Unternehmen möglich. Die Kreativwirtschaft und alle anderen projektbezogen arbeitenden Branchen, in denen sich Einnahmen unregelmäßig über sehr lange Zeiträume verteilen, schauen dabei durch die Finger. Gerade jene Branchen werden Einschnitte auch erst später, dafür aber länger spüren: Jetzt liegen Projekte auf Eis. In ein paar Monaten werden Kunden wieder arbeiten, neue Prioritäten setzen und über Projekte nachdenken. Bis Entscheidungen getroffen werden, Budgets neu zugeteilt sind und Aufträge vergeben werden, wird es Herbst sein. Bis die Projekte dann auch bezahlt sind, wird es Frühjahr 2021 sein.
Es mutet auch seltsam an, welche anderen Maßnahmen als Zeichen politischer Entscheidungskraft verkauft werden. So sollen UnternehmerInnen Beiträge zur Sozialversicherung und Einkommensteuervorauszahlungen herabsetzen lassen. Das ist immer möglich, dazu braucht es keine Virus-Krise. Alle, deren Einkommen sich verändert, können ihre Zahlungen anpassen lassen. Und gerade für Branchen mit stark wechselndem Einkommen ist diese Anpassung essenziell – sie wird allerdings oft auch zur Schuldenfalle. Es dauert lang, bis neue Bescheide ausgestellt sind, Fälligkeiten sind oft nicht klar kommuniziert und Betroffene müssen sich dann selber ausrechnen, wann welche Zahlungen anfallen werden. Bei der Einkommensteuer ist das noch etwas transparenter; Vorschreibungen zur Sozialversicherung dagegen werden sehr verwirrend.
Grotesk ist auch, dass Politik und Wirtschaftskammer das mögliche Aussetzen von Mietzahlungen als Erfolg feiern. Auch dazu braucht es keine Virus-Krise, für unbenutzbare Mietobjekte muss keine Miete gezahlt werden – das steht so im Gesetz. Dazu kommt, dass ausgesetzte Mietzahlungen das wirtschaftliche Problem ja nur verschieben, aber nicht lösen. Mieterinnen nützt das, VermieterInnen schadet es – und auch diese sind auf Umsätze angewiesen, um Gehälter zahlen und Mitarbeiterinnen behalten zu können.
Niemand weiß, wie Kleinunternehmen funktionieren
Wenn sich etwas offenbart, dann ist es kein Blick in die Zukunft, es ist nicht die Notwendigkeit neuer Visionen, Gesellschaftsentwürfe oder Wirtschaftskonzepte. Es ist eine generelle Ratlosigkeit.
Es ist Verständnislosigkeit gegenüber dem, was ist. Wirtschaftspolitik und ökonomische Theorie waren zuletzt großteils eher sportliche Betätigungsfelder. Man bewies damit humoristischen Anspruch, zeigte ein wenig Bildung und ordnete sich großflächig in irgendwelche Schulen ein. Keynes, sagen sie einen, Hayek die anderen. Die Idee, dass Konzepte aus einer konkreten Zeit auch in diese Zeit passen, andere Zeiten aber andere Konzepte brauchen, war selten mehrheitsfähig. Das ist eine der Schwächen von Ökonomen: Ökonomische Theorien wollen erklären, von der Erklärung ist es dann nicht weit zur Prognose – und das verleiht manchen offenbar Selbst- und Sendebewusstsein, das sich dann spielend über Tatsachen hinwegsetzt. Man hat ja eine Meinung.
Die Idee, dass Prognosen auf Modellen beruhen, die idealisierte Vereinfachungen sind und deshalb Szenarien entwerfen und zum Nachdenken anregen können, aber keine Gewissheit liefern, ist dem gegenüber viel zu unsexy und bescheiden. Es sei denn, sie dient dazu, das eigene Business as usual fortzusetzen.
Kurz gesagt: Man kann es ja kaum jemandem übelnehmen, heute nicht genau zu wissen, was man ökonomisch betrachtet tun soll. Für diese Unsicherheit aber 4, 38 oder unbegrenzt viele Milliarden Euro heranzuziehen, für die man auch nicht haftet, ist ein spannendes Experiment.
Ich habe ja auch keine Lösungen. Aber ich wage ein paar Feststellungen.
- Kleine Unternehmen und Ein-Personen-Unternehmen werden bei den Hilfsaktionen weitgehend leer ausgehen. Das liegt zum Teil daran, dass die bis jetzt vorgestellten Maßnahmen zu unkonkret sind, um Orientierung zu geben, und zugleich zu spezifisch, um vielen zu helfen. Zum größeren Teil wird es aber daran liegen, dass sie es sich nicht leisten können, auf Hilfe zu warten. Sie müssen sich etwas anderes überlegen, sich neu orientieren – das tun, womit sie sich immer schon über Wasser gehalten haben. Wahrscheinlich werden viele nicht einmal sofort das Handtuch werfen – es kann zwei oder drei Jahre dauern, bis sich herausstellt, ob der neu eingeschlagene Weg Sinn macht oder nicht.
- Eine logische Konsequenz für Selbstständige muss es sein, die eigenen Stundensätze deutlich zu erhöhen, bei Kalkulationen knausriger zu werden und größere Margen anzustreben. Viele kalkulieren unscharf, wollen den Job, und nehmen viele zusätzliche Aufwände, Planänderungen und Richtungsschwankungen im Projekt unbezahlt auf sich, weil es nicht wirtschaftlich wäre, um die Mehraufwände zu streiten. Der Streit kostet mehr Zeit als der Mehraufwand bringt – man stiege dann wieder bei Null aus. In diesen Wochen wird deutlich, dass das Risiko ausschließlich beim Einzelnen hängt – und dass man es verrechnen muss.
- Unterschiedliche Selbstbilder von Selbstständigen werden noch unterschiedlicher werden. Manche – vor allem in der Kreativbranche – sehen sich als ewig unterbezahlte, sich selbst ausbeutende Abhängige, die schlecht behandelt werden. Andere sehen sich als Generalunternehmer, die auch Aufträge und Geld verteilen und die, wenn sie schon arbeiten, dann lieber Projekte machen, die auch Geld bringen. Die einen wollen Absicherung, die anderen wollen Spielraum. Die einen sähen ein Grundeinkommen als Freiheit, sich mit eigenen Themen zu beschäftigen, die anderen sähen es eher als bürokratischen Aufwand, der Steuer und Buchhaltung komplizierter macht. Beide brauchen Planungs- und Entscheidungssicherheit – die fällt jetzt für einige Zeit weg. – Manche werden dann noch mehr Hilfe wollen, andere werden zu dem Schluss kommen, dass man sich eben auf andere nicht verlassen kann. So können alle ihre eigenen Vorstellungen bestätigt sehen.
- Kleine Unternehmen und Ein-Personen-Unternehmen haben noch einen langen Weg vor sich, um zeitgemäße Interessen schlagkräftig und öffentlichkeitswirksam formulieren zu können. Sie sehen sich nicht als Arbeitsplatzmaschinen, sie sind nicht auf plakative StartUp-Rallyes aus, sie knüpfen manchmal, aber nicht notwendig an Megatrends wie Nachhaltigkeit an. Sie sind einfach ein Weg, in einer sehr dynamischen Umwelt geschäftlich zu überleben; sie sind oft das Vehikel für jene, die ihr Ding machen wollen – ohne an einer großen Organisation andocken zu müssen, ohne den Ballast großen Wachtstumszwangs oder noch komplizierterer bürokratischer Auflagen mitzuschleppen, ohne anderen Versprechungen zu machen oder andere abhängig machen zu wollen. – Das ist kein Zwischenstadium, das ist eine legitime Organisations- und Arbeitsform. Unternehmerisch orientierte Lobbys sehen dagegen im Ein-Personen-Unternehmer oft eine untere Entwicklungsstufe, die es auf dem Weg zu Wachstum und Angestellten zu überwinden gilt, sozialistisch orientierte Lobbys betrachten Selbstständige als eine Art Straßenköter, die man zu ihrem eigenen Schutz sterilisieren und ins Heim stecken sollte. Beides ist unangemessen.
- Die Ratlosigkeit darüber, wie Selbstständigen nun am ehesten zu helfen sei, wäre ein guter Anlass, sich mit einigen großen Problemfeldern zu beschäftigen, die ihnen das Leben schwer machen. Um nur ein paar Beispiele herauszugreifen: Für die am unteren Einkommensrand sind es Mindest- und Mehrfachversicherungen, die große Hürden darstellen. Das erschwert auch den Übergang zwischen (Teilzeit-)Anstellungen und beginnender Selbstständigkeit. Die mit besseren Einkommen dagegen können kaum Rücklagen bilden. Jeder Gewinn ist sofort zu versteuern, Rücklagen für Forschungs- und Entwicklungsphasen oder einfach für ein Sabbatical können kaum gebildet werden. Internationale Umsatzsteuerregelungen schränken ebenfalls den Bewegungsspielraum von Kleinen ein: Wer auf Messen im Ausland verkaufen möchte, braucht eine Umsatzsteuernummer eben dort und muss Ausfuhrlieferungen an sich selbst verbuchen. Onlineriesen wie Amazon laden zwar auch Kleine auf ihre Plattformen ein, wälzen aber ebenfalls das Risiko korrekter Umsatzsteuern auf sie an. Das betrifft nicht nur Ein-Personen-Unternehmer – aber diese haben keine Buchhaltungs- und Rechtsabteilungen, die sie da durchführen. Freibeträge, die die Größenverhältnisse widerspiegeln, wären ein erster Ansatz. – Das klingt vielleicht nach weit hergeholten sehr groß angelegten Änderungen. Realwirtschaftliches Verständnis lässt sich aber auch im Kleinen und im Umgang miteinander erkennen: Zahlungsziele von 90 Tagen (die dann ohnehin nicht eingehalten werden), völlig fehlendes Verständnis für Mehrkosten durch exzessive Korrektur- und Änderungsrunden, lange zögerliche Entscheidungswege und mangelnde Verlässlichkeit bei Zeitplänen sind dann auch nur einige Beispiele, wie kleine Angestellte großer Unternehmen Selbstständigen im Alltag das Leben schwer machen. – Und diese Beispiele, damit sich der Kreis wieder schließt, zeigen auch, warum die aktuell geplanten Unterstützungsprogramme an vielen Selbstständigen vorbeigehen werden. Ihre Verluste werden später eintreten und langer anhalten, und sie werden nicht im Monatsvergleich messbar sein.
Man braucht keine spektakulären Visionen, um Entscheidungen in Wirtschafts- und Sozialpolitik zu treffen. Ein wenig mehr Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ist, würde fürs erste – und auch für länger – ausreichen.