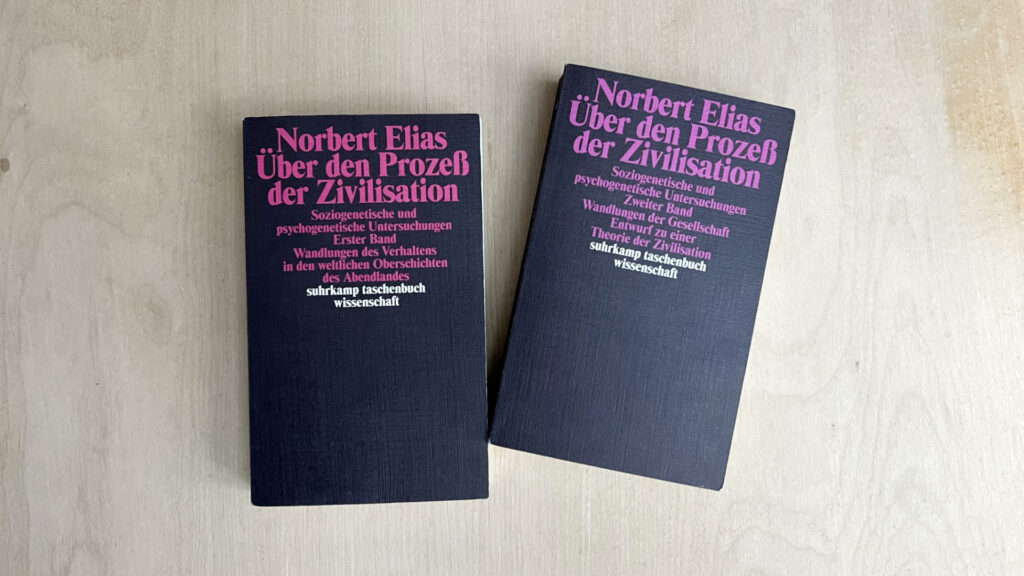Das Ungewöhnlichste an einem zweibändigen über 1000 Seiten langen Buch über die Geschichte der Zivilisation ist aus der heutigen Perspektive, in einer Zeit von Klima-, Corona-, Energiekrise und Krieg, die Hartnäckigkeit, sich mit derart langen Zeiträumen zu beschäftigen. Macht dieseer große Horizont heute noch Sinn?, drängt sich als Frage auf. Haben wir noch so viel Zeit für so große Entwürfe?
Das ist für viele vermutlich nachvollziehbar. Es ist ebenso nachvollziehbar, wie es letztlich absurd ist: Die Geschichte, mit der sich Norbert Elias beschäftigt, war immer eine krisenreiche, kriegerische, gewalterfüllte, eine in der, im Gegenteil, in Elias‘ Perspektive, die Dinge sich zum besseren wenden. Zivilisationen entstehen, Menschen lernen, sich zu kontrollieren, die Welt wird zu einem ruhigeren und weniger gefährlichen Ort. Dieser grundlegende Optimismus steht in deutlichem Gegensatz zu etwa Hobsbawms Pessimismus, für den noch nicht einmal mit dem Zweiten Weltkrieg der Gipfel der Grausamkeit erreicht war.
Affektkontrolle als Prozess
Elias‘ Werk ist auch noch aus anderen Perspektiven anachronistisch. Elias hat eine Idee, eine Ausgangsthese von der zunehmenden Affektkontrolle trägt die ganzen 1000 Seiten. Anders als ähnliche sozialwissenschaftlich-historische Bücher aus der gleichen Zeit (also aus der späten Zwischenkriegszeit) schöpft die Geschichte der Zivilisation dabei nicht aus dem vollen Register von Rechts-, Politik-, Wirtschafts-, Kultur-, Literatur- oder Kunstgeschichte über die Jahrhunderte und in vielen Teilgebieten (wie etwa Beauvoirs „deuxième sexe“) über die Jahrunderte hinweg und in Hinblick auf verschiedenste Themenbereiche. Elias bleibt sehr konzentriert auf zwei Kernthesen. Die eine ist inhaltlicher Natur – die Geschichte beobachtet zunehmende Affektkontrolle –, die andere ist methodischer Natur: Elias betont die Prozesshaftigkeit von Geschichte, immer wieder weist er darauf hin, dass sich Thesen nicht an Momenten oder in statischen Diagnosen argumentieren lassen. Sie sind auf Entwicklungen und Bewegungen angewiesen, den in der Theorie beschriebenen Reinzustand gibt es im Feld nicht.
Die Affektkontrolle scheint Elias selbstverständlich gewesen zu sein – er postuliert sie und liefert viele Quellen. Die Prozessorientierung muss in seinen Augen eine neuartige Methode und Diagnose gewesen sein, er weist immer wieder darauf hin und spricht dabei auch imaginäre KritikerInnen oder KollegInnen an.
Die Prozessorientierung bezieht sich schließlich nicht nur auf historische Ereignisse, auch Identitäten, letztlich der Mensch selbst sind dynamische Prozesse. Elias weicht die Grenze zwischen Innerem und Äußerem in der Analyse von Menschen, Gesellschaften und Einflüssen auf und wird damit zu einem frühen Protagonisten von external und extended mind-Theorien und von Theorien, wie Materialität und Artefaktualität von Wissen und Gedanken einbeziehen. Der Mensch ist also kein homo clausus.
Der unabgegrenzte Mensch
Diese Unabgeschlossenheit mündet für Elias in einer Suche nach Abgeschlossenem, Fixiertem, Absolutem – darin, dass ist eine Nebenlinie des Texts, sieht er das Aufkommen von Nationalismus oder Sozialismus begründet. Beide schaffen Entitäten, die über den einzelnen hinausgehen und dessen Unsicherheit und Unabgeschlossenheit etwas Fixes und Eindeutiges gegenüberstellen.
Elias‘ Diagnose der Unabgegrenztheit des Menschen stammt aus den 30er Jahren. Sowohl soziale als auch nationale Absolutheiten waren in dieser Zeit bereits problematisch geworden.
Spätere Unabgegrenztheits-Diagnosen konzentrierten sich auf andere Schwerpunkte. Latour etwa postulierte Unabgrenztheit als notwendige Position, um Irrtümer der Moderne zu korrigieren: Die Abgrenzung von Natur und Kultur, Umwelt und Gesellschaft, Unberührtem und Technik sei nicht nur nicht haltbar, sondern ein folgenschwerer Irrtum der Moderne, der zur Überschätzung von Technik und Kontrollierbarkeit führt. Die Frage ist nun, ob Latour damit die Diagnose von Elias fünfzig Jahre später (in den 80er Jahren) variiert – oder ob Latours Postulat auf falschen Voraussetzungen beruht, weil die vorausgesetzte strenge Trennung von Natur und Kultur, von Mensch und Umwelt so streng nicht wahr, wenn Elias schon recht hatte. (Latours Postulat funktioniert meines Erachtens generell nur vor einer Technologie- und Kontrollgläubigkeit, wie es sie zuletzt wohl in den 60er Jahren gab. Spätestens seit dem Aufkommen von Umweltbewegungen, Feminismus und anderen Protestbewegungen ist diese Diagnose eigentlich nicht mehr haltbar.)
Zurück zum Inhalt. Affektkontrolle als Antrieb der Zivilisation schreitet für Elias auch deshalb konstant voran, weil Kooperation notwendig wird. Das erinnert an die Supercooperators-These des Evolutionsforschers Martin Nowak, ist allerdings keine ganz so neue These. Polybius skizzierte im zweiten Jahrhundert bC seine Idee eines Verfassungskreislaufs zwischen Demokratisierung und Tyrannei und hielt damals schon fest, dass die Bauwirtschaft im römischen Reich möglicherweise mehr zu gegenseitigem Respekt und Demokratisierung beigetragen habe, als diverse Verfassungsbemühungen – schließlich erfordert das Bauen (vor allem in entfernten Reichsteilen) klare und gut geregelte Kooperation über große Distanzen und lange Zeiträume hinweg.
Von höfischen Regeln zum anonymen “Es gehört sich so”
Elias setzt seine Beobachtungen zur Zivilisierung mit 16. Jahrhundert mit den Erziehungsempfehlungen des Erasmus von Rotterdam an. Diese ganz pragmatischen Richtlinien (nicht öffentlich rülpsen und furzen, Taschentücher zum Schneuzen verwenden) verwenden den Begriff der Zivilisation und setzen ihn großteils mit Benehmen und eben mit Affektkontrolle gleich.
Erasmus‘ Empfehlungen verbreiteten sich schnell; Elias analysiert, wie sich zahlreiche fast wortgleiche Richtlinien in unterschiedlichen Schriften unterschiedlicher Autoren fanden. Im Lauf der Zeit veränderte sich dabei die Ausrichtung der Empfehlungen. Ursprünglich waren es Regeln für junge Aristokraten, dann wurden es Empfehlungen für alle, die bei Hof reüssieren wollten. Mit dieser Verbreiterung ging eine weitere Anonymisierung des Absenders der Empfehlungen einher. Aus „es ist höfisch“ wurde ein anonymes und abstraktes „man macht das so“. Je anonymer der Absender ist, desto schwerer ist es , sich von dessen Empfehlungen oder ihm selbst abzugrenzen. Die Regeln gelten. Wer ihnen nicht gerecht wird, gehört nicht nur nicht dazu, sondern wird zum allgemeinen Außenseiter, der nicht Teil einer nur unscharf bestimmten Gesellschaft ist.
Arbeit als Abgrenzungsstrategie
Affektkontrolle als Konditionierung und Fassonierung schafft bestimmte Zielvorstellungen und regt zu Verhaltensweisen an. Elias erklärt so auch das Entstehen von bürgerlicher Arbeit: Während der Adel nicht arbeitete, gehörte es zu den konstituierenden Regeln der bürgerlichen Gesellschaft, sich durch Arbeit – auch wenn keine materielle Notwendigkeit dazu bestand – vom Adel abzugrenzen. Mit Arbeit gingen weitere Regelungen und Einschränkungen wie etwa ein strukturierter Tagesablauf einher. Die kurzen Passagen erinnern auch an Edward Thompsons „The Making of the Englisch Working Class“ – allerdings interpretiert Thompson die Entstehung von Arbeit und geregelten Tagesabläufen als disziplinierende Zwangsmaßnahme gegenüber einer armen Landbevölkerung, die für Arbeitseinsätze gebraucht wurde.
Im Verhältnis von bürgerlichen und Adeligen in Elias Interpretation führen klarere Regeln (etwa auch in der Belehnung von Grundstücken, in der Erb- und Machtfolge, in der Trennung von Adel und Bürgerlichen) zu einer Verfestigung von Besitzverhältnissen, die soziale Mobilität grundsätzlich reduzierte – damit aber umgekehrt erst auch mehr Mobilität notwendig machte. Wanderbewegungen und Eroberungszüge, etwa auch die Kreuzzüge, schafften neue Horizonte und vergrößerten zu verteilende Besitztümer. Elias sieht das als Individualisierungsschub, der erneut strengere und klarere Regeln notwendig machte.
Gehenkte am Bildrand
Elias analysiert eine Fülle von Quellen von Schriften über Normen bis zu Bildern, um seine Thesen zu untermauern. Details sind manchmal ermüdend, manchmal bemerkenswert: Auf Darstellungen ritterlicher geprägter Landschaftsszenen etwa interpretiert Elias beiläufig im Hintergrund oder am Bildrand abgebildete Gehenkte als Indiz dafür, dass die Macht des Ritters unumschränkt, sein lokales Gewaltmonopol aber auch keine große Sache war. Es war selbstverständlich. Hätte man es für relevant oder bemerkenswert gehalten, dann wären die Gehenkten zentraler im Bild gewesen. Auch bemerkenswert ist Elias Optimismus, der auch nach dem Ersten Weltkrieg und in den 30er Jahren noch von Fortschritt und dauerhafter sozialer Entwicklung hin zum besseren überzeugt ist. Es ist sogar davon überzeugt, dass der Prozess der Zivilisierung weiter voranschreiten wird; der nächste relevante Meilenstein besteht für ihn in der laufenden Ausdehnung des Geltungsbereichs einzelner Zivilisierungsvorschriften. Galten Regeln erst nur für kleine höfische Gesellschaften, so vergrößerte sich deren Geltungsbereich mit fortschreitender politischer Zentralisierung. Mit der Entstehung bürgerlicher Gesellschaften vergrößerte sich auch der Kreis der zivilisierbaren Subjekte. Eine nächste Stufe der Zivilisation wäre für Elias dann erreicht, wenn Zivilisationsregeln auch für Beziehungen von Staaten untereinander gelten … Davon entfernen wir uns zur Zeit wieder ein Stück.
Wie kann man Elias heute noch lesen? Ein Punkt ist die Betrachtung langer Zeiträume, aus denen auch in die Zukunft projiziert wird. Das wirkt in einer Zeit dramatischer Umbrüche anachronistisch, allerdings waren auch die 30er Jahre nicht gerade von Stabilität geprägt.
Sind wir heute zu individuell für Elias’ Zivilisation?
Andere Aspekte, sie sich möglicherweise gerade verändern, sind die Abstraktion und Anonymisierung der Geltungsquellen von Regeln, die dadurch immer universeller werden. Heute werden Regeln wieder individueller und konkreter – sie sind auf Individuen und Gruppen bezogen, sie verändern sich abhängig von den gerade betroffenen oder aktiven Gruppen. Sie werden auch schwerer verständlich, es gehört geradezu zu ihrem Wesen, sich nur Eingeweihten vollends zu erschließen. Ist das auch ein weiteres Fortschreiten von Zivilisation, indem komplexe individualisierte Regeln Kulturen und Gesellschaften schaffen, die weit von dem entfernt sind, was andere als natürlich empfinden, die „natürlich“ im Gegenteil sogar zu einem Kampfbegriff stilisieren, der allenfalls noch von jenen verwendet wird, die keine Ahnung haben.
Damit ändert sich auch die Idee vom unabgeschlossenen oder unabgegrenzten Menschen. Unabgeschlossen und flexibel bleibt der Mensch zwar weiterhin – aber manche (besonders Zivilisierte?) wird Abgrenzung umso relevanter. Abgrenzung als Erläuterung von Unterschieden schafft grundsätzlich Beziehungen, die Betonung von Unterschieden nimmt Bezug und erklärt dadurch. Abgrenzung als Kommunikationsverweigerung dagegen kappt diese Verbindungen.
Hanna Arendt beschrieb mit diesen gekappten Verbindungen ein Konzept des Bösen. Und auch in Elias‘ Argumentation bewegt sich eine auf Abgrenzung, Gegensätze und Nichtverhandelbarkeit pochende Gesellschaft weg von Zivilisation.
Unbeantwortet bleibt die Frage, ob das besser oder schlechter ist. Und für wen.