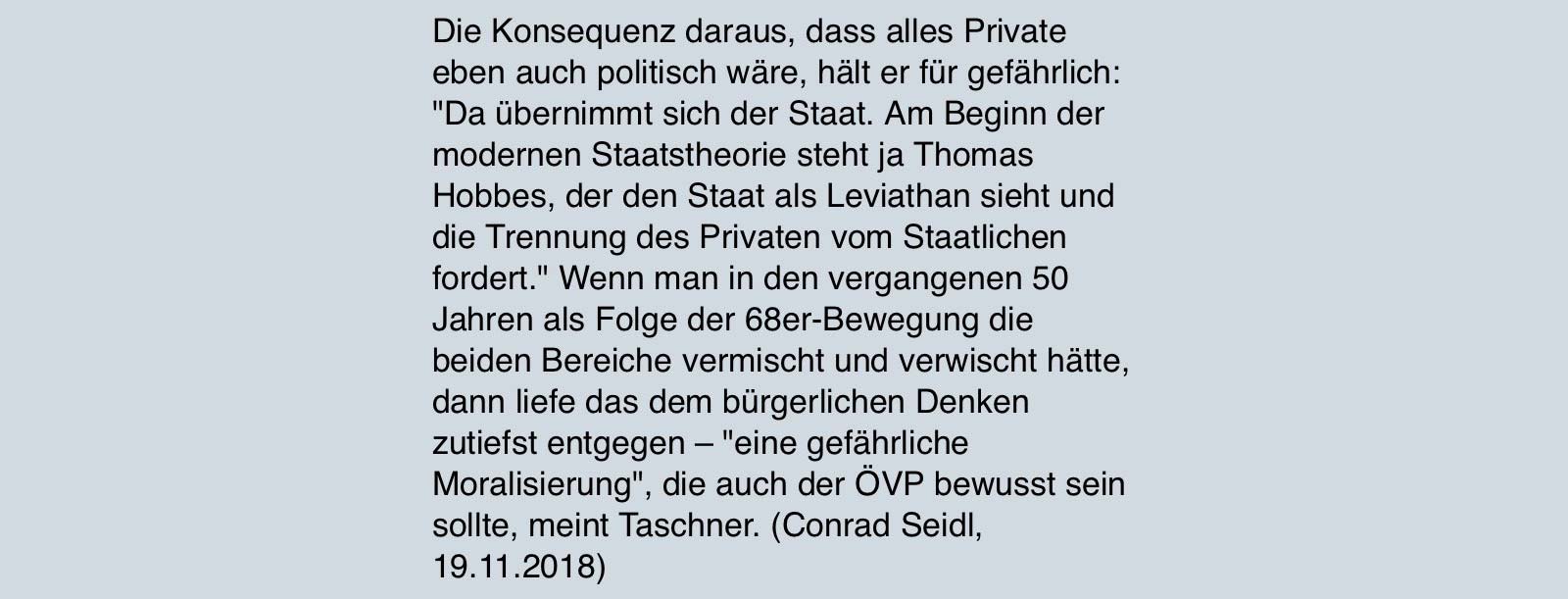Michael Hafner
Michael Hafner
Ein niederträchtiger Hassprediger macht Entertainment. Ist das lustig?
Halloween: Was ist heute schon Horror?
Gäbe es da nicht das einprägsamste Musikthema aller Zeiten, dann wäre Halloween wohl einer der vernachlässigbarsten Filme überhaupt.
Das zeigt sich im 2018er Remake umsomehr. Was soll heute schon noch Horror sein?
Michael Myers schlachtet sich beiläufig durch den Film, mindestens ein Dutzend Tote gehen auf sein Konto, Unfallopfer gar nicht eingerechnet – das sind drei mal so viel wie im Original, an das die 2018er-Version anknüpft.
Im Gegensatz zum Original wird hier aber gleixh jede Chance auf Spannung, ambivalente Charaktere oder Überraschungen zunichte gemacht.
Michael ist halt böse, das personifizierte Böse – und deshalb tötet er.
Außerdem ist er superstark, also hat man auch keine Chance gegen ihn. Wurde eigentlich jemals geklärt, woher Myers diese Superkräfte hat? Er war schließlich ab seinem sechsten Lebensjahr recht lang im Gefängis – üblicherweise nicht gerade ein Ort bester Ernährung oder auch sonst nicht sehr förderlich für die Gesamtentwicklung.
Diese Frage stellt sich auch in diesem Halloween-Film nicht, und was besonders schade ist: Es gibt einen kurzen Moment, in dem die Handlung kippen könnte, einen ganz anderen Verlauf nimmt und sich von den üblichen Halloween-Vorgaben verabschieden könnte – aber das hält keine zwei Minuten. Dann tut Michael halt wieder das, was er immer tut. Schlachten.
(Ist schon klar, filmtheoretisch gesehen: Michael Myers ist besonders, weil er alles mögliche überlebt, was andere siebzehn Mal töten würde, er bewegt sich langsam wie ein Zombie (eigentlich müsste man mühelos vor ihm fliehen könnenI, aber wenn er nicht im Bild ist, ist er geradezu telekinetisch schnell – aber das wissen wir eben nach sieben (sind es sieben?) Halloween-Versionen schon; ohne weitere Facetten in der Persönlichkeit wird die Story einfach nicht spannend.)
Und auch das Ende ist ein klischeehaftes Blockbuster-Ende. Die guten gewinnen, der Böse stirbt. Aber wir sehen seine Leiche nicht. Im flammenden Inferno steht er noch immer aufrecht und zeigt keine Regung – aus der Asche kann er locker wiederauferstehen.
Denn wie hatte schon Dr. Loomis, Michael MNyers behandelnder Psychiater, in einer der allerersten Halloween-Versionen gesagt: „Ich möchte mein Ohr an seine Brust legen, um ganz sicher zu gehen, dass da kein Herzschlag mehr ist. Und dann würde ich sofort für seine Einäscherung sorgen und sie persönlich überwachen.“ Denn vorher kann man nicht sicher sein, dass Michael Myers tot ist – aber er ist eben too big to fail.
Wirklich gruslig – im Gegensatz zum Film – ist übrigens die Lugner City an einem Wochenendabend. Dort beginnt ein anderes Universum. Ich weiß nicht, ob nur ein Gerücht oder schon näher fixiert: Die Lugner City ist der perfekte Drehort für eine nächste Mad Max-Variante …
Suspiria: so schön depressives 70er-Jahre Berlin
Dinge
Manchmal gerate ich auch in DIY-Höllen in Hotels oder AirBnB-Wohnungen: Umgebungen, in denen sich Dinge stapeln, die keine Bedeutung, keinen Nutzen und keine Funktion haben. Als Massenware nicht mal Erinnerungswert. Gut, manche wurden auch individuell gefertigt – natürlich angeleitet von Bestsellern wie dem Buch: “DIY Jutetaschen”. Oder von schlauen Listicles mit dem verräterischen Schlagzeile “DIY zum Selbermachen”.
Man könnte es Bosheit nennen. Ich nenne es lieber Dummheit
Intellektuelle Machtdemonstrationen
- Kritik ist immer zweischneidig, weil sie auch in ihrer schärfsten Form die Vorherrschaft des Bestehenden anerkennt und bekräftigt (Lagasnerie führt das am Beispiel von Foucaults Gefängniskritik aus: Jede Kritik an der sozialen Funktion von Gefängnissen bekräftigt erst einmal, das Gefängnisse eine soziale Funktion haben und dass Strafe, Korrektur, Sozialisierung wünschenswerte, mögliche und im Rahmen der Gefängnislogik verhandelbare Ziele sind).
- Kritik räumt dem Kritisierten (und damit dem Gegner) Raum ein – auch und gerade, wenn dessen Positionen als fundamental falsch erachtet werden. Sie müssen nur weit verbreitet sein. (Das lässt sich am plakativsten an (anti)feministischen Diskursen nachvollziehen, in denen immer wieder traditionell patriarchalische Positionen reklamiert werden – obwohl sie nicht Thema sind.)
- Sich aus diesem Sumpf zu befreien, ist anstrengend. Wenn der Befreiungsschlag intellektuell redlich sein soll, ist es um so anstrengender – es müssen neue Positionen geschärft und deren Basis geklärt werden. Vertreter der kritisierten Positionen dagegen können auf ein breites Repertoire schon oft durchgespielter Argumente zurückgreifen, sie haben die Macht des manchmal auch nur scheinbar Faktischen auf ihrer Seite, und (Lagasnerie schickt Bourdieu ins Rennen): „Jeder Dummkopf kann den Status Quo verteidigen“.