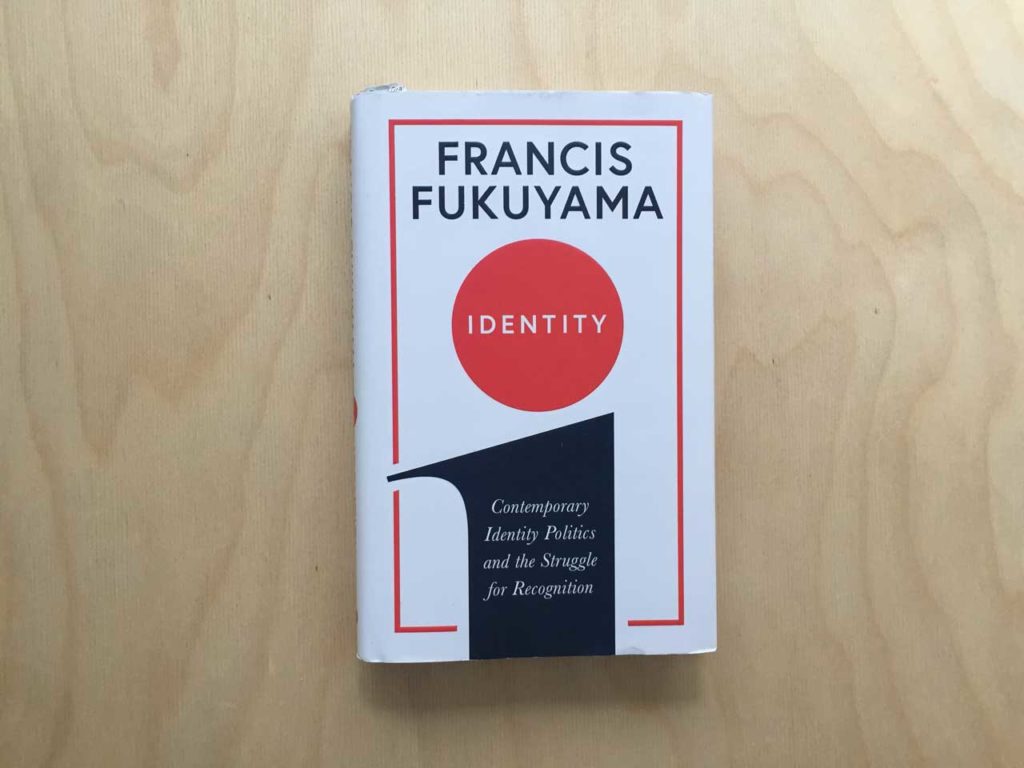Das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Francis Fukuyama beschäftigt sich mit Identitätspolitik und tut das auf informiertere und höflichere Art und Weise als viele andere. Die Flughöhe seiner Überlegungen ist so informiert und höflich, dass sie sich eigentlich an CEOs und Staatsoberhäupter richtet – so viele globale Entwicklungen und historische Herleitungen packt Fukuyama in seinen Text. Sie ist so hoch, dass sich nur denkende und handelnde Menschen auch die Frage stellen müssen, welcher Nutzen sich jetzt aus diesem Text ziehen lässt, vor allem, wenn Fukuyama seine Überlegungen auch als Basis für die Gestaltung von Mitteln gegen politische Populismus verstanden wissen möchte.
Anerkennung fürs Sein, nicht fürs Tun
Aber ein paar Schritte zurück. Fukuyama holt in „Identity“ auch weit aus, um seiner These Schwung zu verleihen. Er setzt bei Plato an und entdecktt in dessen Dialogen einen dritten Aspekt des menschlichen Innenlebens. In den Dialogen zur Staatsführung und der Frage, was den Menschen anspricht, ist neben der üblichen Aufteilung von Vernunft und Seele noch von einem weiteren psychischen Aspekt die Rede: Thymos ist der Teil der Seele, der Anerkennung will, der sich von Beachtung und Bestätigung ernährt. Vernunft ist ein weg, Dinge zu entscheiden, Emotion, dringende Wünsche sind ein anderer Weg, oft tut man aber weder das, das die Vernunft gebietet noch das, was man zu wünschen meint – dann ist Thymos am Werk.
Thymos und der Wunsch nach Anerkennung werden vor allem dort eine dringende Angelegenheit, wo die Anerkennung fehlt. Dann entwickeln Menschen verschiedene Strategien, um die Aufmerksamkeit auf die ihrer Meinung nach richtigen Stellen zu richten. Georg Franck hat das als kapitalistisches System beschrieben, heute kommt auch Emmanuel Levinas wieder in Mode, der sein Augenmerk auf Verantwortung gelegt hat – und Verantwortung ist vor allem erst auch Wahrnehmung und Anerkennung des anderen. Leiden wird eines der neuen zentralen Themen in Politik und Philosophie.
Braucht Identität Wert?
Der Wunsch nach Anerkennung ist also dokumentiert, seit der Mensch denkt. Problematisch wird es dann, wenn dieser Wunsch auch in einer Welt geltend gemacht wird, die zwischen innen und außen trennt. Fukuyama setzt es als eine neue Entwicklung an, dass wir eine innere Identität beanspruchen, die bereits für sich genommen wertvoll ist, und der oft die entsprechende Anerkennung von einer äußeren Welt verweigert wird. Für ganz so neu halte ich das nicht – spätestens die Genies der Romantik waren auch bereits Individuen, die sich nicht an äußeren Kriterien messen oder prüfen lassen wollten. Neu ist vielleicht die noch stärkere Akzentuierung vorwiegend individueller Aspekte: Kriterien wie Ausbildung, Leistung, Nützlichkeit – Kriterien, die sich an äußeren Massstäben messen oder erst in der Interaktion mit anderen beobachten lassen – treten in den Hintergrund. Damit wird die Frage der Wertbestimmung dringender: Wie entscheiden wir, welche Aspekte von Identität und Individualität wichtig und wertvoll sind und zur Würde eines Menschen beitragen?
Bei dem Versuch, diesen Wert zu bestimmen, unterlaufen Fukuyama meines Erachtens auch einige Irrtümer; die meisten davon sind auf die Differenz zwischen Idealsituationen und realer Praxis zurückzuführen. So erklärt Fukuyama, dass wohl jede Gesellschaft Heldinnen und Helden, die andere retten und schützen höher einschätzen werde als solche, die nichts beitragen oder ihre Gemeinschaft gar verraten und verkaufen. Dem möchte man zustimmen – als Österreicher_in aber denkt man an Ibiza, 45.000 Vorzugsstimmen für Strache und „Jetzt erst recht“- oder „Weil er für euch ist“-Parolen. Möglicherweise ist bei dieser Form der Wertbestimmung zwar die Identität gemeint, was aber zählt, ist die Story, das Konstrukt an Behauptungen. Und das kann sehr weit von der realen Identität entfernt sein und trotzdem funktionieren. Fukuyama meint auch, dass autoritäre Regierungen ihren Bürger_innen die volle Anerkennung ihrer Identität verweigern würden. Das stimmt aber auch nur zum Teil. Zum anderen Teil legen gerade autoritäre Regime besonders hohen Wert auf die Konstruktion von Identitäten und es wäre eine sehr verklärte Sichtweise, zu glauben, dass diese immer nur mit Gewalt aufgezwungen wären. Und schließlich ist auch der Selbstwert als wichtiger Faktor der Identität nicht unbedingt auf klassische soziale Interaktionen angewiesen. Fukuyama sieht Arbeit als einen Weg zur Sinn- und Identitätsstiftung, die Anerkennung begründet, und geht davon aus, dass ein arbeitsloses Einkommen nichts zum Selbstwert beitrage. Dem möchte ich zwei Punkte entgegenhalten: Auch erarbeitetes Einkommen stiftet nicht unbedingt Sinn. Bullshitjobs, unzufriedene Mitarbeiter, verkannte Bürogrößen, die zu höherem bestimmt sind – all das rückt die Idee von sinnvoller Arbeit auch wieder in dichte Nebel.
Spezialisierung statt Solidarisierung
Was also soll dann anerkannt werden; was ist relevanter Teil von Identität, der wichtig genug ist, zurecht im Mittelpunkt von Identitätspolitik zu stehen? Bei seiner Lösungsskizze trifft Fukuyama dann wieder auf die schärferen Kritiker, die Identitätspolitik als machtorientierten Ausdruck von Political Correctness sehen und als Luxusbeschäftigung von Eliten verurteilen. Solche Kritiker werfen vor allem Linken vor, sich zu sehr mit Ausnahmen, mit Sonderfällen zu beschäftigen. Das ist der Moment, in dem meist irgendwelche mit sehr spezifischen Identitäten beschäftigen Arbeitsgruppen an „amerikanischen Universitäten“ ins Feld geführt werden. (Fun Fact am Rande: Sucht man „Amerikanische Universitäten“ auf Google, sind schon auf der ersten Ergebnisseite zwei bis drei Artikel enthalten, die genau diese Legenden erzählen; das Thema hat sich also wirklich durchgesetzt und zur Brand entwickelt.) Auch Fukuyama sieht ein Problem darin, dass sich linke Identitätspolitik zu sehr spezialisiert. Das Problem dabei ist weniger die Priorisierung (also die Frage mit welchem Spezialfall man sich nun beschäftigen solle), sondern der Verlust von Solidarisierungseffekten. Solidarität wird zwar auch für Spezialfälle gefordert – aber diese Art von Solidarität bedeutet dann ein schweigendes Akzeptieren, ein Zurücknehmen der eigenen Identität, und den Verzicht. Man braucht es ja weniger. Das kann ein Zeichen von Größe sein. Es hat aber in der Regel keinen mobilisierenden Effekt. Es stehen nun viele unterschiedliche Identitäten nebeneinander, versichern einander jeweils Solidarität – und lähmen sich dadurch. Denn man kann nu wenig weiterbringen, ohne die anderen Identitäten, mit denen man sich eigentlich solidarisch erklärt hat, in irgendeiner Form einzuschränken. Man kennt die Effekte auch als Whataboutism, man kennt die Situation als Lage aktueller linker Politik.
Eine Frage des Willens
So weit, so gut. Leider setzt Fukuyama dann auch noch hier zu einer Lösungsskizze an. Wenn wir mit den Spezialisierungen nicht weiterkommen, so sein Ansatz, dann müssen es eben größer gefasste Identitäten sein. Dazu sollten weder ethnische noch religiöse oder sexuelle Kriterien herangezogen werden, Fukuyama sieht hier eher die Nation als angemessene Dimension. Damit knüpft er nicht an nationalistische Ideen der Gegenwart an, sondern an die Nationalisierungsbestrebungen vergangener Jahrhunderte, in denen Nationalstaaten bürgerlichen Gegengewichte zu noch verbliebene Strukturen feudaler Herrschaften waren. Auch während der afrikanischen Dekolonisierung spielten Nationalstaaten eine ähnliche Rolle. Wenn es nun aber nicht ethnische oder andere abstammungsorientierte Merkmale sind, die diese Identität festmachen – wie kommt man dann dazu? Fukuyama schlägt eine Art Bekenntnis vor, eine Erklärung, dazugehören zu wollen – ähnlich wie sie im Rahmen US-amerikanischer Einbürgerungen abgegeben wird. Nachdem das allerdings keine große identitätsstiftende Kraft hat und auch nicht erlebbar macht, wozu man sich bekennt (im Idealfall zu einer liberalen Demokratie und deren Grundsätzen), schlägt Fukuyama dann auch noch eine Form der konkreteren Aktivität vor. Diese führt er nicht näher aus. Ich verstehe das so, dass Staaten auch wieder mehr von ihren Bürger_innen verlangen sollen. Das kann auf kultureller Ebene passieren – Fukuyama erwähnt auch die in Europa fast schon wieder vergessene Leitkultur-Idee von Bassam Tibi wohlwollend. Es kann aber auch praktischer ausgestaltet sein – da denke ich an Wehrpflicht und Zivildienst. Beides sind umstrittene Wege. Der Versuch, Leitkulturen zu definieren, führt geradewegs zurück ins heiß umstrittene Zentrum jeder Identitätsdebatte: Was ist richtig, was ist wichtig, und was machen all die toten weißen Männer hier? Und Zwangsmaßnahmen sind nicht gerade dazu geeignet, liberale und demokratische Werte zu vermitteln, nicht nur, weil sie selbst Zwang sind, sondern weil sie auf schlecht bezahlten Abhängigkeitsverhältnissen beruhen, in denen nur zu schnell Hackordnungen entstehen. In Europa haben und hatten wir schon viel davon – es hat wenig bewegt.
Oder bleibt es bei Unterordnung?
Der Aufruf, größer gefasste Identitäten anzuerkennen, ist aus streng identitätspolitischer Sicht auch nur ein weiterer Aufruf zur Unterordnung, ein eloquent formuliertes „Stellt euch nicht so an!“ und eine Reduktion jener speziellen Identitäten, die sich eben erst konstituieren wollten. Fukuyama hat jetzt aus praktischer Sicht wahrscheinlich recht, das Problem der Identitätspolitik löst er allerdings nicht. Eine logische Konsequenz daraus wäre, dass Identitätspolitik auf dem Holzweg ist. Und was uns jetzt noch immer fehlt, ist ein Mobilsierungsfaktor für jene größer gefassten Identitäten, der dann aber nicht als mörderisch ausschließendes Instrument gegen andere missbraucht werden kann. Das ist nichts neues. Aber es ist erkenntnistechnisch durchaus wertvoll, aus möglichst vielen unterschiedlichen Richtungen zu diesem Schluss zu kommen.