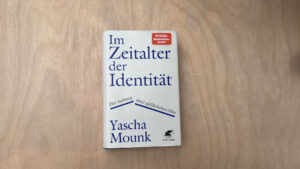Qual, sinnstiftend oder eh egal? – Drei aktuelle Texte beschäftigen sich mit Fragestellungen rund um Arbeit.
[dropcap type=”3″]M[/dropcap]iya Tokumitsu stellt im Jacobin Magazine unter dem Titel „In the Name of Love“ aktuelle Jobromantik an den Pranger: Das „Do what you love“-Mantra ist ihrer Argumentation nach eine günstige Strategie Arbeiterrechte pauschal unter den Teppich zu kehren – und zugleich eine Diskriminierung der Rest-Arbeiterklasse.
„Do what you love“ gibt vor, Arbeit zu veredeln und in sinnstiftende Höhen zu heben, nimmt ihr aber in Wahrheit den Arbeitscharakter und lässt all jene, die es sich nicht aussuchen können, dumm dastehen. Der Positivtitätsgedanke, dessen Spuren Tokumitsu von Konfuzius über Rabelais, Martina Navratilova und Oprah Winfrey bis zu Steve Jobs verfolgt, sei das Vergnügen einiger Privilegierter, die ihre erfolgreiche Freiheit auf dem Rücken anderer ausleben.
“Think of the great variety of work that allowed Jobs to spend even one day as CEO: his food harvested from fields, then transported across great distances. His company’s goods assembled, packaged, shipped. Apple advertisements scripted, cast, filmed. Lawsuits processed. Office wastebaskets emptied and ink cartridges filled. Job creation goes both ways. Yet with the vast majority of workers effectively invisible to elites busy in their lovable occupations, how can it be surprising that the heavy strains faced by today’s workers (abysmal wages, massive child care costs, et cetera) barely register as political issues even among the liberal faction of the ruling class?”
Es ist weniger das moralische Problem, das zählt, sondern die – in den meisten Fällen wohl ganz unbeabsichtigte – Beihilfe dazu, reale Sachzwänge zu ignorieren. Hier taucht wieder die Frage nach Sinn und Zusammenhängen auf der anderen Seite auf – für wen muss es funktionieren, damit es wirklich funktioniert? Reicht hier wirklich die eigene Perspektive? Sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben, haben andere gesagt.
Natürlich sind sich der Elite-Absolvent und der hoffnungsfrohe Gründer auch ihrer Verantwortung bewusst, das hören wir oft genug. Was dann meistens folgt, sind Appelle an die Politik. Und dann? Dann gibt es umgekehrt Appelle an den Unternehmergeist und Ankündigungen, Gewerbeordnungen zu lockern oder neue Fördertöpfe zu füllen, um auch aus Langzeitarbeitslosen Unternehmer zu machen. Wer einfach nur arbeitet, bleibt auf der Strecke.
[dropcap type=”3″]A[/dropcap]nders argumentiert Thomas Vasek, Chefredakteur des Hohe Luft-Magazins. In seinem aktuellen Buch „Work-Life-Bullshit“ argumentiert er gegen eine Trennung von Arbeit und Freizeit, gegen die Ansicht, Arbeit sei Zwang und Freizeit biete Menschen die Gelegenheit, sich zu entfalten.
Dabei schlägt er allerdings nicht in die “Do what you love“-Kerbe, er führt vielmehr den sozialen Wert von Arbeit ins Treffen. Arbeit schafft soziale Beziehungen, sichert Leben ab und gibt Menschen Gelegenheit, in dem was sie tun auf produktive Art und Weise besser zu werden.
Die Trennung von Arbeit und Freizeit ist weniger auf Arbeit und ihren Charakter zurückzuführen, sondern auf zeitliche und räumliche Einschränkungen und damit verbundene Ordnungen. Arbeit kann dann zum Zwang werden, wenn sie nur in einem Korsett geschehen kann – was sich in vielen Branchen aber schon aus rein praktischen Gründen ergibt. Eine auf Teamarbeit angewiesene in Gleitzeit arbeitende Handwerkerpartie wäre wohl wenig produktiv – oder würde gewaltigen administrativen Overhead verursachen.
Arbeit ist aber nicht immer gleich: Manchmal versetzt uns der gleiche Job in einen angenehmen produktiven Flow, in dem wir sonst nichts mehr mitbekommen, manchmal ist er schlicht nervtötend und manchmal bietet er entspannende Leerläufe. Der Unterschied zwischen Arbeit und anderem ist der, das Arbeit gemacht werden muss – und zwar so dringend, dass jemand bereit ist, für ihre Erledigung zu zahlen. Was dann natürlich wieder die Frage aufwirft, was jemand, der sich darauf eingelassen hat, bezahlt zu werden, in seinem Job noch verlangen und erwarten kann. – Allerdings unterscheidet Vasek auch zwischen guter und schlechter Arbeit: Gute Arbeit ermöglicht bereichernde Erfahrungen, steht im Einklang mit den eigenen Werten, vermittelt Anerkennung über Geld hinaus, fördert soziale Verbindungen und gibt unserem Leben einen verlässlichen Rahmen. – Das kann für viele Arten von Jobs zutreffen.
Den Weg dorthin sieht Vasek in Anerkennung, Respekt, Wertschätzung und Flexibilität. Das sind Themen die auch aus ganz anderen Sichtweisen im Moment die Diskussion um Arbeit und ihren Sinn beherrschen. Open Business, Enterprise 2.0, neue Führungsmodelle – ist alles in der Pipeline; fraglich ist nur, welche Branchen oder Unternehmensgrößen dann wirklich etwas davon haben werden. Schliesslich kämpft auch die gesamte Enterprise 2.0-Industrie schon lange darum, ihre Visionen auf den Boden zu bringen – aber Vaseks Buch liefert Argumente dafür, warum dieser Weg ein sinnvoller ist. Arbeit ist nichts schlechtes, sie muss nur noch besser werden…
[dropcap type=”3″]O[/dropcap]b das gelingt, bezweifelt Umair Haque in seinem Blog. Die Generation F sei jetzt gefordert, schreibt er. Eine sinnleere, künstlich am Leben erhaltene Zombieconomy ist dem Growthism verfallen und trägt nichts dazu bei, Lebensstandards zu verbessern. Arbeitslosigkeit steigt, und selbst dort, wo Jobs noch zu haben sind, haben Produktivitäts- und Gehaltsentwicklung jeden Bezug zueinander verloren. Der vielbeschworene War for Talents – angeblich stehen Millennials, der Generation Y, oder wie man sie auch nennen möchte, alle Wege offen; sie können sich Jobs aussuchen und wollen nicht mal arbeiten – nutzt in erster Linie auch den Unternehmen: Dort, wo ein Mitarbeiter einen gewaltigen Produktivitätsunterschied machen kann, zahlt es sich schon aus, in diesen Krieg und dann auch ein wenig in Mitarbeiterbindung zu investieren. Zum Vergleich: In traditionellen Branchen liegt derjährliche Gewinn pro Mitarbeiter bei 24.000 Dollar, Google schöpft aus jedem Mitarbeiter 404.000 Dollar. Immerhin das 18fache – und beides sind Technologieunternehmen… (die Zahlen stammen aus Nicolas Clasens “Digital Tsunami”).
Haques drastische Worte: “Generation F is getting a deal so raw that no one but a politician or a serial killer could offer it with a straight face. So let’s call it what it is. Not just unfair—but unconscionable. The world’s so-called leaders have more or less abandoned this generation. Think that’s unkind—maybe even unfair? Then here’s a more generous take. The world’s leaders have coolly, calmly, rationally, senselessly decided that bankers, CEOs, lobbyists, billionaires, the astrologers formerly known as economists, corporate “people”, robots, and hedge funds are worth more to society than…the young.
The world’s leaders are letting the future crash and burn.“
Wofür das F in Generation F steht, ob für F***ed oder Future, hängt davon ab, ob es gelingt, neue Kriterien für Fortschritt zu definieren, neue politische Institutionen, neue Herrschaftssysteme und neue Finanzsysteme zu schaffen. Jede Generation hat ihre Herausforderungen, schreibt Haque. Und es klingt so, als wären diese Herausforderungen schon durchaus mit jenen von Nachkriegsgenerationen vergleichbar – nur subtiler und gemeiner…