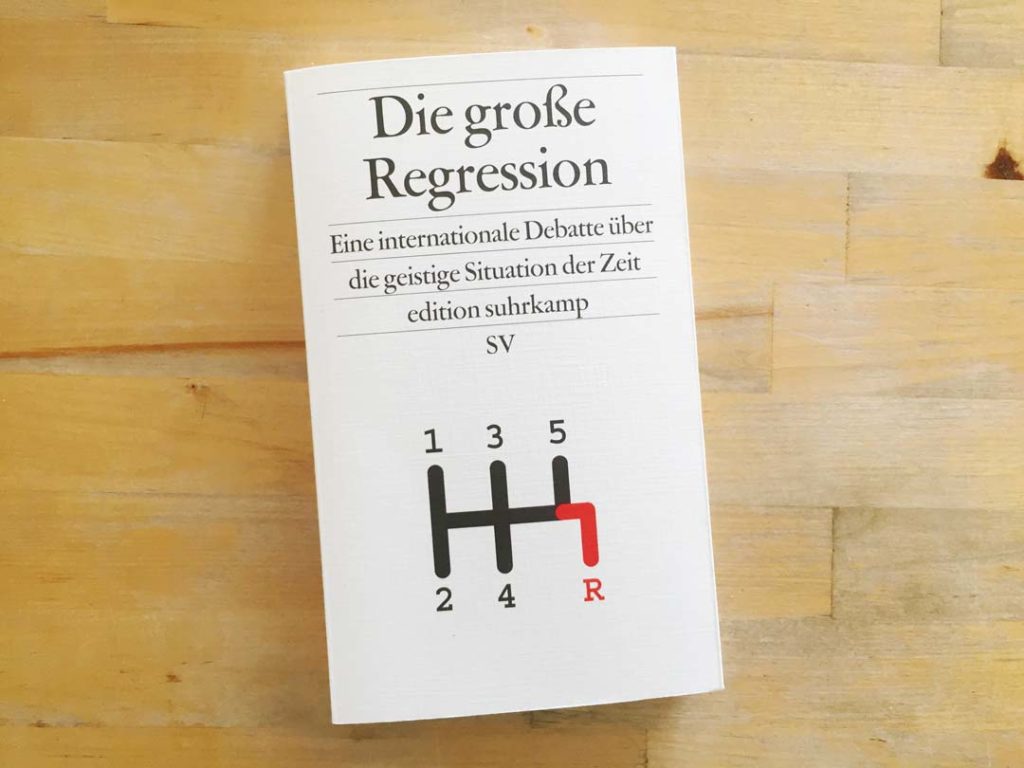Fangen wir mit der größten Schwäche an: Der Begriff des Neoliberalismus zieht sich wie eine Nebelgranate durch alle 300 Seiten. Neoliberalismus an sich ist schon nicht der am allerschärfsten definierte Begriff, diesen Begriff aber zum Leitparadigma der letzten Jahrzehnte zu erheben – gerade in Europa, in einem Europa, das in den vergangenen dreißig bis vierzig Jahren sehr bunte Regierungen gesehen hat – beraubt diesen Begriff der letzten Schärfen, die man noch darin hätte vermuten können.
Trump, Brexit: “Wie konnte das passieren?” – Dabei kannten sie Kurz noch gar nicht …
In dem Sammelband „Die große Regression – Eine internationale Debatte über die geistige Situation unserer Zeit“, der gleich in vierzehn Sprachen erschienen ist, beschäftigt sich eine Reihe tendenziell linker internationaler Intellektueller mit der Frage, wie das so schiefgehen konnte. „Das“ waren zu diesem Zeitpunkt der Wahlsieg Trumps und die Entscheidung für den Brexit. Schiefgehen bezieht sich darauf, dass beide Entscheidungen aus kaum einer Perspektive rational nachvollziehbar sind. Niemand profitiert realistisch und ökonomisch betrachtet von diesen Entscheidungen – wie konnte es also dazu kommen?
Die merkwürdigen Allianzen aus Milliardären und unzufriedenen ArbeiterInnen oder Arbeitslosen, die es dem Establishment oder denen da oben zeigen wollen, sind ein seltsamer Schmelztiegel, in dem scheinbar alles geht. Politische Kategorien sind über den Haufen geworfen, flexible Phantasieidentitäten kochen einander digital hoch und erzeugen dabei in erster Linie ein wenig Schaum und Gestank – viel mehr Spuren bleiben nicht zurück. Wo soll man da als nachdenklicher Mensch mit einer doch grundsätzlich stabil linken Haltung ansetzen?
Ist es jetzt Wirtschaft oder Politik?
Ein Punkt, der sich durch fast alle Texte zieht, ist die Vermischung oder Verwischung nicht nur von links und rechts, sondern auch von Politik und Wirtschaft. Es ist nicht klar, wo die herrschende Klasse zu finden ist und wo damit Verantwortung, Zurechnungsfähigkeit und Gut und Böse zu finden sind.
Einerseits sind es Regierungen, andererseits Konzerne. Regierungen sind zwar gewählt, richten sich – dem verkürzt hier wiedergegebenen Verständnis der AutorInnen nach – oft nicht an den Interessen jener aus, die ihre Wähler sein sollten. Konzerne sind zwar nicht zwingend die traditionelle herrschende Klasse (sie können auch neu entstehen), haben aber, gemessen daran, dass sie nur ihren eigenen Interessen verpflichtet sind, sehr viel Macht und Möglichkeiten.
Darin ein Problem zu sehen, ist vergleichsweise neu. Kropotkin nannte die Entstehung internationaler Postdienste noch als ein Musterbeispiel funktionierender Anarchie: Als im 19. Jahrhundert sind gesetzlichen Grundlagen für grenzüberschreitenden Postverkehr geschaffen wurden, geschah das nicht nach den Vorgaben und Interessen von Regierungen und anderen Herrschenden, Spezialisten der Post selbst diktierten aufgrund ihrer Erfahrungen und der Bedürfnisse ihres Geschäfts die neuen Regeln. Autorität hatte also nicht der, der sie Kraft eines Amtes beansprucht, sondern der, der natürliche Autorität und echte Expertise in seinem Gebiet hat. – Diese frei definierte Autorität war auch für Bakunin eines der Kernstücke gelingender Anarchie. Heute erinnert das Beispiel der Post an Schreckensvisionen von an keine lokalen Rechte gebundenen Schiedsgerichte, die bei internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten eingreifen sollen.
“Progressiver Neoliberalismus”
Die Frage bleibt im Sammelband unbeantwortet, neue Feindbilder der Arbeiterklasse müssen anderswo gesucht werden. Und sie finden sich in einem zweiten Punkt, der sich ebenfalls in mehreren Varianten durch den Sammelband zieht. Seine prägnanteste Formulierung findet er in dem Beitrag der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser: Sie spricht von einem „progressiven Neoliberalismus“. Das ist ein problematischer Begriff. Neoliberalismus, sonst kühl, profitorientiert und asozial konnotiert, erhält mit dem Adjektiv „progressiv“ eine gestalterische, nachdenkliche und fast schon wärmende Komponente. Progressiv ist, wer verändern will, weil das Bestehende Unbehagen verursacht – sei es aufgrund von Gerechtigkeitsfragen, wegen fehlender Zukunftsperspektiven oder aus Sorge um die Umwelt. Eines der natürlichen Habitate der progressiven Neoliberalen sind Start-Up-Blasen aller Art; der Prototyp ist der schwulenfreundliche, vegane, sich nachhaltig ernährende und kleidende Gründer, der mit einer (sozial relevanten) Idee (idealtypisch im Hightech-Bereich) auf den Exit hinarbeitet.
In Frasers Worten: Die Verbindung aus „echten progressiven Kräften“, einer „wissensbasierten Wirtschaft“ und dem Finanzwesen ist das unheimliche neue Feindbild. Es ist ein angreifbares Feindbild, das viele Perspektiven bietet und sich aus vielen Perspektiven zum Feindbild eignet. Reibungspunkte funktionieren für Wertkonservative, Industrielle, ihre ArbeiterInnen, Gewerkschaften, Arbeitslose und wirtschaftlich Ausgegrenzte, für andere Formen konservativer Wirtschaft – und für Regierungen und Behörden, die angesichts rasanter Entwicklungen zwar nicht ihre reale Macht, aber ihre Definitionsmacht verlieren.
Der progressive Neoliberalismus ist die Zuschreibung einer „neuen“ „Elite“, der gegenüber auch das alte und scheinbar allmächtige Establishment alt aussieht. Hier werden Kapital und Menschenmassen auf eine Art und Weise bewegt, die noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wäre.
Multifunktionales Feindbild
Allerdings passt das Bild des progressiven Neoliberalen nicht nur auf den suberfolgreichen Turbokapitalisten. Es trifft ebenso auf zahllose Formen des Mikrokapitalismus zu, auf unabhängige, selbstständige und in diversesten Branchen arbeitende Klein- und Mittelunternehmer.
Es passt auf jeden, der sich aus verschiedenen Gründen davon verabschiedet hat, entweder rein persönlichen Profit mit geringstem Aufwand oder Arbeitsplätze für andere als oberste Maxime seines eigenen Handelns zu sehen.
Die Feindbildlogik mag stimmen; ich habe allerdings meine Zweifel, ob genuin linke Perspektiven hier einen Ausweg zeigen können: Der progressive Neoliberale ist ebenso der Selbstermächtiger wie der Selbstausbeuter. Das ist auch eines meiner Grundprobleme mit zeitgenössischen linken Ansätzen von Wirtschaftspolitik, die sich, wenn man die Folklore beiseite lässt, kaum von liberalen Ansätzen unterscheiden. „Selbst” ist zugleich gut und schlecht, im Kollektiv besser als in der individuellen Variante, und der individuellen Variante werden stets auch kollektive Zwänge unterstellt.
Byung Chul Hans Psychopolitik lauert hinter einigen Absätzen des Sammelbands, ebenso Foucaults Disziplinierungsanalysen. Der Rückgriff auf Foucault sollte eigentlich schon hellhörig machen – schließlich schrieb Foucault in den siebziger Jahren, als weder Prekariat noch Start-Up-Blasen in Mode waren. Wer ein bisschen weiter zurückgeht, wird noch viel mehr ähnliche Gedanken finden. Ich kann etwa folgendes in die Waagschale werfen: Es „ist auch die Knechtschaft eine innerliche geworden: Man hat jene Heiligkeiten in sich aufgenommen, sie mit seinem ganzen Dichten und Trachten verflochten, sie zur ‘Gewissenssache’ gemacht, sich eine ‚heilige Pflicht‘ aus ihnen bereitet.“ (Es) „hat den Menschen recht eigentlich zu einem ‚Geheimen-Polizei-Staat‘ gemacht. Der Spion und Laurer ‚Gewissen‘ überwacht jede Regung des Geistes, und alles Tun und Denken ist ihn eine ‚Gewissenssache‘ d.h. Polizeisache. In dieser Zerrissenheit des Menschen in ‚Naturtrieb’ und ‚Gewissen’ (innerer Pöbel und innere Polizei) besteht“ er. Diese Textstellen, die geradezu wortgleich auf die linke Perspektive auf den Kleinunternehmer passen, der seine Freiheit mit Arbeit erkauft (die natürlich in gewissem Maß der Freiheit im Weg steht), stammt nicht aus einem Start-Up-Report, sondern aus Max Stirners „Der Einzige und sein Eigentum“. Ein Text, der immerhin schon 1844 erschien.
So neu ist der Gedanke eine kontrollierenden Instanz, die aus verschiedenen Gründen verinnerlicht erscheint, also nicht. Der Gedanke lässt sich nur schwer auf aktuelle wirtschaftliche oder politische Entwicklungen zurückführen – und er war schon da, bevor das Kommunistische Manifest erschien (1848).
Die Wende zum Religiösen mag ein wenig verwundern. Allerdings schreibt in Regression ja auch Bruno Latour mit – und der kritisiert Wirtschaftshörigkeit ja schließlich als Religionsersatz und entwirft mit dem (seinen Angaben nach von Sloterdijk übernommenen) Monogäismis-Konzept quasireligiöse Gegenideen.
Argumentiert wird ja außerdem schon länger nicht mehr – eher gestaunt. Und das ist schließlich auch eine eher religiöse Beschäftigung.
Der Katholik ist übrigens in Stirners Auffassung jemand, der sich gern mit Vorschriften zufrieden gibt, der etwas tut, weil es sich so gehört, der tut, was sich gehört – aber nicht mehr. Es ist der Dienst-nach-Vorschrift-Mensch, der für seine vergangene Dienstbarkeit dann lebenslanges Arbeitslosengeld beziehen möchte.
Linke Wirtschafts- und Gesellschaftsentwürfe werden immer mehr zu einem archäologischen Sport. Sie beschreiben eine Welt, deren logische Grundlagen vor hundert Jahren aktuell waren. Menschen, die auf ihre Rechte (als Arbeitnehmer, also auf Mittagspause, 13. und 14. Gehalt, Zuschüsse bei der Sozialversicherung und vieles mehr) pochen, feiern und zementieren damit ihre Abhängigkeit.
Gerade aus österreichischer Perspektive: Das immerwährende Donauinselfest, bei dem der Staat Menschen unterhält und versorgt (nachdem er ihnen zuvor Steuergeld abgenommen hat), ist halt auch keine valide Zukunftsperspektive.
Eher als bei Gewerkschaften, Arbeiterpädagogen oder ziellosen Gelegenheitsdemonstranten mit PR-Talent sehe ich Perspektiven dann doch mehr bei Menschen, die gleichzeitig machen und denken können. Das ist mein Verständnis von politischem und wirtschaftlichem Handeln und von sozialem Gewissen. Am einfachsten äußert sich das in selbstbestimmter wirtschaftlicher Tätigkeit. Dazu braucht man weder das Kollektiv noch das unternehmerische Sendungsbewusstsein oder gar die Rolle als selbstloser Arbeitgeber.
Dann könnten wir uns auch irgendwo unterwegs treffen.