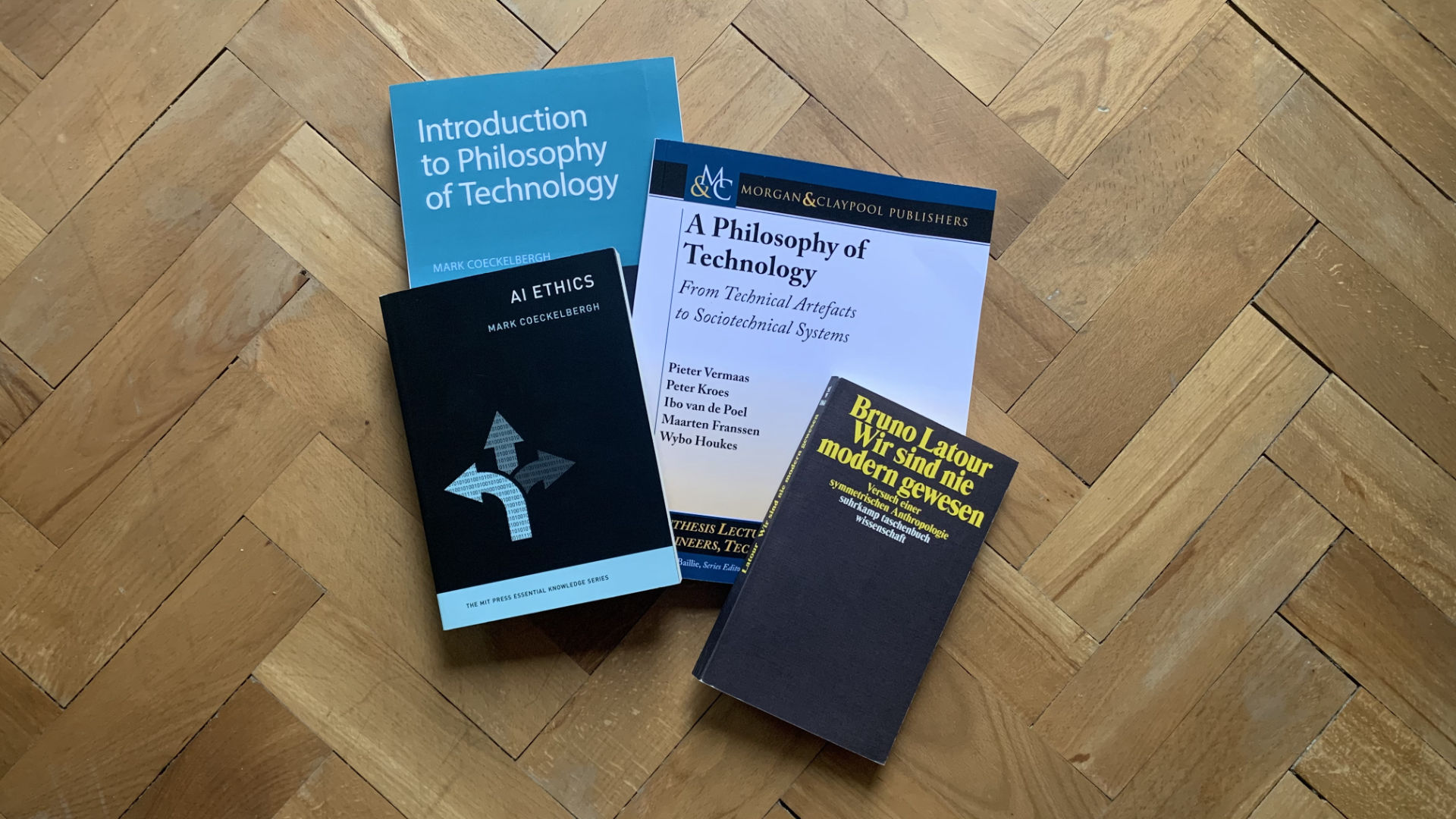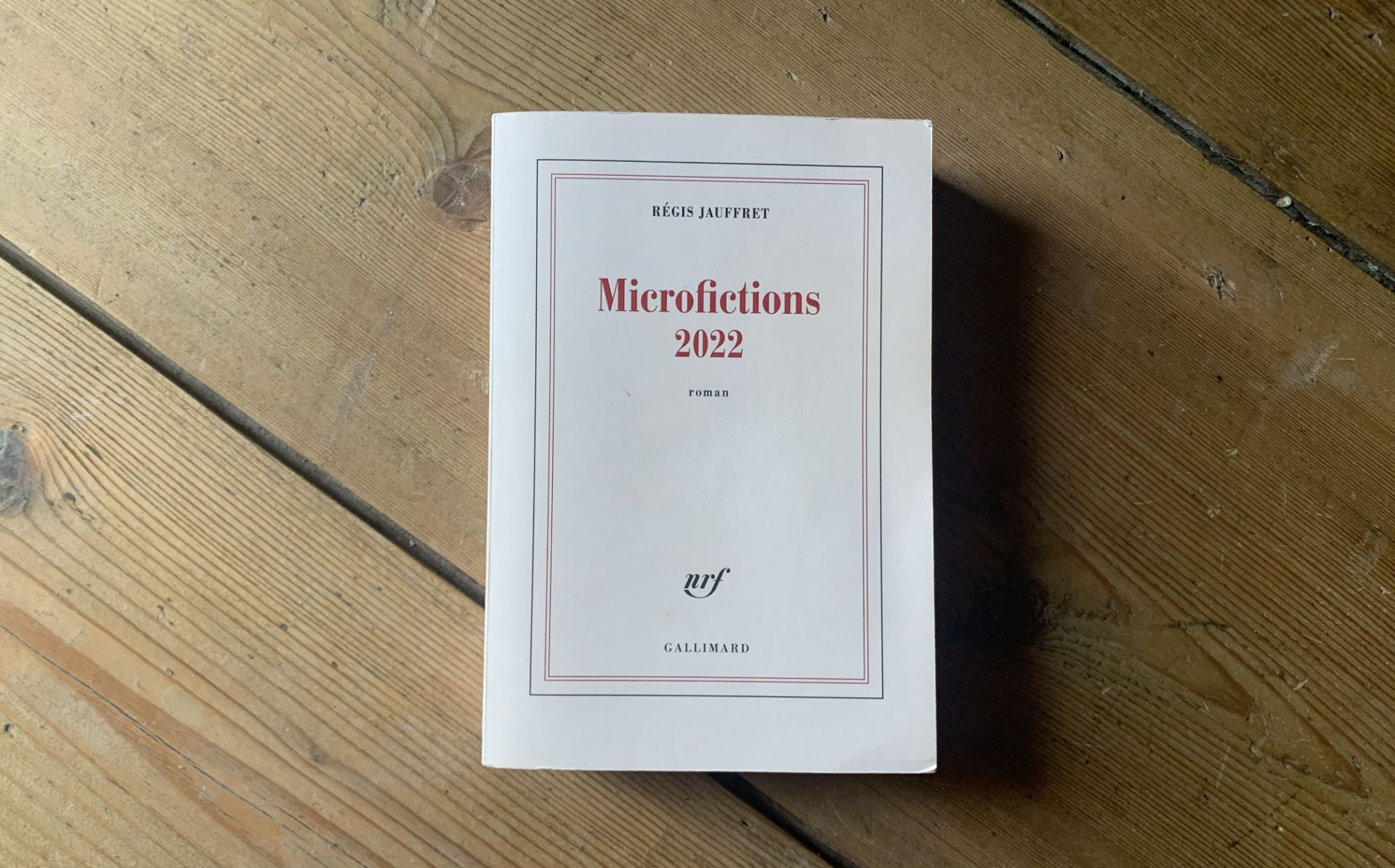Philosophie und Technik, Cyberphilosophie, Digitalisierung und Philosophie – vor zwanzig Jahren herrschte hier noch großes Fremdeln. Ansätze zu Philosophie und moderner Technik waren Nischenprojekte, die Cybervisionären erdrückt wurden. Jeder kannte Dystopien, böswillige Roboter oder das Wort Singularität – aber kaum jemand wusste, was es bedeutet. So wie kaum jemand wusste, dass der Film “I, Robot” auf einem Buch des Science Fiction-Autors Isac Asimow beruht, der in anderen seiner Erzählungen schon früh die sogenannten Roboter-Gesetze entwickelt hat. Roboter, kurz zusammengefasst, dürfen Menschen nicht gefährden oder verletzen – es sei denn, es wäre zum Wohl der gesamten Menschheit erforderlich.
Diese Perspektive auf Technologie als Bedrohung, die man in den Griff bekommen muss, dieser Frankenstein-Komplex, der außer Kontrolle geratene Monster sieht, hat sich für lange Zeit durchgesetzt.
Für die vergangenen zehn bis fünfzehn Jahre schien es, als könnten neue positive Technologie-Visionen entstehen. Schnelle und direkte Kommunikation versprach Transparenz und Demokratisierung, Produktivitätssteigerungen bedeuteten Arbeitserleichterungen, Medizin versprach ein technisiertes und verlängertes Leben, Data Science versprach bessere Entscheidungen, Propheten neuer digitaler Zeitalter stellten neue Symbiosen von Mensch und Maschine in Aussicht, die dank dieser einzigartigen Kombination von Skills alles bewältigen konnten.
Diese von vielen immer schon mit Zweifel beäugte Optimismus bröckelt. Transparenz und Demokratisierung steht Überwachung gegenüber, Produktivität bringt Jobverluste mit sich, alle Daten und Algorithmen der Welt haben in der Praxis noch wenig zu praktischen Lösungen drängender Probleme beigetragen – andere Propheten sehen daher die Zukunft nicht in der Kontrolle digitalisierter Cyborgs, sie sehen gegen alle Mittel resistente Mikroben als die Nutznießer multipler Krisen, die unsere aktuelle Zivilisation verändern. Noch wichtiger als negative Folgen von Technologie ist das wachsende Bewusstsein, dass auch (und gerade) Technologie entgegen aller Hoffnungen nicht alle Probleme lösen kann. Nach Angst und Begeisterung wächst jetzt also Enttäuschung.
Was soll Technikphilosophie unter diesen Voraussetzungen leisten? Vielfältige Perspektiven auf Technologie zwischen technologischem Determinismus (Technik bestimmt Mensch und Gesellschaft) bis zu sozialem Konstruktivismus (soziale Einflüsse bestimmen das Entstehen, das Verständnis und die Funktionsweise von Technologien) bieten eine Fülle von Erkläransätzen. Technik kann aus allen mögliche Perspektiven analysiert, kritisiert oder als Erlöser stilisiert werden. Technik kann Problem und Problemlöser sein. Technik kann Erklärhilfe und zu erklärendes Phänomen sein.
Diese Flexibilität macht sich in zeitgenössischen Ansätzen zu Technikphilosophie bemerkbar. Seriöse Ansätze haben die Zeit der Visionen und Prophezeiungen hinter sich gelassen, zentrale Frage ist eher, welche technikphilosophischen Ansätze zur Klärung konkreter Themen herangezogen werden können.
Solche Themen können ihrerseits wiederum eher visionär sein (“Wird Künstliche Intelligenz die Menschheit unterdrücken?”) oder spezifische Ausprägungen sein (“Wer verantwortet die Erkenntnisse von unsupervised machine learning?”). Aus einzelnen technophilosophischen Perspektiven lassen sich viele stringente Antworten formulieren, die Argumente aus anderen technophilosophischen Perspektiven sind aber meist zu gut, um diese Argumente einfach gelten zu lassen.
Man ist sich einig, dass Technik, technische Artefakte, soziotechnische Systeme und all die anderen Konzepte hybrid, dual oder sonstwie mehrschichtig sind. Es sind also immer unterschiedliche Auffassungen möglich, keine Erklärung ist endgültig.
Gibt sich Technikphilosophie damit zufrieden?
Viele Grundlagenwerke, seien es umfassende Lehrbücher wie jene von Mark Coeckhelberg, Einführungen für Ingenieure (Vermaas et al) oder themenspezifische Monographien wie etwa Rob Kitchins Analyse zu Data Science stellen deshalb auch historische Bezüge her, zeichnen relevante Perspektiven aus der Vergangenheit nach, und skizzieren dann zukunftsorientierte Forschungspläne, ohne dabei weiter konkret zu werden. Die Aufrisse künftiger Programme für Technikphilosophien sind Skizzen, die viele Fragen aufwerfen. Nicht immer ganz klar ist, ob und wie weit es auch Antworten geben soll oder kann.
Ein gängiges und in verschiedensten Komplexitätsstufen diskutiertes Beispiel sind Daten und Data Science. Hilft Data Science zu besseren Entscheidungen? Ist unsupervised machine learning unabhängig vom Menschen? Sind Daten in irgendeiner Form besondere und priviliegierte Erkenntnisobjekte? Viele Analysen dieses Fragenkomplexes konzentrieren sich auf unterschiedliche Formen von Bias: Daten sind nicht neutral, Algorithmen sind nicht neutral, Fragestellungen und Interpretationen sind nicht neutral.
Auf diese Feststellungen können sich nahezu alle technkiphilosophischen Strömungen einigen. Relevante Fragestellungen gehen allerdings erst von dieser Einigung aus: Können wir Bias analysieren oder gar eliminieren, ohne dabei in einen endlosen Bias-Regress zu verfallen? Kaum ist ein Bias-Motiv entlarvt, lässt sich entlarven, welcher Bias hinter dieser Entlarvung steckt. Ist Bias kein Problem, weil er ohnehin praktisch unvermeidliches Element einer Außenwelt ist, die auch in deren Abstraktion in Daten erhalten bleiben soll? Ist es ausreichend, wenn das Bias– Problem bewusst ist und gegenebenfalls zur Relativierung von Ergebnissen herangezogen wird?
Die praktischen Folgen dieser Überlegungen sind weitreichend. Als theoretisches philosophisches Konzept sind diese Ideen allerdings banal. Auch der mögliche Umgang mit potenziellen Konsequenzen ist grundsätzlich banal und bedürfte keiner tiefergehenden philosophischen Analyse.
Aber ist das alles, was Technikphilosophie leisten kann?
Ich habe zwei Vermutungen dazu.
Die erste: In vielen Konzepten zur Technikphilosophie stehen nach wie vor entweder Heidegger, Wittgenstein oder Dewey im Hintergrund. Heidegger schaffte es, trotz seiner abstrakten und heute manchmal esoterisch anmutenden Denkweise, die Trennung von Natur und Technik, von Vorhandenem und Zuhandenem, auf den Punkt zu bringen. Technikphilosophie mit Heidegger lässt sich noch heute auf viele Fragestellungen anwenden. Aber es ist schwer, mit ihr über diese Trennung hinauszugehen.
Wittgenstein ist für die Analyse von Sprachspielen bekannt – Spiele haben Regeln, Regeln sind Gesetzmäßigkeiten, ähnlich wie wir sie in technischen Abläufen beobachten können. Außerdem ist Wittgensteins Werk vielschichtig genug, um für praktisch alles herangezogen werden zu können.
Dewey steht in der Tradition des Pragmatismus, der Nützlichkeit und Effektivität als primäre Kriterien für alles, auch für Wahrheitsfragen, ansieht. Das ist sehr nah an Vorstellungen von technologischer Rationalität, für die Funktionieren (nicht etwa gut/böse, sinnvoll/sinnlos, wertvoll/wertlos) das Leitmotiv ist.
Alle drei haben die Anfänge von Technik und Technikphilosophie miterlebt, Kriege, den Umbruch von Staatsformen miterlebt. Dewey wurde fast hundert Jahre alt, lehrte schon seit Mitte der 1880er Jahre und leitete noch in den 1930er Jahren eine zivile Kommission, die die Vorwürfe des stalinistischen Schauprozesses gegen Trotzki untersuchte.
Es könnte nützlich sein, zu den Anfängen der pragmatischen instrumentalistischen Theorien zurückzugehen und von dort aus mit den heute aktuellen Anforderungen neue Ansätze zu entwickeln. Pragmatismus (“Wahr ist, was nützlich ist”) lässt sich leicht als Gedankenspiel abtun, das wohl nicht ganz ernst gemeint sein kann. Dagegen lässt sich einwenden: Vielleicht erfasst diese ganz kurze und vor allem auf die Wahrheitsfrage konzentrierte Version nicht alle Facetten einer so komplexen Fragestellung – aber lässt sie sich widerlegen? William James, Charles Peirce und eben auch John Dewey haben mit ihren Kritikern hier eine Reihe von Verfeinerungen und Details entwickelt. Gerade im Bereich der Technologie, wo keine metaphysischen Grenzen überschritten werden müssen, wo Abläufe und deren Auswirkungen verstanden werden möchten, kann so en grundsätzlich einfaches Konzept nützlich sein. Natürlich wird es nicht ausreichen, ganz auf Transzendenz zu verzichten – jetzt lässt sich ja schon die einfache Frage der Nützlichkeit nicht beantworten, wenn nicht abgeklärt wird, was wem nützlich sein soll, wer darüber entscheidet und in welchem Kontext was überhaupt als nützlich gelten kann. Pragmatismus steht immer auch in direkter Verbindung zu Agency, also zu Fragen der Handlungsfähigkeit und damit auch Unabhängigkeit.
Daraus lässt sich, in Verbindung mit konkreteren Fragestellungen wie dem Bias-Problem in Data Science, ein konkreteres Forschungsprogramm stricken. Ich arbeite daran.
Die zweite Vermutung ist etwas pessimistischer.
Vielleicht liegen wir einfach grundsätzlich falsch. So falsch, dass sich das nicht mal sagen lässt. Vielleicht erfordern technologische Veränderungen, die schneller und umfassender werden, neue Paradigmen, die ganz anders sind als das, was wir für technisch-wissemnschaftliche Rationalität halten. Frühere Philosophengenerationen waren mystischen und religiösen Denkmustern verhaftet. Andere hielten Elemente- oder Säftelehren für nüchterne state of the art-Wissenschaft.
Und vielleicht sind unsere aktuellen Versuche, Technik, Digitalisierung, Technologie konzeptionell in den Griff zu bekommen, in Zukunft ebenso unverständlich und kaum noch als Logik rekonstruierbar; vielleicht ist später, bei fortlaufend schneller Entwicklung, völlig unverständlich, was mit dem Begriff von Technik gemeint gewesen sein soll und wovon, von welcher nichttechnischen, sozialen, natürlichen Welt sich dieses merkwürdige Konzept abgegrenzt haben soll.
Das kann natürlich auch passieren. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie sich diese Idee für aktuelle konkrete Forschung operationalisieren lässt …