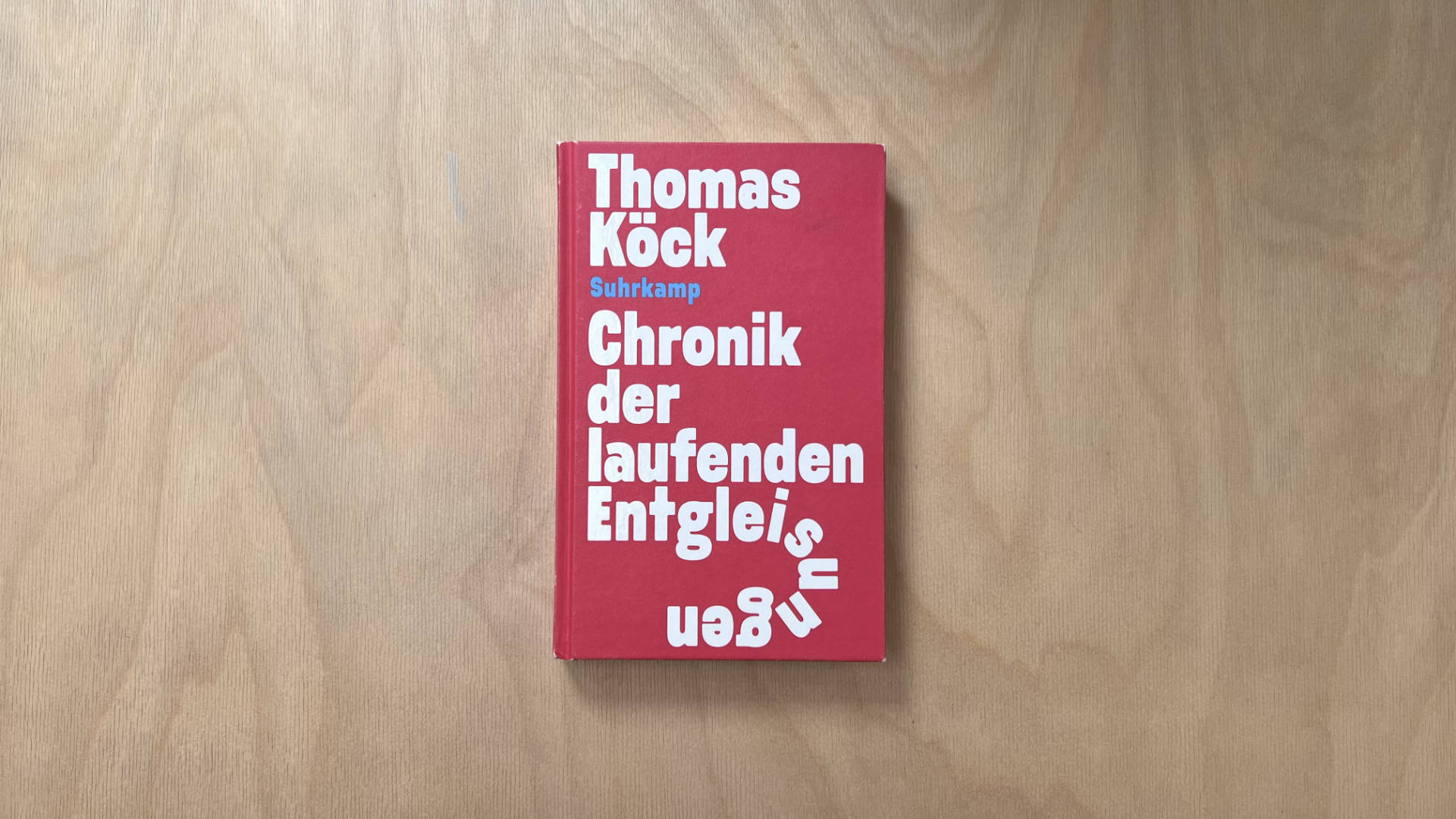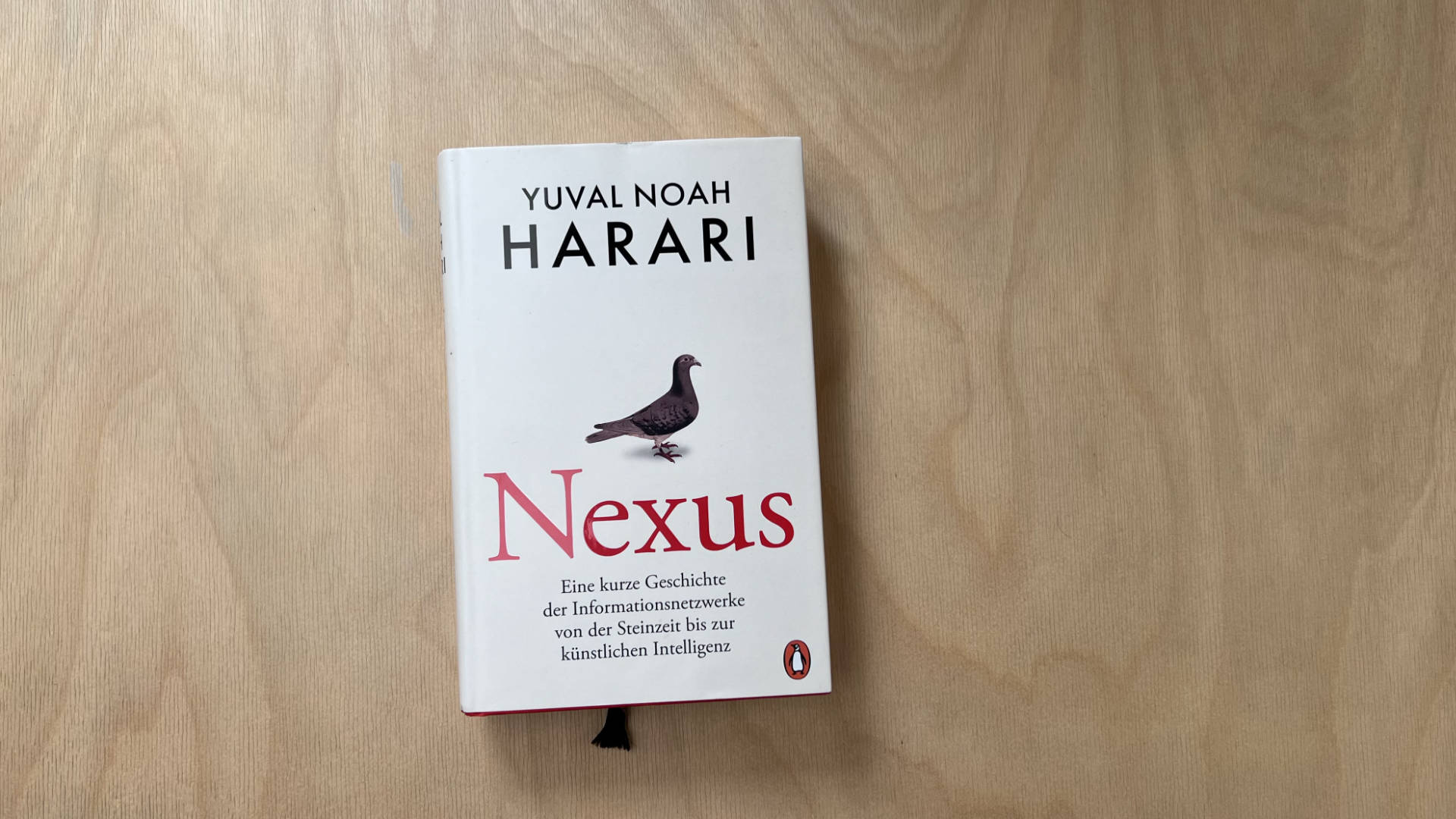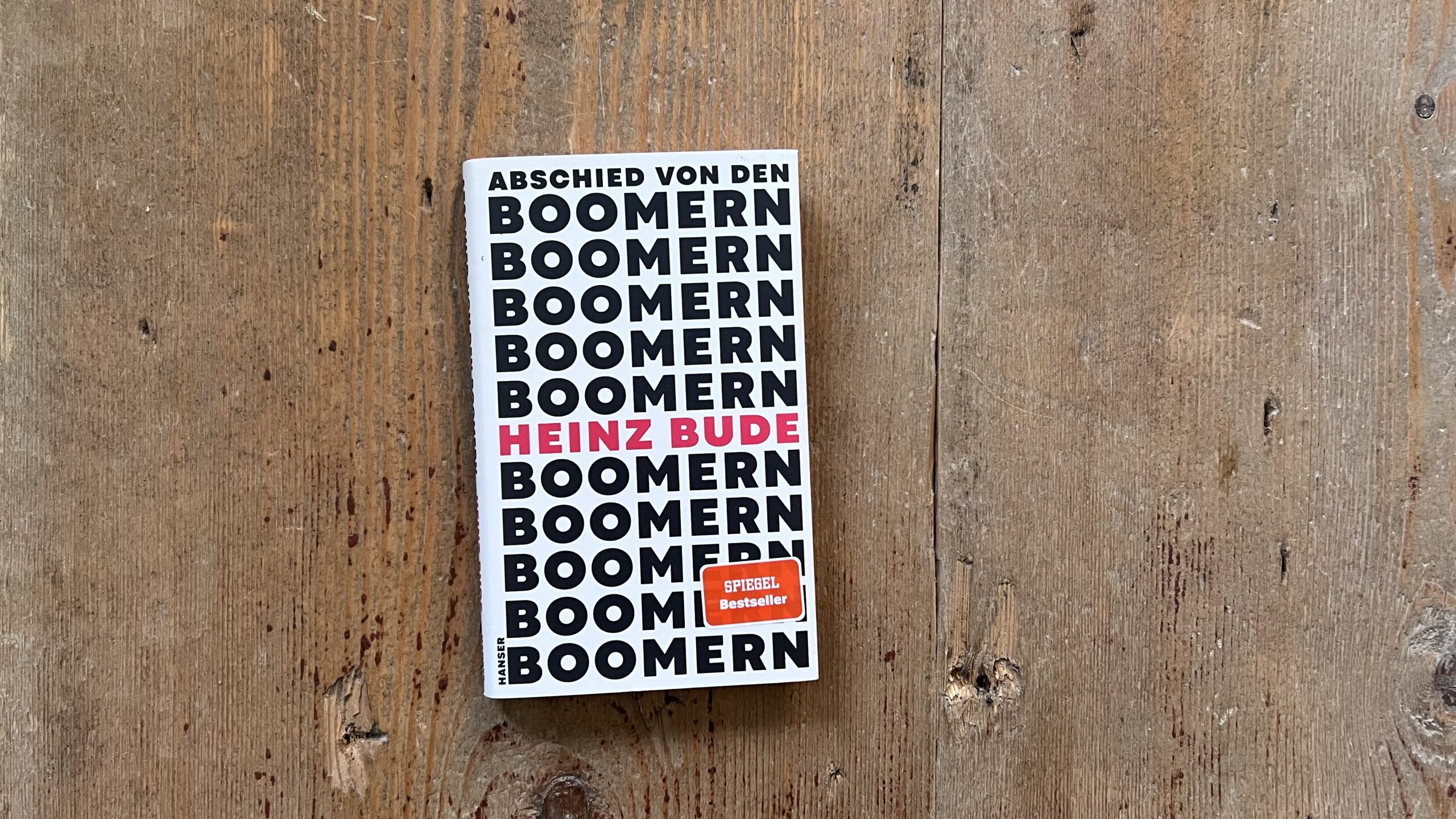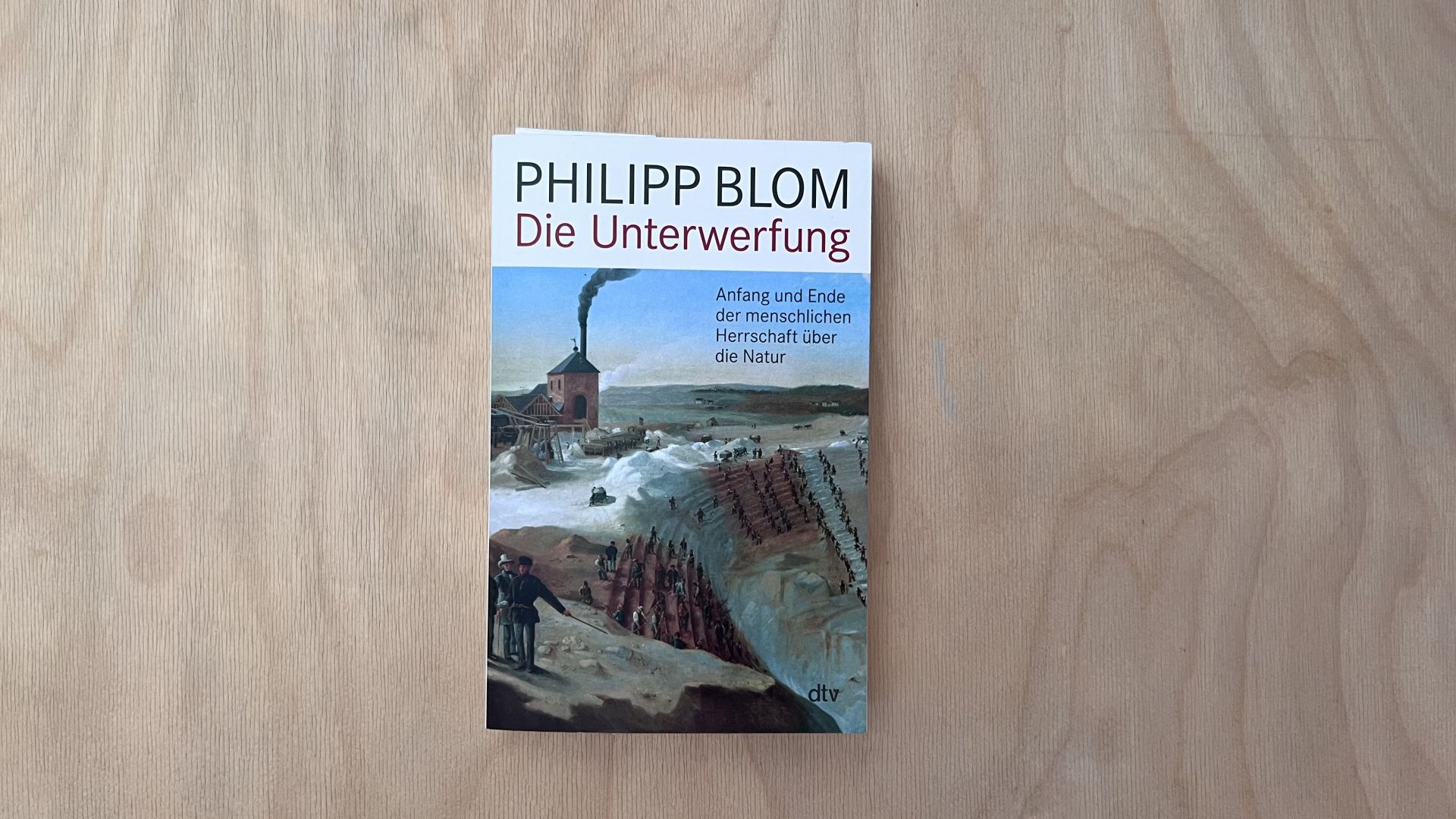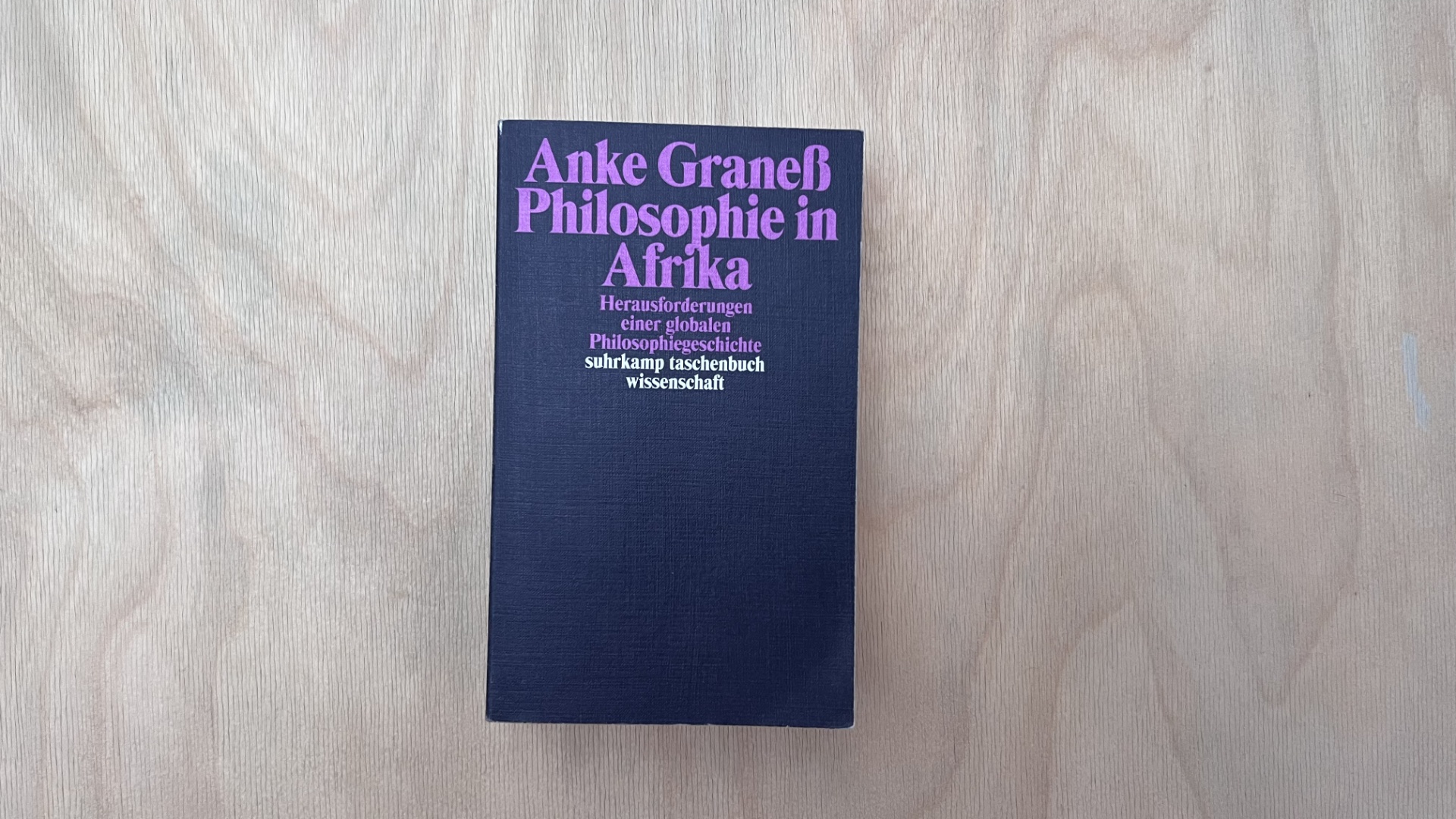Wer stolz „Ich glaube an Fakten” sagt und sich dann für einen rationalen Wissenschaftsfreund hält, sollte Heisenberg oder Schrödinger lesen. Heisenberg bezeichnet Zeitgeist als ebenso objektive Tatsache wie andere wissenschaftliche Tatsachen, Schrödinger nennt es eine bequeme Vorstellung, die Welt wäre da draußen und warte darauf, erkannt zu werden. Sprechen hier zwei bislang als solche unentdeckte Vorläufer postmoderner Wissenschaftskritik? Oder doch eher zwei Wissenschaftler, die ihre Disziplinen über ihrer Zeit hinaus durchgespielt haben und an die Grenzen des Wissens und auch gleich der Fragen gestoßen sind?
Für Schrödinger entsteht die Welt der Wissenschaft durch Statistik. Statistik schließt einen Beobachter ein, jemanden, der Daten sammelt, entscheidet, welche Daten gesammelt werden, in welchen Zeiträumen sie betrachtet, nach welchen Kriterien sie aggregiert werden. Statistik bringt Ordnung ins Chaos, sie schließt Ausreißer aus und schafft Normalität. Und Statistik schafft Annäherungen. Sie setzt bestimmte Bereiche innerhalb einer Normalverteilung als relevant, Sachverhalte an den Rändern derselben Normalverteilung sind vernachlässigbar.
Damit kratzt Schrödinger gleich an zwei Prinzipien naiver Wissenschaftlichkeit: Gerade die vermeintlich exakten Wissenschaften geben nur Wahrscheinlichkeiten an, ihre Gesetze sind Beobachtungen von Häufigkeiten auf Normalverteilungskurven, Interpretationen und Projektionen. Und zweitens: Weder Wissenschaften noch ihre Objekte sind vom Wissenschaftler unabhängig. Der Beobachter ist immer Teil der Beobachtung; der Beobachter und sein Standpunkt schaffen das Beobachtete.
Was heute, zahlreiche missbräuchlich gezogene Konsequenzen später, als postmoderner Schmus gelesen werden kann und antipostmoderne Tiraden befeuert, ist eine der Grundlagen der Quantenmechanik. Für Philosophen oder Sozialwissenschaftler ist das weder Hexerei noch wesentlich neu. Diese vermeintliche Revolution hat sich seit den Vorsokratikern öfters wiederholt und sie kann unterschiedlich interpretiert werden. Mal stärkt sie den Menschen als Maß aller Dinge, manchmal schwächt sie ihn als unfähig, die wahren und relevanten Dinge zu erkennen.
Im Gegensatz zu Fehlinterpretationen, die die Beobachterabhängigkeit von Fakten als unseriöse Entfernung von Realität betrachten, sieht Schrödinger hier einen Aufruf zu wissenschaftlicher Redlichkeit: Man könne sich nicht mit einem Gegenstand beschäftigen oder etwas über ihn erkennen, ohne eine Beziehung zum ihm herzustellen. Jeder Gegenstand wird durch seine Beobachtung im Bild des Beobachtenden verändert, jede Beschreibung, die diese Tatsache nicht berücksichtigt, bleibt unvollständig. Schrödinger schreibt sogar: „Mind has erected the outside world out of its own stuff“.
Für Schrödinger ist diese Perspektive auch Beitrag zur Beseitigung von Erkenntnisproblemen. Nachdem der Beobachter immer Teil der Beobachtung ist, muss keine Grenze zwischen Beobachter und Beobachtetem, zwischen Subjekt und Objekt überwunden werden. Denn es gibt diese Grenze nicht.
Vor dem Hintergrund diese Überlegungen fragt sich Schrödinger, wie es Leben geben kann und wie oder als was wir es verstehen können.
Leben, insbesondere Genetik, bringt das Weltbild des Physikers durcheinander. Gesetzmäßigkeit und Wissen als Statistik – das funktioniert, wenn der Physiker unterschiedliche Abstraktionslevels betrachtet, problemlos. Jede Beobachtung schließt unzählbar viele Atome ein und damit unzählige Möglichkeiten, die Dinge verlaufen können. Die Menge macht die Statistik verlässlich und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dinge wiederholen lassen.
Die Planmäßigkeit von Zellteilung, Vermehrung und Leben stellt diese Beobachtung infrage. Gene bestimmen über den Verlauf des Lebens – und für Schrödinger sind sie auch auf Atomebene betrachtet zu klein, um Ordnung über Statistik schaffen zu können. Hier herrscht Ordnung, bevor die durch Normalverteilungen geschaffen werden kann.
Die Ordnung der Physiker ist für Schrödinger statistische Gesetzmäßigkeit, die durch Wiederholung aus Unordnung entsteht. Im Gegensatz dazu folge Leben dynamischer Gesetzmäßigkeit, also einer fortschreitenden Entwicklung, die Ordnung aus Ordnung schafft. Hier läuft eine Mechanik ab – die Schrödinger nicht religiös oder mystisch betrachtet. Er stellt nüchtern fest: Leben folgt physikalischen Gesetzen, die wir noch nicht kennen.
Schrödingers Überlegungen in „What is Life“ und „Mind and Matter“ sind damit mit mehrfacher Hinsicht aus naiv wissenschaftlicher Perspektive neuartig und vielleicht sogar befremdlich: Physik, die Alleserklärer-Wissenschaft, stößt oft und schnell an ihre Grenzen. Wissenschaftliche Neutralität und methodische Reinheit gibt es nicht; Wissenschaft und Wissenschaftler sind immer Teil der Beobachtung und damit auch ihr eigener Gegenstand. Und letztlich: Das ist kein Manko, das es auszuräumen gälte, weil es nicht ausgeräumt werden kann. Es ist eine Tatsache, die akzeptiert werden muss und die für ein klareres Bild wissenschaftlicher Methoden und Prozesse gilt.
In den Jahrzehnten seit Schrödingers Schriften sind ähnliche Gedanken oft und aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Intentionen oder Problemen im Blick formuliert worden.
In der Geschichtswissenschaft postulierte Clifford Geertz die teilnehmende Beobachtung als Methode der Feldforschung – und gilt damit als Wegbereiter der Postmoderne. Seine Grundidee: Der Beobachter kann sich nicht aus dem Spiel nehmen und so tun, als wäre er nicht da. Also soll er offen Teil der Methode sein.
David Bloor legt in seine Strong Programme der Wissenssoziologie dar, dass Rationalität allein kein Königsweg zur Erkenntnis ist. Im Gegenteil: Alle Arten von Einflüssen, rationale und irrationale, wünschenswerte und nicht wünschenswerte haben Einfluss auf aktuelle Methoden und sind immer vorhanden. Es gibt keine reine, unbeeinflusste, ausschließlich rationalen Gesichtspunkten gehorchende Methode, die uns zu sicherer Erkenntnis führt, wenn wir sie nur unbeeinflusst lassen.
Bruno Latour stritt oft und viel mit David Bloor und lässt sich doch auf recht ähnliche Ergebnisse kondensieren: Wissenschaft existiert nicht im luftleeren Raum.
Karin Knorr-Cetina benannte ein ganzes Buch nach der Erkenntnis, dass Erkenntnis Fabrikation ist.
Ich habe noch gar keine ausdrücklich postmodernen Ansätze erwähnt, dennoch galten all diese Konzepte immer wieder als aufgeweichte Ergebnisse schwammiger Sozialwissenschaften, die in unversöhnlichem Gegensatz zu „echter“ „exakter“ Wissenschaft, also in erster Linie zur Physik, stehen.
Mit der Idee, dass Rechnen und Messen nicht alles (und auch selbst vorrangig Konvention) ist, ist viel Unfug getrieben worden. Mit Kritik an dieser Idee ebenso. Und ich bin überzeugt, dass die wenigsten sehr lauten Kritiker angeblicher postmoderner Antiwissenschaftlichkeit Schrödinger oder Heisenberg gelesen haben.
Schrödinger liefert auch ganz beiläufig Feststellungen, die je nach persönlicher Präferenz als Vorläufer oder Kernaussagen von Relativismus, Konstruktivismus, Strukturalismus oder anderen grundsätzlich pragmatischen Wissenskonzeptionen gesehen werden könnten.
Einige davon:
Theorien der Physik sind immer relativ, weil sie immer von grundlegenden Annahmen abhängig sind. Diese Annahmen sind keine Selbstverständlichkeiten. Sie sind erklärungsbedürftig und müssen thematisiert werden können, wenn wissenschaftliche Ergebnisse bewertet werden oder zu konkreten, etwa politische Entscheidungen führen sollen.
Unser Ego ist unser Weltbild. Wir können weder hinter das eine noch hinter das andere, und wir können das Ego, also uns selbst, nicht aus der Beobachtungssituation nehmen. Sonst sind wir nämlich nicht mehr da und wissen gar nichts.
Das Ich ist letztlich nur eine Leinwand, auf der Daten gesammelt werden. Es ist ebenso abhängig von seinen Erfahrungen, wie die Erfahrung vom Ich abhängig sind. Denn ohne das Ich in der Gleichung gäbe es auch diese Erfahrungen nicht.
Was bedeutet das vereinfacht und auf den Punkt gebracht: Wer von Objektivität, unverfälschter Rationalität und neutraler ideologiefreier Erkenntnis redet, zeigt damit recht wenig Erfahrung mit wissenschaftlicher Praxis und der Einordnung wissenschaftlicher Ergebnisse.