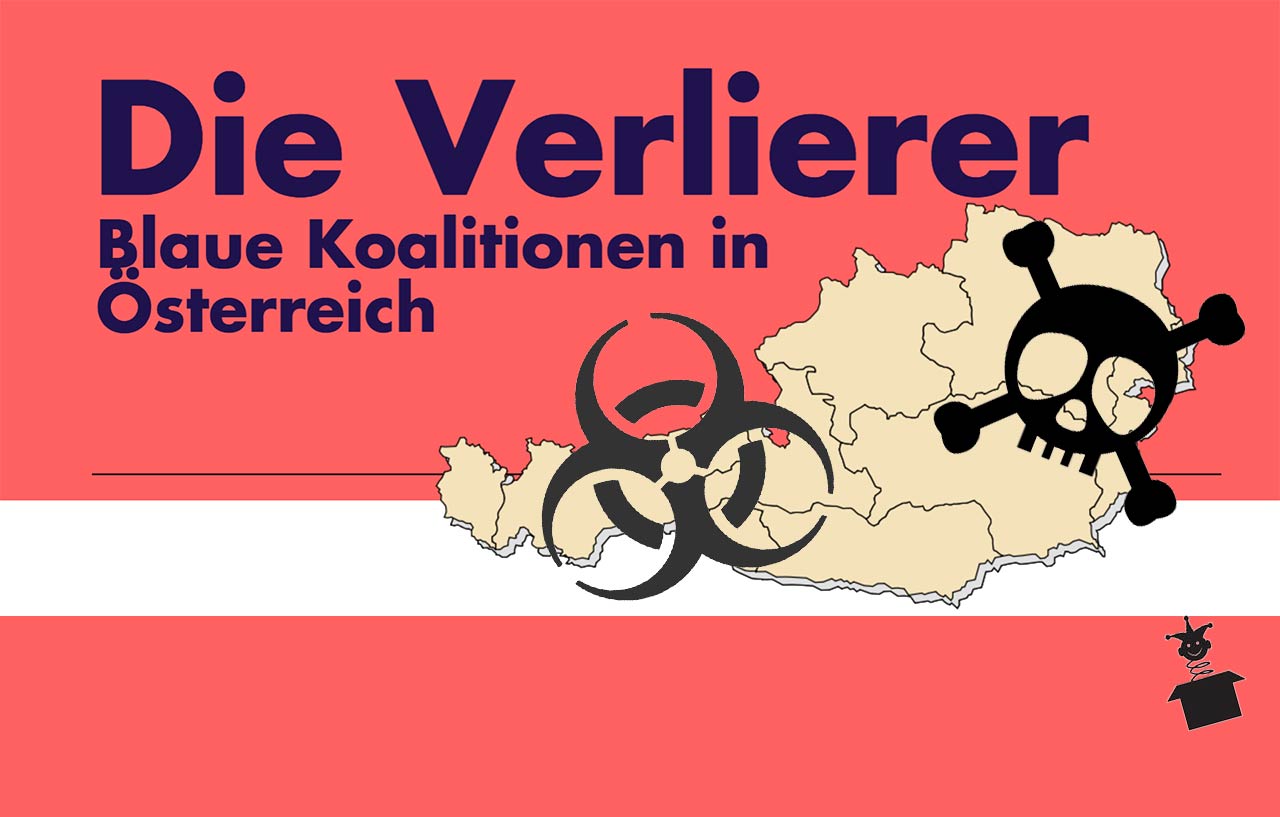Slavoj Žižek rettet Hegel, schaut Batman und schreibt sehr viel („Weniger als Nichts“, „Ärger im Paradies“, „Was ist ein Ereignis?“). Beim Lesen lernen wir: Die, die ihr Unbehagen mit der Welt nur diffus formulieren können, sind wahrscheinlich zur Zeit die präzisesten Analytiker dieser Gegenwart.
Mit politischen Hegelexegeten ist es ähnlich wie mit diversen Flirtcoaches und ihren mehr oder weniger krassen Tipps. Zwei stehen einander gegenüber, einer davon hat etwas drittes als Ziel, das die zweite vielleicht nicht so sieht (er will sie ins Bett kriegen), und mehr oder weniger krude Methoden sollen den Weg dorthin ebnen (wie etwa: „Drück ihr Gesicht in deinen Schritt. Sie wird es lieben.“).
Es birgt also eine gewisse Gefahr, in einem 1500-Seiten-Wälzer, der sich irgendwie doch mit der politischen Situation des frühen 21. Jahrhunderts beschäftigt, große Teile Hegel zu widmen. Genau das tut Slavoj Žižek in „Weniger als nichts.“
Warum drängt sich dabei dann der Gedanke an die Flirtcoaches auf? Žižek kann wie immer nicht ohne Lacan, und wo Psychoanalyse ist, ist auch Sex.

Alles könnte auch anders sein. So weit, so scheinbar banal.
Žižek holt weit aus, kombiniert Vorsokratiker, deutsche Idealisten, Akte X und seine liebsten Hitchcock-Filme in einem ziemlich anstrengenden Gedankenstrom, und nach etwa 500 Seiten dämmert es dem Leser: Es geht hier um die gedanklichen Instrumente, die wir uns zur Erfassung der Welt zurechtlegen. Und damit sind wir mitten in einer hochpolitischen Diskussion. Denn das Ziel, oder der Punkt, der nach diesem Buch zu verstehen wäre, ist: Nichts muss so sein, wie es ist. Das gilt auch für eine demokratische und kapitalistische Ordnung. Das bedeutet aber nicht, dass wir wissen müssten, wie es anders ist.
Nichts muss so sein – in der Philosophie nennt man das Kontingenz. Und diese Behauptung lässt sich auf unterschiedlichen Wegen argumentieren:
- Wir können Kausalitäten in Frage stellen – war a wirklich der Grund für b und wenn schon – war a dann notwendig?
- Wir können das Müssen in Frage stellen: Wenn Müssen auf Macht beruht, die jemand hat, oder auf Gewohnheiten und Traditionen – dann ist das noch immer weit entfernt von jeder vorgegebenen Ordnung.
- Wir können auch schlicht sagen: Wir wissen eigentlich gar nicht, was gerade los ist. Wir können es nicht einteilen und beurteilen – und deshalb können wir auch keine vernünftigen Angaben zur Notwendigkeit machen. Wir können es mögen oder nicht – aber das ist gerade angesichts komplexer Zustände eher ein Gefühl oder eine Ideologie als eine begründbare Argumentation. Und allen, die jetzt mit vielen Gründen argumentieren möchten, sei gesagt: Auch dabei haben wir es dann schnell mit Werten und Ideologien zu tun …
So weit, so scheinbar banal.
Was war, wissen wir erst, wenn es vorbei ist. Also eigentlich nie.
An diesem letzten Punkt setzt Žižeks lange Diskussion der Frage, was denn nun ein Ereignis sei, an
(der Text ist Teil von „Weniger als Nichts“ und phasenweise wortgleich als eigenes Buch („Was ist ein Ereignis?“) erschienen). Die Frage ist: Wann ist „wirklich etwas passiert“? Wann ist etwas geschehen, eine Veränderung eingetreten, ein anderer Zustand erreicht, etwas, das sich von einem Dauerzustand laufender Veränderung unterscheidet? Wann ist die eine Entwicklung zu einem Ende gekommen und wann hat die nächste begonnen?
Das, so die Konsequenz, wissen wir immer erst im nachhinein. Es ist der Job der Geschichtsschreibung, Entwicklungen Bedeutung zuzuschreiben und sie so zu Ereignissen zu machen. Das ist nicht mit Relevanz zu verwechseln. Es ist eher ein Vorgang der Abstraktion: Viele kleine Punkte werden
zu einem Ereignis aggregiert. – Demonstrationen und der Mauerfall waren das Ende des Kommunismus (was sagt eigentlich Nordkorea dazu?) und Österreich war ein Opfer Hitlers (Österreich sagt danke).
Nicht wissen zu können, was los ist, bedeutet dann auch, dass was wir zu wissen glauben ziemlich notwendigerweise falsch ist.
Hier setzen dann eben die gängigen Hegel-Gymnasiasteninterpretationen an. Dialektik heisst in dieser Vorstellung: Hier gibts die These, dort die Antithese und daraus entsteht in wundersamer Weise die Synthese. Dahinter oder über den Wolken lauert auf noch wundersamere Weise der Weltgeist, der magisch dafür sorgt, dass sich alles weiterentwickelt.
Wir können eine süßliche Entwicklungsromanze vermuten oder eine notwendige zerstörerische Kraft. Die „Kraft“ ist dann auch allerdings eher ein Produkt der Phantasie. Das sind die Momente, in denen Žižek neben Hegel Lacan braucht. Lacan macht Psychoanalyse und hat Freuds Repertoire weiterentwickelt. Neben dem Es gibt es bei ihn den Großen Anderen. In der klassisch sexfixierten Psychoanalyse könnte das der Vater ödipaler Kinder sein, bei Lacan ist es das Gespenst das jeder mit sich herumträgt – der Große Andere ist das Surrogat von Notwendigkeit. Er ist das, was wir nicht mehr hinterfragen, weil es für uns selbstverständlich ist, unser Handeln und unser Verständnis anleitet. Und das große Ding, das wir zugleich bekämpfen (wenn es ödipal wird) oder nicht wahrhaben wollen (wenn wir uns lieber als rationale selbstbestimmte Individuen sehen würden), das uns aber insgeheim immer klar macht, wo es lang geht. Und das meist für alle anderen deutlicher ist als für uns.

Trieberfüllung: immer weiter machen, bloß nie ankommen.
Der Große Andere löst Unzufriedenheit aus. Einerseits stiftet er den Zusammenhang, vor dem das ständige “nicht ganz” klar wird: Er ist immer eine Schritt woanders, nie ganz da und nie ganz greifbar. Er lässt immer verstehen, dass wir noch nicht da sind, dass sich etwas ändern muss. Auch das ist eine zerstörerische Kraft.
Andererseits ist der große Andere nah am Trieb. Lacans Triebkobzept behauptet, dass Triebe ihr Ziel nie erreichen möchten. Der Antrieb entsteht dadurch, dem Triebobjekt nachzujagen. Es zu erreichen, wäre eine Enttäuschung und keine Erfüllung. Befriedigung entsteht für Lacan in der Wiederholung des Scheiterns. Das gibt uns den Grund, immer das gleiche machen zu können, gibt Sicherheit und verleiht gleichzeitig den Anschein, etwas zu tun und aktiv zu sein. Dabei gibt es kein großes Ziel, außer dem, Passivität und einen unbewegten Dauerzustand zu vermeiden.
Aber zurück zu Politik und Dialektik. Worauf Žižek hinaus möchte: Entwicklung und Dialektik sind keine Dreierbewegung hin zu einem Ziel, sondern eine Zweierbewegung. Die Notwendigkeit der Zweierbewegung ergibt sich nicht nur aus der hin und wieder schlicht vorhandenen Notwendigkeit, dass sich etwas ändern muss. Sie ist schon (hier unterhalten sich wieder Hegel und Lacan) in der Beschreibung und Festsetzung eines Zustands enthalten. Die einfache Feststellung „Du bist John“, die auf den ersten Blick eindeutig und affirmativ klingt, wird aus dieser Perspektive zur Beschreibung einer großen Spaltung. „Du“ und „John“ sind unterschiedliche Einheiten, zwischen denen eine Beziehung hergestellt wird. Wenn sie eins wären, wozu dann eine Beziehung herstellen?
Ähnlich ist es bei der Entstehung von Bedeutung: Dingen wird ein Sinn zugeschrieben, ein gewisses Verständnis, sie werden in kausale Zusammenhänge gebracht. Daraus entsteht ein Ereignis, daraus entstehen – unter anderem – Rahmenbedingungen für politisches Handeln. Und weil die Behauptung schon die grundlegende Spaltung darstellt, öffnet sie zugleich auch den Raum für Veränderung – ebenso, wie sie ihn auch unterdrückt.
Entwicklung, „werden, was immer schon war“, notwendige Zerstörung und andere mythologisch anmutende Dialektizismen können so auf die naive Annahme einer festgesetzten Zukunft, einer Entwicklung zum Besseren hin verzichten. Bewegung entsteht allein dadurch, dass sie zu verhindern versucht wird; jeder Fixierung bedeutet zugleich: „Und es könnte auch ganz anders sein.“
Klartext: Es geht um ein Kommunismus-Comeback
In „Weniger als Nichts“ bleibt Žižek abstrakt und auf wissenschaftliche Philosophie und Psychoanalyse (und seine persönlichen Spielarten) bezogen. In seinem etwa zur gleichen Zeit erschienenen Buch „Ärger im Paradies“ wird er konkreter. Hier geht es nicht um idealistische und psychoanalytische Funktionsweisen, hier wird ganz konkret die Frage gestellt: „Ist der Kapitalismus am Ende?“.
Das wirkt nur auf den ersten Blick überraschend.
Nicht nur, weil Žižek laut Eigendefinition überzeugter Kommunist ist. Die herrschende (politische) Erzählung ist die von Freiheit, Demokratie und freier Wirtschaft. In dieser Erzählung treten Widersprüche auf, dazu muss man sie gar nicht mit Marx lesen. Von der Freiheit profitieren nicht alle. Verteilungsmechanismen schaffen fragwürdige Ergebnisse (zu viel oder zu wenig, je nach Perspektive). Finanzmärkte schaffen zusätzliche Abstraktionsgrade, Probleme und
obskure herrschende Klassen.
Dem kann man entgegensteuern, indem man sich auf einen
realen Kapitalismus bezieht, der sich von Spekulanten, Managern und Korruption abgrenzt. Man kann auch soziale Verantwortung in den Vordergrund stellen, die
soziale Seite von Adam Smith heraufbeschwören (wer im Eigeninteresse handelt, handelt auch im Interesse seiner Umgebung) und Nachhaltigkeit und Langfristigkeit in Unternehmensziele einbeziehen. Oder man kann
Kleinunternehmertum als Rezept gegen die Ausbeutung von Arbeitern sehen .
Ändert sich dadurch grundsätzlich etwas? Verschieben sich Grundsätze der Welt, wenn ehemalige Venturekapitalisten, nachdem sie Partner abgezockt, Start Ups an Konzerne verkauft und dadurch die alte Ordnung einzementiert haben, Biomärkte eröffnen? In denen – preisbedingt – ohnehin nur die einkaufen können, die selbst das kapitalistische Spiel mitspielen. Ändert sich etwas, wenn der Kleinunternehmer, statt 40 Stunden die Woche „ausgebeutet“ zu werden, 60 Stunden die Woche
in die eigene Tasche arbeitet?
Das sind keine radikalen Kurswechsel, das sind vereinzelte Zuspitzungen und persönliche Lösungen. Sie erscheinen vielleicht radikal oder zukunftsträchtig, weil die große Alternative noch nicht im Blick ist. Sie werden, auch wenn sie ein wenig an der bestehenden Ordnung kratzen, politisch gefördert und gern gesehen, weil es marginale Veränderungen sind, die neue Rahmenbedingungen weder brauchen noch schaffen.
Das kann gut sein. Das kann aber auch Erstarrung bedeuten, Zuspitzung des Problems, Verleugnung von Problemen, Ausblenden von Alternativen – oder ganz einfach: Es kann ein Fall von Betriebsblindheit sein. Politisch gesprochen würden jetzt Metaphern von „aufwachen“, „Augen öffnen“, „bevor es zu spät ist“ Raum greifen. Philosophisch betrachtet gehts eher um die Frage, wie falsch diese Einstellung ist, wie weit diese Einschränkung auf einige wenige Alternativen unsere Perspektive beschränkt und damit das Fundament der eigenen Argumentation schwächt. Also schlicht: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irren, das nicht wissen, und deshalb gar nicht argumentieren können.
Batman darf kein Kommunist sein
In „Ärger im Paradies“ zieht Žižek ausnahmsweise nicht Hitchcock, sondern Batman heran, um das Problem zu erklären:
Joker in „The Dark Knight“ hat Chaos angerichtet, Menschen an den Rand ihrer Überzeugung gebracht, Helden an sich zweifeln lassen, und sogar den guten Bürgermeisterkandidaten Dent, der die Hoffnung auf den unkorrumpierbaren weißen Ritter in Gotham City verkörperte, zum Kippen gebracht. Das war ok, weil es letztlich nur um Liebe und persönliche Grausamkeiten ging.
Bane dagegen, der Schurke aus der Fortsetzung „The Dark Knight Rises“, spielt seine Bösartigkeit über die Finanzmärkte aus: Er greift Bruce Waynes/Batmans Vermögen an, lockt die Polizei in eine Falle und löst durch die Befreiung von Häftlingen anarchische Zustände aus. Während Joker eine zwiespältige Figur war, die auch in ihren Gegnern Zwiespalt auslöste, vereint Bane eine geschlossene Front gegen sich – weil seine Angriffe nicht innerhalb einer bestehenden Ordnung funktionieren, sondern das System selbst in Frage stellen. Das kann nicht sein, daher gibt es diesmal keine korrumpierten Helden, die Polizei steht geschlossen auf der Seite des Guten – und außerdem ist klar, wo Gut und Böse sind.
Was bedeutet das für die Frage nach der Auffassung von Geschichte und ihrer Zuspitzung nach dem Ende des Kapitalismus? Solange die Alternativen Joker sind (so wie venturekapitalgepowerte Nahversorgerbiomärkte), steht das System selbst nicht wirklich zur Debatte. Es gibt Variationen des Bestehenden, kleine Attacken und Reformideen, aber keine grundlegend neue Perspektive. Reale Gegenentwürfe müssen die Gestalt von Bane annehmen. In der Rolle des ganz anderen, des großen Gegensatzes zum Kapitalismus, werden sie dann in der Gestalt des Kommunismus greifbar.
Macht der Trieb noch Spass, wenn wir ihn verstehen?
In „Weniger als Nichts“ steht die Alternative des Kommunismus nicht so eindeutig im Vordergrund. Die Argumentation bleibt etwas abstrakter. Die Linie ist aber ähnlich: Veränderung entsteht hier nicht durch Beschleunigung oder das Verfolgen konkret definierter Ziele, nicht durch mehr vom Gleichen und noch genauere und noch erreichbarere Ziele. Veränderung entsteht durch Bremsen, durch Unerwartetes, durch das Stocken dessen, was wir als Fortschritt gewohnt sind. Politisch gesprochen also eigentlich durch das, was wir als konservativ bezeichnen. Diese Aufweichung ehemaliger politischer Fronten ist ja real durchaus zu beobachten.
Das Problem dabei: Es wäre natürlich viel zu einfach, einfach auf die Bremse zu steigen, auszusteigen. Oder noch schlimmer: Was passiert dann? Wieder aus psychoanalytischer Sicht: Dann wäre am Ende der furchtbare Zustand eingetreten, in dem das Triebziel erreicht ist – und was machen wir dann bloß ohne Trieb? Glücklich sein?
Aber vielleicht, und das ist die naiv-therapeutische Lesart, hilft ja das Wissen um den notwendigen Irrtum, um die Spaltung, die wir mit jeder Behauptung erzeugen, und um die Grundlagen des Triebs, trotzdem Gründe zum Handeln zu finden. Wer weiss, was er oder sie tut – das schliesst auch ein, dass es falsch sein könnte – tut sich leichter dabei, irgendetwas zu tun. Und auch dabei, in Kauf zu nehmen, dass sich im Lauf der Zeit einiges ändert.