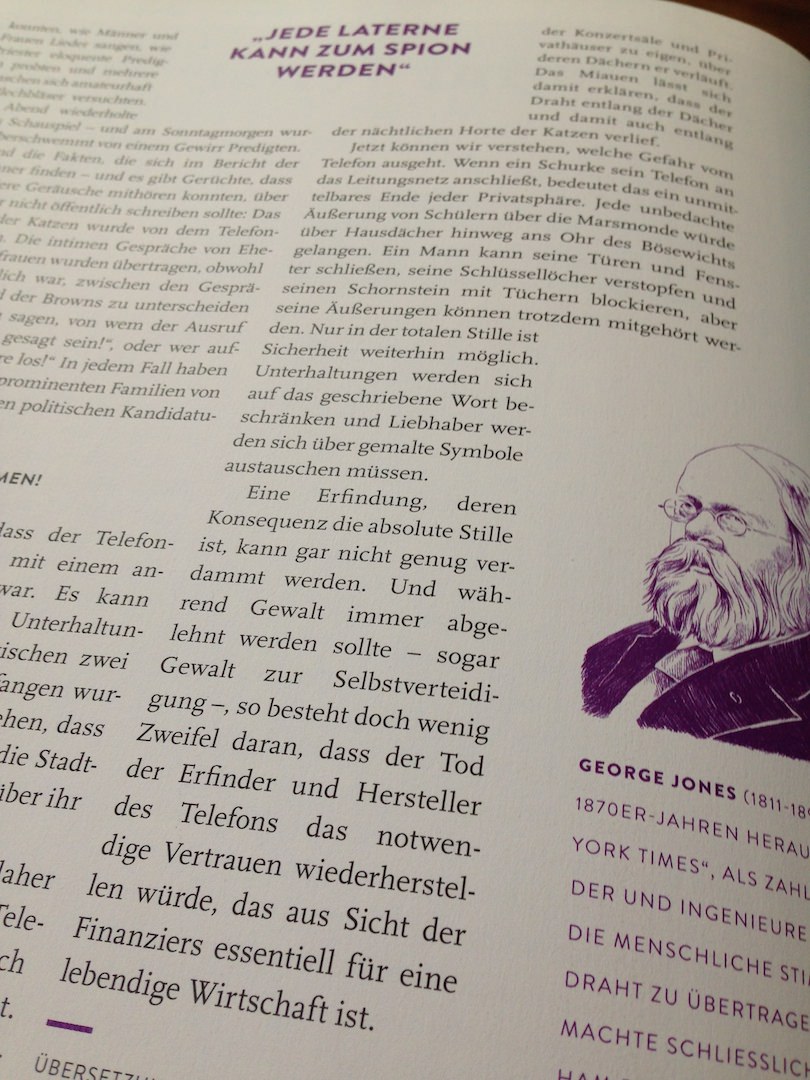[su_dropcap]M[/su_dropcap]obilisiert sind wir schnell. Dummheiten, Hass oder der gute Zweck – eine Meinung ist schnell gebildet (oder eher bestätigt), genau so schnell ist sie publiziert, und dann auch wieder vergessen. Modernen Mobilisierungsformen macht das nichts aus – sie sind darauf angelegt, in aller Kurzfristigkeit zu funktionieren, nehmen die Streuverluste zwischen Aufmerksamkeit und Handlung in Kauf, und sie brauchen den User, also die Mobilisierten, nur sehr punktuell.
Grundsätzlich ist das auch nichts schlechtes – Organisationen arbeiten an ihren Themen, beziehen User dann ein, wenn es notwendig ist (wenn Geld gebraucht wird, Aufmerksamkeit für Entscheidungen benötigt wird), und dann gehen die Organisation und die Kurzzeit-Mobilisierten wieder ihrer Wege. Mobilisierung ist Marketing – die auf den einen Punkt oder Klick optimierte Customer Journey.
Problematisch wird das dann, wenn die Organisation nicht für die plötzliche Aufmerksamkeit gerüstet ist, oder wenn eigentlich langfristige Ziele verfolgt werden sollten.
Plötzliche Aufmerksamkeit bedeutet eben nicht nur Wertschätzung. Irgendein Troll, der auf den ersten Blick nicht von einem Aufdecker zu unterscheiden ist (umgekehrt ist das genauso möglich), wird Hinweise finden, die die konkrete Arbeit der Organisation in Frage stellen. Am Beispiel der Icebucket-Challenge war das die konkrete Mittelverwendung der ALS-Foundation, die einen doch beträchtlichen Teil der Spenden für die Gehälter ihrer Funktionäre verwendet.
Langfristigkeit wird dann ein Problem, wenn aus Mobilisierung Überzeugung werden soll: Ein gutes Beispiel dafür sind politische Themen – schliesslich sollen mobilisierte User, die die eine oder andere Aktion etwa einer Partei unterstützen, dann auch zu Wählern werden. Jetzt ist es heute aber ohne weiteres denkbar und auch durchaus üblich, dass verschiedenste Aktionen unterstützt werden können, ohne dass dadurch eine Form von Bindung oder längerfristiger Beziehung entsteht. Die Mobilisierung muss nicht bis zu den nächsten Wahlen anhalten. Und Wahlen werden selbst zu einer Mobilisierungsfrage. Sie unterscheiden sich wenig von einer Icebucket-Challenge, es ist nur eine Frage des Zeitpunkts.
Mobilisiert, weil wir keinen anderen Grund haben
Hinter der großen Bedeutung von Mobilisierung heute steckt wahrscheinlich zum Teil auch die Tatsache, dass wir wenig andere Gründe zum Handeln haben. Überzeugungen und Prinzipien haben es angesichts der großen Auswahlmöglichkeiten schwer – wir können uns immer für das eine oder andere entscheiden und das auch argumentieren. Wir müssen auch nicht wirklich etwas – wenige unserer Handlungen sind existentiell notwendig. Und in einer nicht gerade leicht durchschaubaren Welt mit vielen unterschiedlichen Meinungen und Zusammenhängen kann es uns auch immer wieder passieren, dass die gut gemeinte Entscheidung einen Nebeneffekt bewirkt, den wir ganz und gar nicht wollten. – Also ist es auch immer der sicherste Weg, sich zurückzuhalten: Wer sich nicht bewegt, nacht nichts falsch. (Nochmal am Beispiel der Icebucket-Challenge: Pamela Anderson verweigerte die Unterstützung, weil sich die ALS Foundation in ihrer medizinischen Forschung nicht ausreichend von Tierversuchen distanziert. – Und nützte damit natürlich auch gleich die Energie der Challenge, um die entstandene Aufmerksamkeit auf eigene Themen zu lenken.)
Wir haben also eigentlich keinen Grund, überhaupt etwas zu tun, und gerade weil uns selten die Umstände zwingen, müssen wir mobilisiert sein, um zu handeln. Paradoxerweise wird Mobilisierung – die gewohnterweise immer von außen kommt – damit zur eigentlich wünschenswerten inneren Triebfeder: Es reicht nicht, etwas einfach nur zu tun; es reicht auch nicht, aus Überzeugung oder Wissen zu handeln. Wir müssen mobilisiert sein und einen höheren Zweck verfolgen.
Das gilt sogar für so banale und früher leicht kontrollierbare Bereiche wie Arbeit: Wo sich handwerklich produktiver Output noch leicht messen liess, ist Produktivität in Dienstleistung oder Wissenarbeit schwerer messbar. Der brauchbare und sozial erwünschte Mitarbeiter muss also nicht nur seinen Job machen – er muß engagiert und mobilisiert sein. Meinungsforscher und Personalberater wacheln drohend mit immer neuen Statistiken über das sinkende Engagement von Mitarbeitern quer über alle Branchen und Altersschichten und verkaufen auf der einen Seite Employee Engagement-Programme und auf der anderen Seite Bewerbungstrainings.
Wer nicht mobilisiert und engagiert ist, ist nicht vertrauenswürdig und erweckt nicht den Eindruck, als könnte er die allgemeinen Erwartungen erfüllen. “Wenn der Arbeitslose, der sich seine Piercings rausnimmt, zum Frisör geht und ‚Projekte’ macht, tatsächlich ‘an seiner Beschäftigungsfähigkeit arbeitet’, wie man so sagt, heißt das, dass er dadurch seine Mobilisierung bezeugt,“ schreibt das Autorenkollektiv „Unsichtbares Komitee“ in seinem Text „Der kommende Aufstand“ und möchte damit argumentieren, dass Mitarbeiter mobilisiert sein müssen – weil man sie eigentlich nicht mehr braucht. Sie müssen sich darum bewerben, eine Rolle spielen zu dürfen. Oder, wie es der Philosoph Byung Chul Han formuliert: “Neoliberalismus bezeichnet den Zustand der heutigen Gesellschaft sehr gut, denn es geht um die Ausbeutung der Freiheit. Das System will immer produktiver werden, und so schaltet es von der Fremdausbeutung auf die Selbstausbeutung, weil dies mehr Effizienz und mehr Produktivität generiert, alles unter dem Deckmantel der Freiheit.”
Langweilen oder unterhalten – beides geht
Mobilisierung mit ihren 15 Seconds of Fame (ja, Seconds – es wird enger dort draußen…) ist ein Überzeugungs-Ersatz, der immer noch genug Raum für Distanz lässt: Man kann sich guten Gewissens Eis über den Kopf schütten und dafür Likes von Freunden sammeln, ohne sich über die Bonzen im ALS-Foundation-Vorstand ärgern zu müssen und ohne es sich mit Pamela Anderson zu verscherzen. Denn Mobilisierung ist nicht mit Überzeugung zu verwechseln – wir machen das ja nur für den guten Zweck, aber wir sind nicht mit allem einverstanden. Mit anderen Worten: Es ist uns ziemlich egal, was genau passiert. Aber wir können auch nicht einfach nein sagen. – Das ist dann effiziente Mobilisierung.
Während man sich im Rahmen gut angelegter Kampagnen noch über kurzfristige Mobilisierung freuen kann, zeichnen sich dort, wo es um längerfristige Entwicklungen geht, andere Taktiken ab. Politische Kampagnenmanager reden schon gern von Demobilisierung: Wenn es schon nicht möglich ist, die eigene Klientel für die eigenen Themen zu begeistern, dann soll es wenigstens der Klientel der anderen vermiest werden, sich für deren Themen zu begeistern. Die Politikwissenschaft nennt Angela Merkels Wahlkampf von 2009 als Paradebeispiel für Demobilisierung; Buzzwords wie „Modernisierung“ oder „alternativlos“ sind die sichersten Indizien, mit denen jede Bewegung möglichst ruhiggestellt werden soll. – Der Gegner wird bis zur Lähmung gelangweilt, verliert jede Angriffsfläche und hat kein Material mehr, um seine eigene Klientel zu mobilisieren. Das Ergebnis: Wir haben niemanden dazugewonnen, aber auch niemanden vergrault, die anderen haben auch niemanden gewonnen, aber vielleicht haben wir dem einen oder anderen die Lust verdorben, dagegen zu sein.
Der gute Zweck erfüllt den gleichen Effekt: So lange er nicht zu spitz formuliert ist (und damit Angriffsflächen bietet), kann sich niemand ernsthaft dagegen stellen. – Auch die Vorwürfe zur Spendenverwaltung oder zu den Tierversuchen der ALS-Foundation riefen eher nur achselzuckende No-Na-Reaktionen hervor.
Das größte NoGo: Erwarten, dass etwas passiert
Die Demobilisierungs-Taktik funktioniert nur dann gut, wenn Entweder-Oder-Entscheidungen anstehen. Wo viele Optionen einander nicht widersprechen, und wo die Beteiligung auf punktuelle Impulse komprimiert werden kann (klicken, Fotos posten, sich zum Kasperl machen), gibt es keinen Grund, sich mobilisierungsmäßig einzuschränken. Der User muss nur verstehen, was er tun soll. Und er wird, nachdem er sich ja trotzdem leicht distanzieren kann, keine Probleme haben, auch öfters mitzumachen.
Für Institutionen heisst das: Der Effekt ist eigentlich immer woanders. Auch bei noch so großem Zuspruch braucht es immer noch jemanden, der das eigentliche Ding dann durchzieht. Mobilisierte User machen nichts – sie äußern ja nur kurze Zustimmung und können dadurch ein Anliegen unterstützen oder einen Prozess beschleunigen.
Das größte NoGo ist also, von „mobilisierten“ Usern Wirkung oder nachhaltige Bewegung zu erwarten. Auch nach der größten Aufmerksamkeitswelle braucht es dann immer noch jemanden, der dann etwas mit dieser Aufmerksamkeit macht. Und bevor wir das jetzt Kultur- und politikpessimistisch als Sandkistenspielzeug für eine ewig junge Internetgeneration abtun: Auch die großen Buben und Mädchen, die in der formellen Politik spielen, wissen mit dem mobilisierten Bürger nichts anzufangen, wenn er etwas anderes macht, als sein Kreuzchen auf dem Vordruck zu hinterlassen. Petitionen und Bürgerinitiativen landen alle auf dem großen Partizipationsfriedhof; weitere Konsequenzen sind nicht vorgesehen. – Obwohl das in diesem Fall eigentlich jemandes Job wäre.
Fazit: Faulheit siegt. Es darf dem User nicht zu schwer gemacht werden, und es darf nicht von ihm verlangt werden, sich zu exponieren. Das ist vielleicht ein bisschen gegen die Intuition, aber der größte Konsens findet sich nicht dort, wo die meisten zustimmen, sondern wo die wenigsten dagegen sein können.
Das ist ein Beitrag zur aktuellen “twenty.twenty – Exploring the Future” Blogparade zu Mobilisierung; das Event dazu findet am 17.9. im Hub statt.