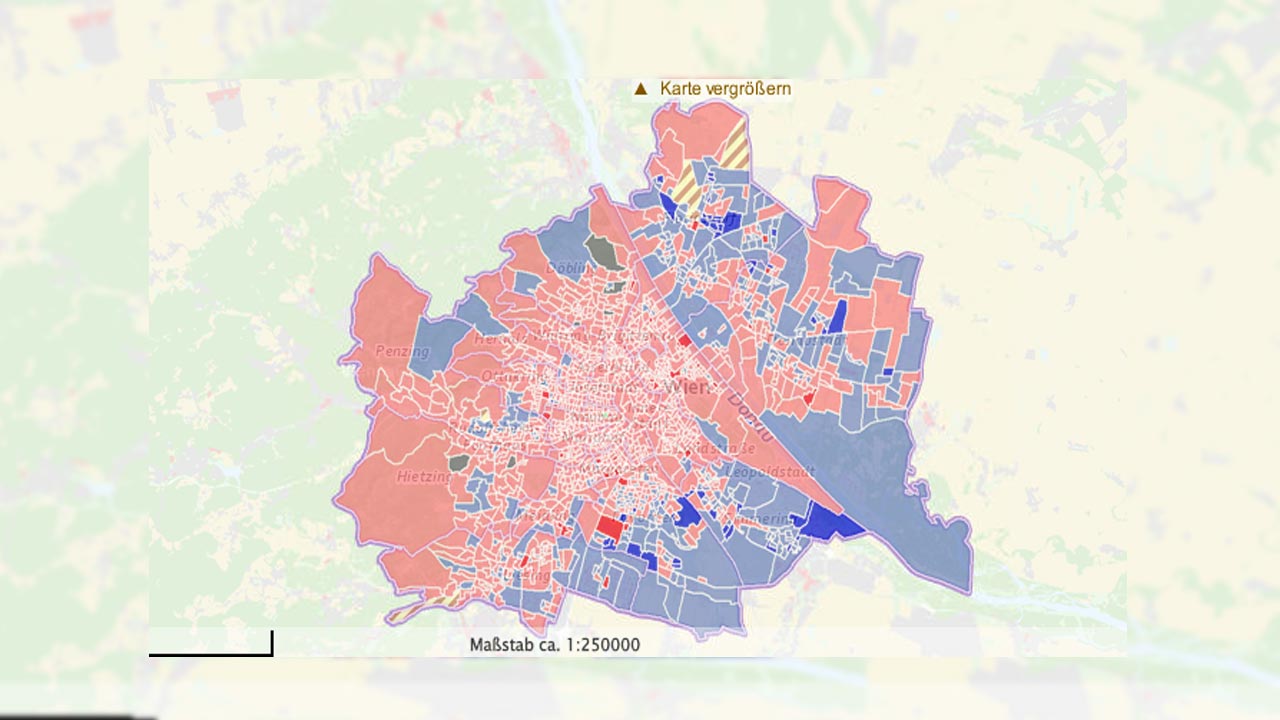Wenn Populisten Recht haben, ist das der klarste Beweis dafür, dass sich etwas ändern muss. Nur ist der Gedanke ein bisschen kompliziert…
Die Lage ist so festgefahren, dass man nicht mal mehr Verschwörungstheorien braucht. Auch das Raunzen über Populisten und Hetzer ist unangebracht. Die traurige Sache ist: Putin hat Recht. Orban hat Recht. Strache hat Recht. Hardliner-Politiker sind heute diejenigen, die auf dem Boden der Gesetze stehen, die keine Ausnahmen bemühen müssen und die sich entspannt auf Fakten zurücklehnen können. Natürlich bleibt offen, was man aus diesem Fakten macht – aber auch der Interpretationsrahmen spricht für sie.
Ein paar Beispiele: „Der Westen gibt Milliarden aus, um sogenannte NGOs zu fördern, die unsere Demokratie kontrollieren sollen“, sagt Putin. Unbestreitbar. Und er hat den Rahmen, der das als feindliche Agitation erscheinen lässt.
„Wir müssen unsere Grenzen schützen, dazu sind wir der EU vertraglich verpflichtet“, sagt Orban – und hält sich damit punktgenau an EU-Vorschriften und das Dublin-Abkommen.
Und Strache war in einer Klubobleute-Diskussion vor einigen Wochen der einzige, der nicht Ausnahmen, Sonderregelungen und Menschlichkeit bemühen musste, sondern sich eiskalt auf den Boden des Rechts stellen konnte: Und das sieht nun mal unter anderem vor, dass sich niemand sein Asylland aussuchen kann. Die anderen Klubobleute mussten mehr oder weniger vage Vorstellungen von Menschlichkeit bemühen, sehr grobe Lösungsansätze ankündigen (eigentlich nur die Suche danach) und wirkten dementsprechend schwach, unentschlossen und planlos.
Natürlich heisst das nicht, dass Putin, Orban und Strache das richtige tun. Aber es wird umso schwerer, dagegen zu argumentieren. Wenn die falschen Ideen recht haben, heisst das, das etwas in der Ordnung der Dinge nicht stimmt und dass echt grundlegende Veränderung notwendig ist.
Hier kann man jetzt getrost zu lesen aufhören, denn genauso viel lässt sich konkret sagen; der Rest ist Spekulation oder Wahlkampf.
Ich höre trotzdem nicht auf, zu schreiben, weil mich diese Beobachtung an ideengeschichtliche Grundzüge erinnert, die Slavoj Zizek in seinem Wälzer „Weniger als Nichts“ herausarbeitet, und darüber wollte ich immer schon schreiben.
Dazu muss man ein bisschen ausholen. Zizek beschäftigt sich gut 1500 Seiten lang mit der Frage, was Hegels Geschichts- und Politikphilosophie eigentlich bedeutet, zieht auch Marx und Lenin zu Rate und stellt das Ganze mit der Hilfe von Lacan dann auf den Kopf. Der Hintergedanke, soviel kann man vorausschicken, ist die Frage, ob der dialektische Materialismus nicht vielleicht die angemessene Politphilosophie zur Diagnose Gegenwart wäre.
Die gängige Gymnasiasten-Hegelinterpretation geht ja jetzt ungefähr so: Da gibts die These, dann die Antithese und daraus entsteht die Synthese, das nennen wir dann Dialektik und damit bewegen wir uns immer weiter fortschreitend hin zu einem friedlichen Schlaraffenland, in dem es keine Widersprüche mehr gibt. – Das erinnert mich immer an die Flirttipps sogenannter Aufriss-Coaches: Zwei stehen einander gegenüber, einer davon hätte etwas drittes als Ziel (das die zweite vielleicht nicht so sieht), und dann gibt es eine Reihe mehr oder weniger krasser Tipps (wie etwa: „Drück ihr Gesicht in deinen Schritt, sie wird es lieben.“), die angeblich Wunder bewirken. Die sich in diesem Fall aufdrängende Frage „Wie kommst du bloß auf diese Idee?“ stellt sich genau so angesichts der Phantasiekombination der diversen Thesen und der gewagten Annahme, dass das neu entstehende eine Verbesserung der Vorgängersituationen sei.
Zizek arbeitet heraus, dass Bedeutung immer erst im nachhinein entsteht. Wir zimmern uns eine Erklärlogik zurecht, die je nach Anspruch mehr oder weniger ausladende Kausalitätsketten bedient, geben damit der Vergangenheit Sinn und Bedeutung (nicht mit Relevanz zu verwechseln) und haben eine Möglichkeit, die Welt von heute zu erklären.
Und das bedeutet auch: Alles, was ist, ist grundsätzlich einmal falsch, oder zumindest nur eine Annäherung an irgendeinen Zustand, und es wird nicht für die Ewigkeit sein.
Damit höre ich auch schon wieder auf mit diesem Exkurs; das gehört ein anderes Mal ein bisschen weitergesponnen.
Zurück zur Politik: Hier ist ja der Umgang mit Ewigkeit und Veränderung überaus situationselastisch. Einerseits geht es immer um Veränderung, Fortschritt und darum, es besser zu machen als die anderen, andererseits werden Ewigkeiten strapaziert als gäbe es kein Gestern und kein Morgen sondern nur einen einschnittslosen Zeitbrei, in dem die immer gleichen Voraussetzungen gelten. Im Polit-Speak heisst das: „Wir haben es immer schon gesagt.“ Und arbeitslose Ex-Chefredakteure, die heute opportunistische Obskuranten sind, stimmen heulend in das Geschrei ein.
Dass sich Rahmenbedingungen ändern können, detailverliebte Rechthaberei sinnlos ist und dass Diskussionen über die Vergangenheit beim Gespräch über die Zukunft wenig bringen, gerät dabei schnell in Vergangenheit.
Jetzt lauern hier natürlich zwei große Fallen: Die erste ist, das was ist, mit dem was sein soll zu verwechseln. Bedeutet: Dass wir nicht wissen was als nächstes kommt, bedeutet nicht, dass wir es nicht wissen sollen oder dass wir die Hände in den Schoß legen und zuschauen sollen. Es bedeutet aber auch nicht, dass wir so tun sollten, als wüssten wir, was kommt. Die zweite Falle: Wer verändern will, gerät in einen Argumentationsnotstand – warum, auf was hinauf und wer sind Sie überhaupt? Die Grünen hat dieses Dilemma in der öffentlichen Wahrnehmung zur Verbotspartei werden lassen, den Neos wird aus den gleichen Gründen seit jeher Inhaltslosigkeit unterstellt. Beide beschreiben gesellschaftliche und wirtschaftliche Modelle, die mehr Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten schaffen als die Wahl zwischen sozialdemokratischem Versorgungsempfänger und christlichdynamischem Unternehmerkind. Das stresst natürlich.
Über diese Grundlagen von Veränderung könnte man nachdenken. Man könnte sie auch als Grundlage für die Abkehr von radikalpopulärem Geplapper nehmen. Oder man macht es wie Ursula Stenzel, die in einem ihrer ersten Interviews nach dem Überlauf zur FPÖ sinngemäß meinte: Das Volk will nun mal Blut sehen. Und wenn ich mich damit an der Macht halten kann, dann müssen wir eben Blut fließen lassen. (Meine Interpretation. Sie hat natürlich nicht von Blut geredet.)