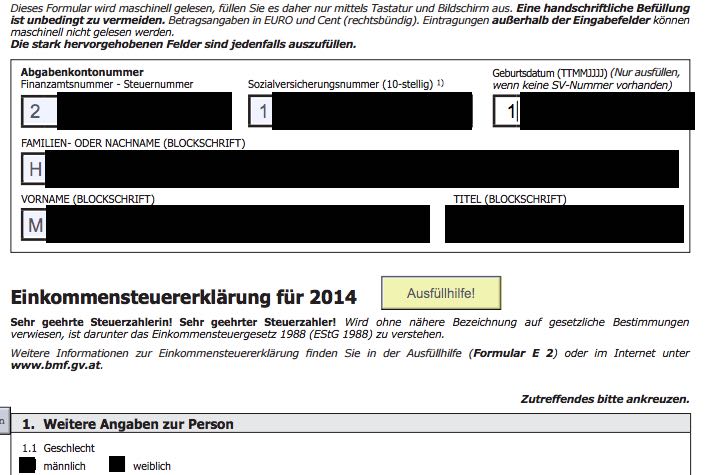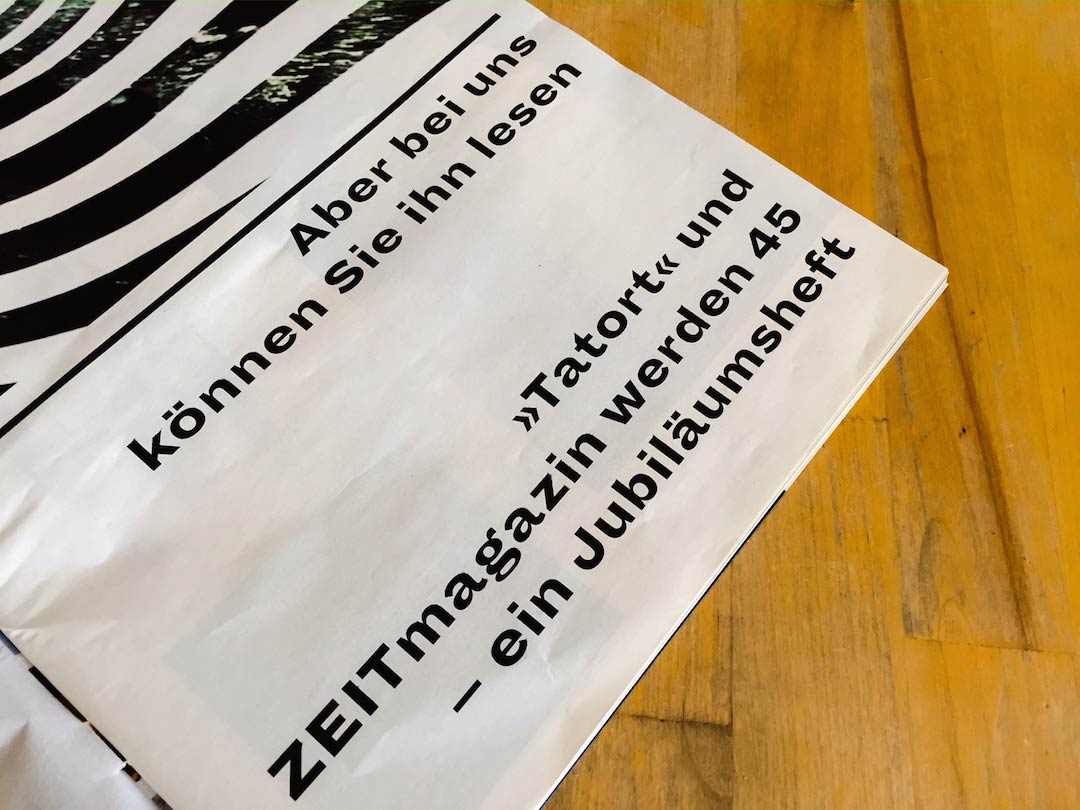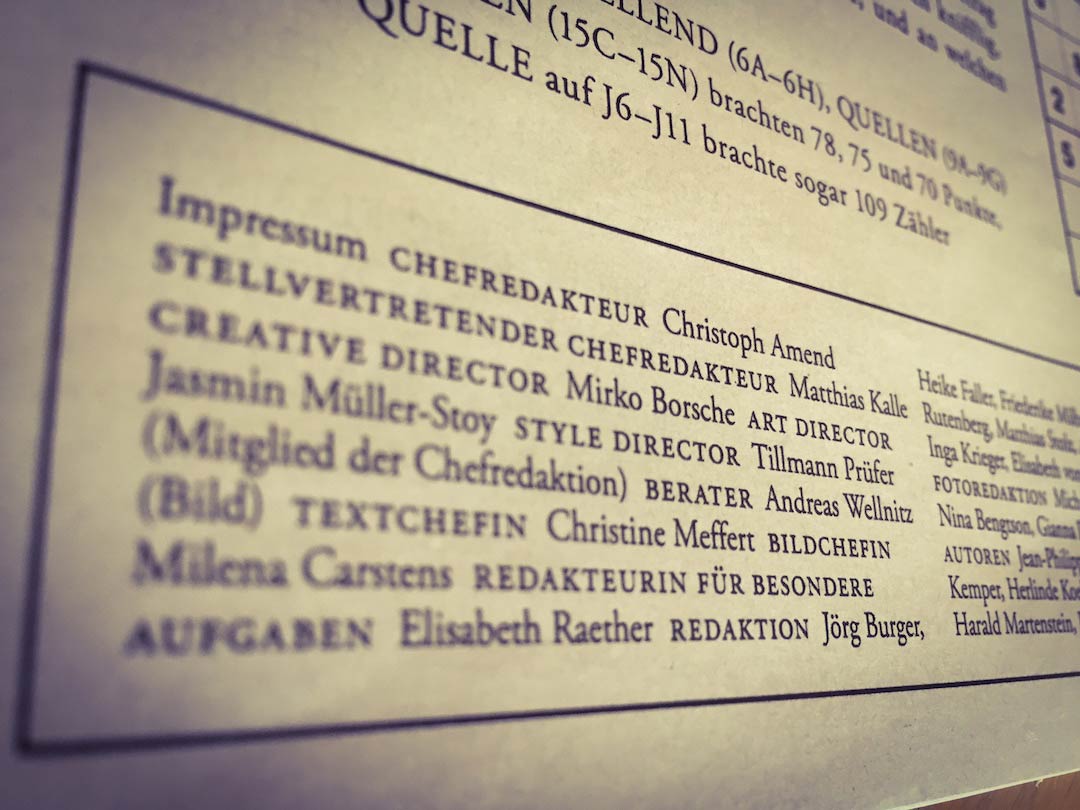Michael Hafner
Michael Hafner
Die nächste Steuererklärung wird schnell gehen. Und im Herzen bin ich Anarchist
[su_dropcap]L[/su_dropcap]iebes Finanzamt, mit meiner nächsten Steuererklärung werde ich schnell fertig sein. Hab ich von euch gelernt. Wenn ein Ministerium dem Verfassungsgerichtshof keine Information geben muss, muss ich das gegenüber dem Finanzamt ja auch nicht machen, oder?
Ich habe mich näher mit der Steuerreform beschäftigt und es dabei immer schon lustig gefunden, dass die Refinanzierung über Betrugsbekämpfung geplant war. Erstens hat es ja durchaus Charme, der gesamten Bevölkerung pauschal kriminelle Energie zu unterstellen. Zweitens stellt das ja auch die Entlastungseffekte infrage: Irgendwo muss das Geld ja herkommen, und wenn diejenigen, die entlastet werden sollen, pauschal als Betrüger betrachtet werden und mehr (bislang hinterzogene) Steuern zahlen sollen, dann halbiert das die versprochenen Entlastungen ja gleich mal. Und drittens war ich schon lang gespannt, was dann an Kontrollmaßnahmen nachkommen wird.
Mit der Kassabonaufbewahrungspflicht nimmt das ja schon mal erste Formen an. Ich hoffe nur, dass wir dann auch jedes Mal UID-Nummern auf den Kassabons eintragen lassen können. Nur für den Fall, dass ihr die dann auch mal wissen wollt. So wie letztes Jahr, als ich die nette Aufforderung bekam, eine Liste sämtlicher Eingangsrechnungen mit Lieferantenadressen und UID-Nummern nachzureichen. Grundsätzlich kein Problem, aber warum sagt ihr das denn nicht gleich? Dann könnte man das gleich beim Buchen erfassen und müsste nicht nachträglich hunderte Belege durcharbeiten.
Auf der anderen Seite wars dann aber auch wieder beruhigend, dass mit diesen Daten nicht viel passieren wird. Auf Finanzonline kann man an Antworten auf Ergänzungsersuchen nämlich nur pdfs oder jpegs anhängen. CSV, Excel oder wenigstens zip? Geht nicht. Und eine Liste mit ein paar hundert Einträgen als jpg ist wohl nur zum Ausdrucken und ablegen geeignet …
Wird das mit der Kontenoffenlegung dann auch so sein? Sollen wir dann eBanking-Screenshots schicken?
Wahrscheinlich, weil dank Staatsschutzgesetz und neuen umfassenden Überwachungsbefugnissen auch ohne Vorratsdatenspeicherung wisst ihr den Rest dann sowieso schon.
Deshalb gleich noch ein Outing:
Liebe Staatsschutzgesetz-Autoren und -Autorinnen, im Herzen bin ich Anarchist, das wollte ich euch nur sagen. Nicht weil ich gern diese Kreise mit As gern wohin male oder per se ein Problem mit Beamten hätte. Man kann halt Bakunin und Kropotkin lesen und darin eine sehr nüchterne und zukunftsorientierte Variante fakten- und evidenzorientierter Politik finden.
Man kann sie sicher auch anders lesen.
Und ich habe letzte Woche mit einem Freund am Küchentisch einer Freundin, die davon nicht begeistert war, über Drogenpreise in Portugal diskutiert. Aber eigentlich nur, weil es mich genervt hat, ungefähr 15 Mal täglich gefragt zu werden, ob ich Gras, Dope, Koks, Speed oder E kaufen will. Und weil es mich durchaus fasziniert, dass die Dealer in Lissabon alle Alters- und sonstigen Bevölkerungsgruppen repräsentieren – vom angesandelten Exhipster über den erkennbaren Selbstversorger bis zum gestrandeten Working Class Hero jenseits der 60.
Ein Sons of Anarchy-T-Shirt habe ich auch. Sons of Anarchy ist aber nur eine Fernsehserie über eine kalifornische Bikergang, die schwach anfängt, zwischendurch ein paar gute Momente hat und dann stark abstinkt.
Wahrscheinlich bin ich schon ein staatsgefährdendes Element.
Aber das liegt wohl weniger an diesen formalen Kriterien, als an mangelndem Respekt für Institutionen und Autoritäten. Und je mehr Misstrauen mir diese entgegenbringen, je mehr Aufwand sie mir umhängen wollen und je deutlicher sie mir zu verstehen geben, dass sich mich für blöd halten, desto mehr schwindet dieser Rest-Respekt.
Und ich fühle mich durchaus als für blöd verkauft, weil ich mir immerhin diese offensichtliche Chance zum Milliarden-Steuerbetrug in den letzten Jahren entgehen habe lassen. Ich hab halt immer gezahlt. Aber vielleicht kann ich ja noch von euch lernen.
Das ist Medienarchäologie!
Macht ist… wenn man das einfach mal so sagt
Spiderman ist der Proto-Liberale
Gibts ein Problem? – Freiheit, Gleichheit, Organisation
Wir haben oft genug vorgeführt bekommen, dass weder Regulierungen noch Verbote, weder Liberalisierungen noch Marktorientierung zu wünschenswerten Ergebnissen führen. Solidarität hatte oft mit Bescheidenheit und mit Passivität zu tun, Freiheit mit Verantwortung und mit Gier. Nur sind die Grenzen halt leider nicht mehr so einfach.
Kann man heute also noch von Freiheit, Solidarität und Ungleichheit sprechen? Viele Ökonomen tun es.
Um diese Entwicklungen wirklich einschätzen zu können, dafür fehlen dann allerdings die großen zeitgemäßen Entwürfe. Sie leiden allesamt an ähnlichen Problemen wie der Versuch, Adam Smith in die Gegenwart zu retten: Ihre Voraussetzungen stammen aus anderen Zeiten.
Aber das war nur ein kurzer Exkurs. Die Argumentation des Akzelerationismus bringt etwas anderes auf den Punkt: Werte werden heute ökonomisch argumentiert. Freiheit bezieht sich auf Wirtschaft, Verantwortung und Moral finden wirtschaftliche Ausprägungen und auch Macht ist wirtschaftlich legitimiert und wird wirtschaftlich ausgeübt.
Der Arbeiter soll also engagiert, bewusst und mobilisiert sein – so wie einst der Revolutionär.
Was heisst das für politische Entwürfe, wenn Wirtschaft das eigentlich relevante politische Paradigma ist, dem allenfalls noch der Vernetzungsgedanke etwas annähernd gleich mächtige entgegensetzen kann? Vernetzung ist heute auch eines dieser Heilsversprechen, das es Einzelnen und Kleineren ermöglichen soll, sich durchzusetzen.
Der Turbokapitalist von heute ist der anarchistische Konsumverweigerer, der sein Geld nur dorthin trägt, wo er es sehen möchte.
Und irgendwie gibt es damit zwei Leitfiguren der Zukunft: Den vernünftigen Langweiler, der sich Dinge überlegt, Abhängigkeiten erkennt und bis drei zählen kann, und den Anarchisten, der kein Problem, mit sachlichen Autoritäten hat, wenn sie Sinn machen – aber mit allen anderen schon.
Ja, es ist ok, Ungleichheit als Problem zu sehen, vor allem in ihrer durch Steuern, Renditen und Bankkonditionen subventionierten Formen, Die Entwicklung entspricht nicht den Idealen einer freien Welt. Und es ist möglich, sie zu kritisieren, ohne auf Vorwürfe wie Neid oder Gleichmacherei reagieren zu müssen.
Man muss sich nicht mögen – “How Google Works”
[su_dropcap]I[/su_dropcap]ch hab die signierte Ausgabe. Ich weiß nicht, ob mir das ein paar Nerd-Glamour-Punkte verschafft; schließlich gabs die ganz unglamourös am Flughafen zu kaufen. Und „How Google Works“, das Buch von Ex-Google-CEO Eric Schmidt und Ex-Google-Head of Products Jonathan Rosenberg ist nette Fluglektüre. Bekanntes und Erwartbares, das aber natürlich dadurch faszinierend ist, dass es sich offensichtlich auch praktisch bewährt hat.
Es ist wenig neues drin, das man nicht schon über Google gehört hätte.
Ein merkwürdiger Aspekt ist trotzdem bei mir hängengeblieben. Schmidt und Rosenberg lassen keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass Recruiting die wichtigste Managementaufgabe ist. Die Auswahl der besonderen Typen, die aus eigenem Antrieb das Außergewöhnliche schaffen, die Wochenenden opfern, um Probleme zu lösen, die nicht ihre sind und die neue Wege suchen, anstatt Prozesse abzuarbeiten, ist natürlich die Kernfunktion einer Organisation, die Innovation als ihr Lebenselixier betrachtet. Und natürlich lese ich so etwas überkritisch und wahrscheinlich auch mit unangemessenen europäischen Maßstäben. Aber mich beschleicht immer wieder der Verdacht, dass diejenigen, die das Außergewöhnliche so ausdrücklich betonen, irgendwo selbst die langweiligsten Menschen sein müssen. Und dass Außergewöhnlichkeit ihren Rahmen braucht, das heisst Außergewöhnlichkeit existiert nur dann, wenn Gewöhnlichkeit vorausgesetzt wird. Google, sagen Schmidt und Rosenberg, schafft eine Unternehmenskultur, die aussergewöhnliche Menschen anzieht. Offensichtlich, um sich an und in einer Kultur messen zu können, in der im Inneren andere Regeln gelten, während sie ihre Umgebung nicht in Frage stellt.
Google hat kein funktionierendes Paid Service auf den Markt gebracht. Google hat Werbe-Abrechnungsmodelle verändert, aber nicht die Werbefinanzierung als Grundlage von Massendienstleistungen. Google-Services haben manchmal katastrophale Benutzerverwaltungsfunktionen und nie mehr als Me-Too Social-Komponenten. Aber Google-Services sind oft die Grundlage von vielem, das sich darauf aufbauen lässt (wenn sie dann nicht unvermittelt wieder abgedreht werden). Und niemand hat etwas besser funktionierendes hervorgebracht.
Ich wäre auch nicht so skeptisch, wenn Schmidt und Rosenberg in ihrem Text dann nicht doch häufig Stanford und andere Elite-Unis oder gar Mc Kinsey als ergiebige Recruiting-Quellen erwähnen würden.
Das Außergewöhnliche organisieren?
Ich habe weder etwas gegen gute Ausbildung noch gegen Google – nur gegen die inflationäre Verbreitung des Außergewöhnlichen. Das Außergewöhnliche, noch nie Dagewesene wird nicht in Organisationen stattfinden; es wird nicht dort stattfinden, wo mehr oder weniger trotz allem traditionelle Businessmodelle im Spiel sind. Ich glaube auch nicht, dass wir es lang suchen müssen – es findet täglich statt. Aber es passt nicht in Konzepte und Businessmodelle und hat keine Credits.
Und ich glaube nicht daran, dass Organisationen Außergewöhnlichkeit fördern können. Ich denke eher, dass die Festschreibung des Status „Außergewöhnlich“, in Verbindung mit dem impliziten Kochrezept „So wird auch Ihre Organisation außergewöhnlich“, den Blick auf das Außergewöhnliche verstellt, das noch kommen könnte. Und ich wundere mich über Außergewöhnliche, die sich dann mit Kinotickets und Nationalparkbesuchen auf Firmenkosten begeistern lassen (so beschreiben das Schmidt und Rosenberg). – Wahrscheinlich ist eher generell die Begeisterungsfähigkeit der grundlegende Unterschied. Manche Menschen lassen sich begeistern – und schätzen dann auch Kinotickets, bei anderen funktioniert das nicht. In Geld (zumindest gemessen an Gehältern der europäischen Kommunikationsbranche) ist auch der Unterschied zwischen „Ich mach eh“ und „Ich will machen“ nicht zu bezahlen.
Und ich nehme mal an, Schmidt und Rosenberg wissen das. Zumindest nennen sie als eines der KO-Kriterien bei ihrer Suche nach außergewöhnlichen und leidenschaftlichen Mitarbeitern die häufige Verwendung des Wortes „passionate“. Wenn jemand „passionate“ verwendet, um sich und seine Leidenschaft zu beschreiben, dann ist davon auszugehen, dass es mit seiner Leidenschaft nicht weit her ist – sonst würde er ja von seiner Leidenschaft reden…
Wenn es allerdings eine Unternehmenskultur schafft, diesen Trieb des „Ich will machen“ nicht zu behindern, dann ist das eine echt coole Errungenschaft. Und zugleich etwas sehr Unösterreichisches. Vielleicht ist es aber auch die Königsklasse der Manipulation – gegen die das Einfrieren von Eizellen auf Unternehmenskosten ein niedrigschwelliger Betriebsrats-Incentive ist.
Man muss sich nicht mögen
Außergewöhnlich, jetzt sage ich das auch mal, ist jedenfalls die von Schmidt und Rosenberg beschriebene Recruiting-Strategie, die vieles von dem, was wir über Führung glauben, auf den Kopf stellt: Interviews führen weder Personalspezialisten noch Manager, sondern Mitarbeiter – quer aus allen Bereichen und Hierarchieebenen. Sie sollen bewerten, ob der oder die Kandidat_in etwas drauf hat, ob er oder sie bei Google zurechtkommt, und ob sie mit Ja oder Nein stimmen würden. Interviews finden in mehreren Runden statt und werden in standardisierten Listen ausgewertet. Entschieden wird anhand der Daten. Auf jeden Fall nicht entschieden wird durch die Führungskraft, in deren Team der oder die Neue landen soll. Sympathie soll keine Rolle spielen (sondern eben die Daten), Teams, so Schmidt und Rosenberg, ändern sich zu schnell, und – man muss sich nicht mögen. Gut funktionierende Teams zeichnen sich für Schmidt und Rosenberg nicht durch die Chemie aus, sondern dadurch, dass jeder genug eigenen Antrieb hat, um selbst etwas tun zu wollen. Und die Rolle des Managers ist es nicht, für Harmonie und Wohlbefinden zu sorgen, sondern jedem den Spielraum zu geben, sich bewegen zu können.
Also ich find das so ja gemütlich…
Free to Pee – Freiheit und Geschäftsmodelle
Was man in ein paar Tagen in Kalifornien über Geschäftsmodelle lernen kann.
Ich mag Kalifornien. Wobei das eigentlich eine dumme Aussage ist; ein Konstrukt, das in der Phantasie jedes einzelnen anders ist, zu mögen, heisst ja genau genommen, seine eigene Vorstellung, oder schlicht sich selbst zu mögen. Und je allgemeiner das Konstrukt ist, desto schwerer fällt es, dieses dann auch bei näheren Kennenlernen noch zu mögen. – Ein paar willkürliche Notizen nach ein paar Tagen Kalifornien.
“Careless Lifestyle” war das Motto eines Luxusautovermieters am Sunset Boulevard in Los Angeles. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Übersetzungsfehler war oder eine eben wirklich ansprechende Beschreibung. Die orange, silber und gelb glitzernden Schlitten waren bunter als die Transformer-Camaro-Remakes, mit denen sich Touristenkinder am Hollywood Boulevard fotografieren lassen können.
Am nächsten Tag parkten einige dieser Autos vor einer Galerie im West Hollywood Design District. Was im L.A. Weekly wie eine Vernissage für dich und mich angekündigt war, war ein für L.A.-Verhältnisse wahrscheinlich mickriges Society-Event mit Men in Black an der Tür und roten Absperr-Kordeln davor. Ich bin trotzdem reingegangen, obwohl ich nach einem Tag zu Fuß in den Hollywood Hills aussah, als wäre ich eben zu Fuß von Las Vegas nach Los Angeles gegangen. Rausgeworfen hat mich niemand, aber spürbar war doch: Die Offenheit hat dort ihre Grenzen, wo Zugehörigkeitssymbole außer acht gelassen werden.
Das ist in diesem Fall nichts neues. Plakate im Shepard Fairey-Stil für John Wellington Ennis’ Film Pay 2 Play ziehen sich derzeit durch die USA. Wer mitreden will, so die These, muss zahlen. Der Film bezieht sich auf die Politik und den Einfluß mächtiger Lobbyisten.
Die Grenzen zwischen bezahlt und gratis ziehen sich aber durch weit mehr Bereiche.
Das merkt man eben etwa auf dem Weg zu Fuss durch Los Angeles: Es gibt kaum öffentliche Plätze und die meisten Straßen sind nicht dafür gemacht, sich durch sie zu bewegen. Es sind Wohngegenden, in denen der, dem dort nichts gehört, ein Ärgernis ist, und die für den, dem dort nichts gehört, ein Hindernis auf dem Weg sind. (Wobei es auch Unsinn ist, dass man in L.A. unbedingt ein Auto braucht – das ändert wenig an der Stadt. Und das öffentliche Verkehrsnetz ist gut (abgesehen davon, dass die Busse mangels Busspuren im Verkehr steckenbleiben), nur dessen Beschilderungen in der Stadt und die digitalen Öffiplaner-Apps sind grottenschlecht.) Die Stadt sagt: Wenn dir etwas nicht gehört, dann hast du dort nichts verloren.
Das sagt auch der Highway: Die Express Lane ist für zahlende Kunden reserviert, nicht etwa für Busse oder Einsatzfahrzeuge. Ausnahmen gibt es immerhin für Fahrgemeinschaften.
Und auch Strassenfeste kosten Eintritt. Das sind Feste mit Volksfest- oder Flohmarkt-Charakter, also Events, die man besucht, um dort Geld auszugeben. Allerdings wird man vorher schon zur Kasse gebeten.
Genauso wie im Flugzeug: Sitzkategorien und Gepäck gegen Aufpreis ok, aber die Boarding-Reihenfolge? Für 15$ Aufpreis darf man nach Business Class, Militärangehörigen und anderen Priority-Gruppen und vor dem gemeinen Volk ins Flugzeug, mit dem Argument, mehr Zeit zu haben, um das Handgepäck zu verstauen.
Zumindest das Group 1 Boarding scheint nicht besonders beliebt zu sein. Kein Wunder. Schliesslich haben die gepäckbeladenen Fluggäste ja vorher auch schon 5$ für den Gepäckwagen bezahlt. Bezahlt, nicht als Kaution hinterlegt.
Das schafft Trennlinien und eine Dynamik, die noch deutlicher zwischen denen, die mitkönnen und denen, die es eben nicht mehr können, unterscheidet. Grenzen entstehen schneller und sind nicht mehr so leicht zu schliessen.
Die Verkaufsshow läuft. – Der Stern beklagte unlängst, dass sich Deutsche im Vergleich zu Österreichern immer unterverkaufen. Das ist aus Sicht des gelernten Österreichers, der Deutsche ja schon einmal grundsätzlich für großgoschert hält, lustig. Andererseits sagt es auch: Die einen sind unterverkauft, nicht die anderen überverkauft. Natürlich hat das eine Mengen an Gründen, die sich schon vom Kindergartenalter an entwickeln. Und es steigert die erzielbaren Preise. Was dabei aber offen bleibt: Die Preise wofür?
Ein Tag in den Universal Studios kostet 130$, und die Schlange an den Kassen wartet geduldig; neben der Hauptkasse gibt es noch die Sonderabfertigung für Jahreskartenbesitzer und die Expresskasse für Selbstbedienung per Kreditkarte. Ein Tag im wenige Kilometer entfernten Getty Center kostet nichts. Wobei auch das Getty Center in seiner Kommunikation nicht gerade schüchtern ist. “We preserve the world’s cultural heritage”, ist das Motto von Stiftung, Forschungseinrichtungen und Museum. Und es ist jetzt gar nicht so großgoschert, zu behaupten, dass die besseren Landschlösser in Europa kulturell eine größere Bandbreite abdecken als das Getty.
Was wird sonst so verkauft? – Fett, Salz, Zucker und eine Marketingindustrie, die sich als Technologie- und Innovationsbranche tarnt.
Und was mir zumindest neu war: Die USA haben wieder eine kommunistische Partei. Und auch die ist nicht nur eine kommunistische Partei, sondern die revolutionäre kommunistische Partei. Parteichef Bob Avakian tritt mit der Aura eines Gurus auf, und auch er verkauft seine Ideen: Die Ideen der kommunistischen Revolution gibt es in eigenen Revolutions-Buchgeschäften zu kaufen; das Personal dort wünscht dem Käufer dann alles Gute und viel Inspiration dabei, von den “tremendous improvements in humanity” zu lernen, die russische und chinesische Revolution mit sich gebracht haben. – Immerhin reden auch Leute wie Cornel West mit Avakian.
Und auch im Copyshop publizierte anarchistische Schriften kosten in den Anarcho-Shops in der Haight Street in San Francisco Geld – mehr als die Vervielfältigungskosten. Schliesslich sind auch Buchpräsentationen in den USA nicht kostenlos. Investor und Paypal-Mitbegründer Peter Thiel präsentierte in Santa Clara sein “Zero to One” mit gestaffelten Eintrittspreisen zwischen 25 und 55$ für das VIP-Package (inklusive Buch und Priority-Seating).
Und die Breakdancer an der Fisherman’s Wharf schaffen es ebenso 20$-Tips zu lukrieren wie die Obdachlosentanzcombo daneben, deren Geschäftsidee darin besteht, in Obdachlosenoutfits mit Obdachlosenmoves zu den Beats eines wahrscheinlich auch obdachlosen Schlagzeugers zu tanzen.
Der Reflex wäre ja, einfach nein zu sagen und Verkaufsshows zu verweigern. Denn die Frage, was wir eigentlich verkaufen wollen, bliebe dabei immer noch offen. Das Geschäftsmodell, einfach alles zu verrechnen, hat aber seinen Reiz. Allerdings auch seine Risiken: Buchpräsentationen in Europa setzen ja eher darauf, Gäste mit Geschenken oder Verlosungen anzulocken, statt sie zahlen zu lassen – weil sonst einfach gar niemand mehr kommt.
Die Idee, auf bargeldloses Wohlgefallen zu hoffen, ist allerdings genau so riskant. Wo nichts verlangt wird, wird nichts bezahlt. Und wo die Grenze zwischen „Das mach ich für Geld“ und „Das mache ich wirklich“ aufrecht bleibt, heisst es eigentlich: Wer bezahlt, bekommt nicht die beste Qualität…
Die angebliche Gratismentalität, darauf möchte ich hinaus, ist kein Symptom eines Online-Zeitalters. Sie hat eher damit zu tun, dass wir viele Dinge als gratis empfinden, für die wir auf Umwegen (etwa über Steuern) zahlen. Wo es diese Umwege nicht gibt, wird eher direkt verrechnet. Wo es sie in abgewandelter Form gibt (wir zahlen für den Onlinezugang in Geld und für Werbung in Form von Zeit und Aufmerksamkeit), sinkt die Zahlungsbereitschaft wieder.
Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich schlicht Neid. Warum sollte man für etwas zahlen, das man selbst in ähnlicher Form gratis anbietet? – Die Einstellung verhindert aber, dass das Geld dorthin fliesst, wo man es selbst gern hätte. Oder umgekehrt: Die Idee, Geld dorthin zu lenken, wo es sein sollte, verhindert, dass es dorthin fliesst, wo es eigentlich nicht sein sollte (um für Schrott zu bezahlen). Was aber wieder voraussetzen würde, dass sich als daran halten. Auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlt, so komisch eben, wie wenn man sich im Café in San Francisco jedes Mal vor dem Pinkeln beim Barista anmelden muss, damit den elektronischen Türöffner der Klotür öffnet. Aber man hat ja bezahlt…