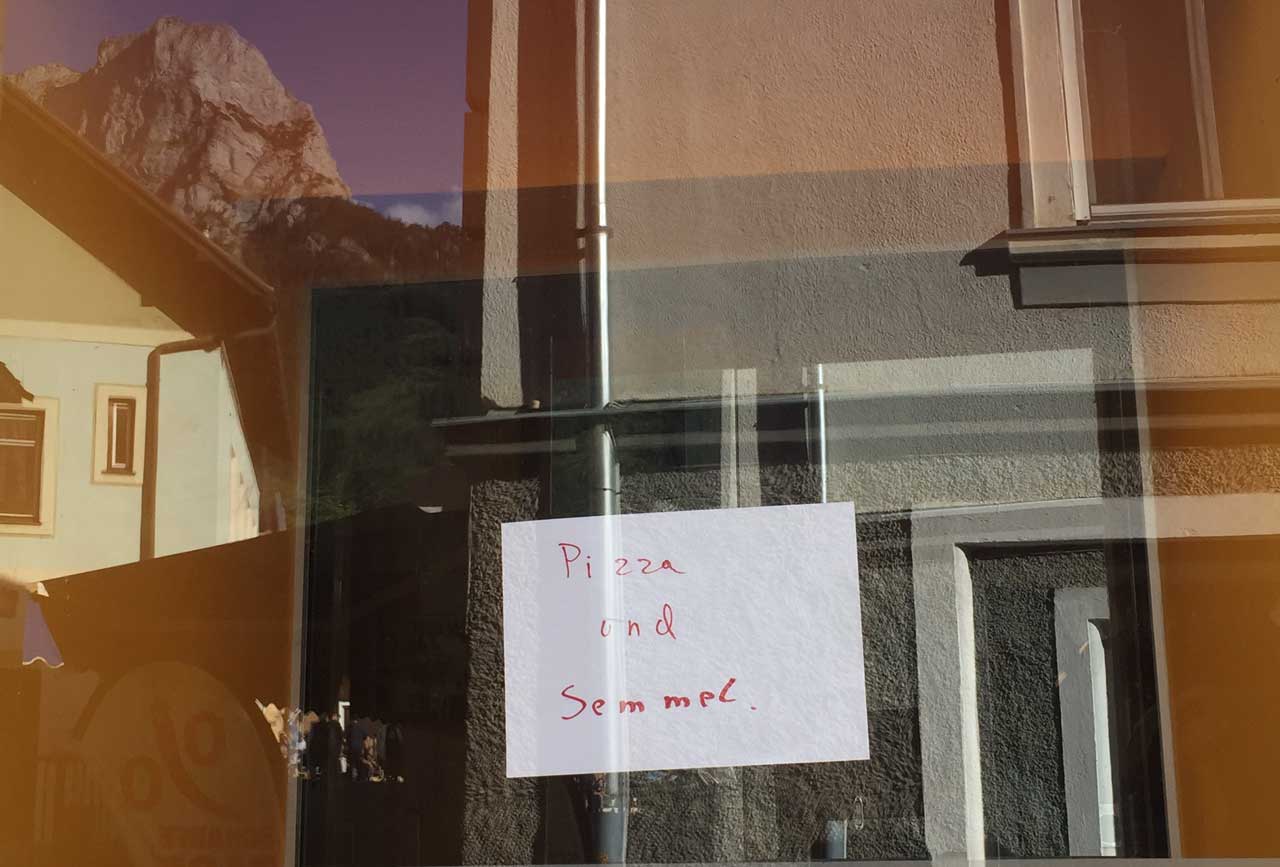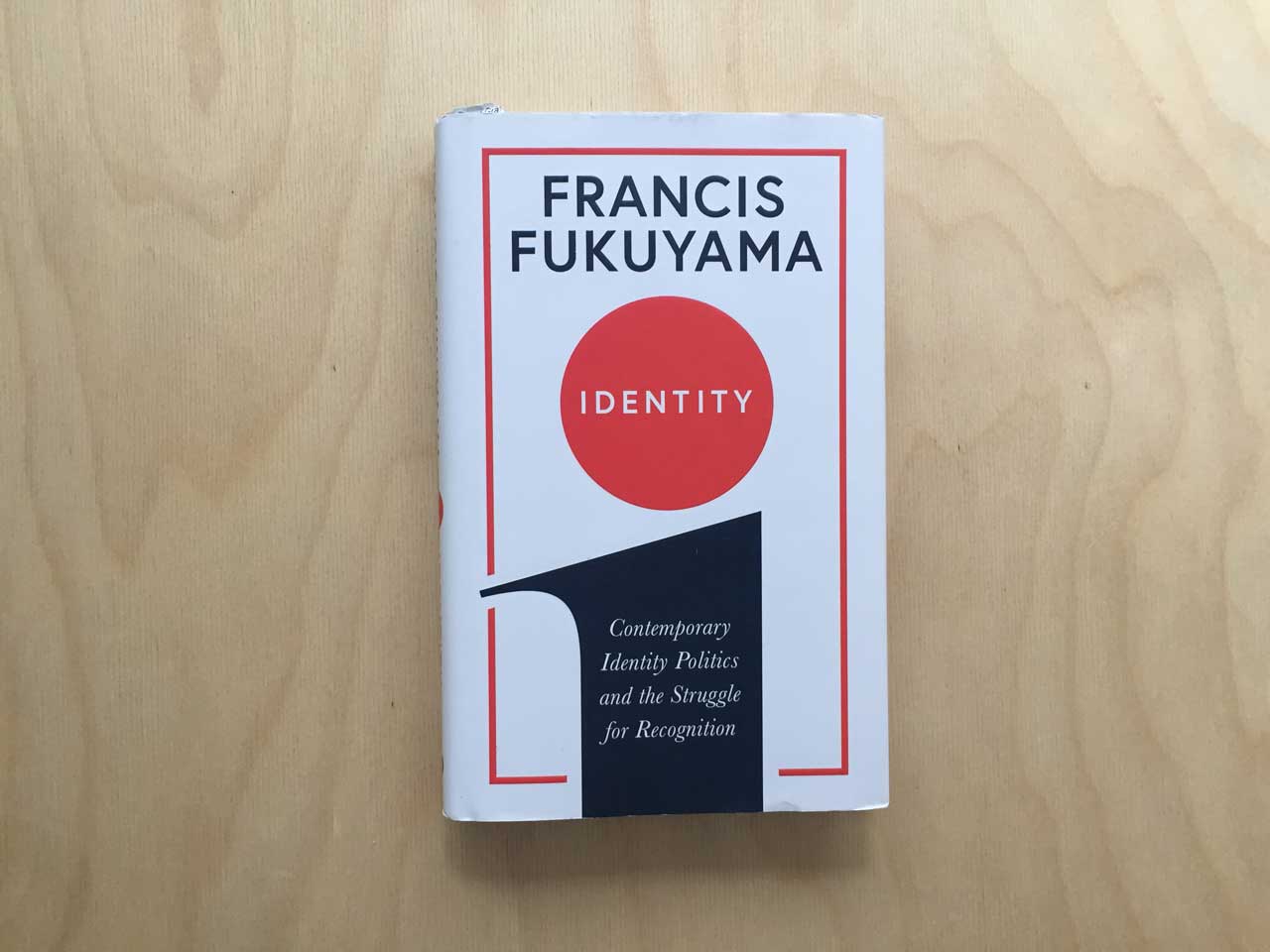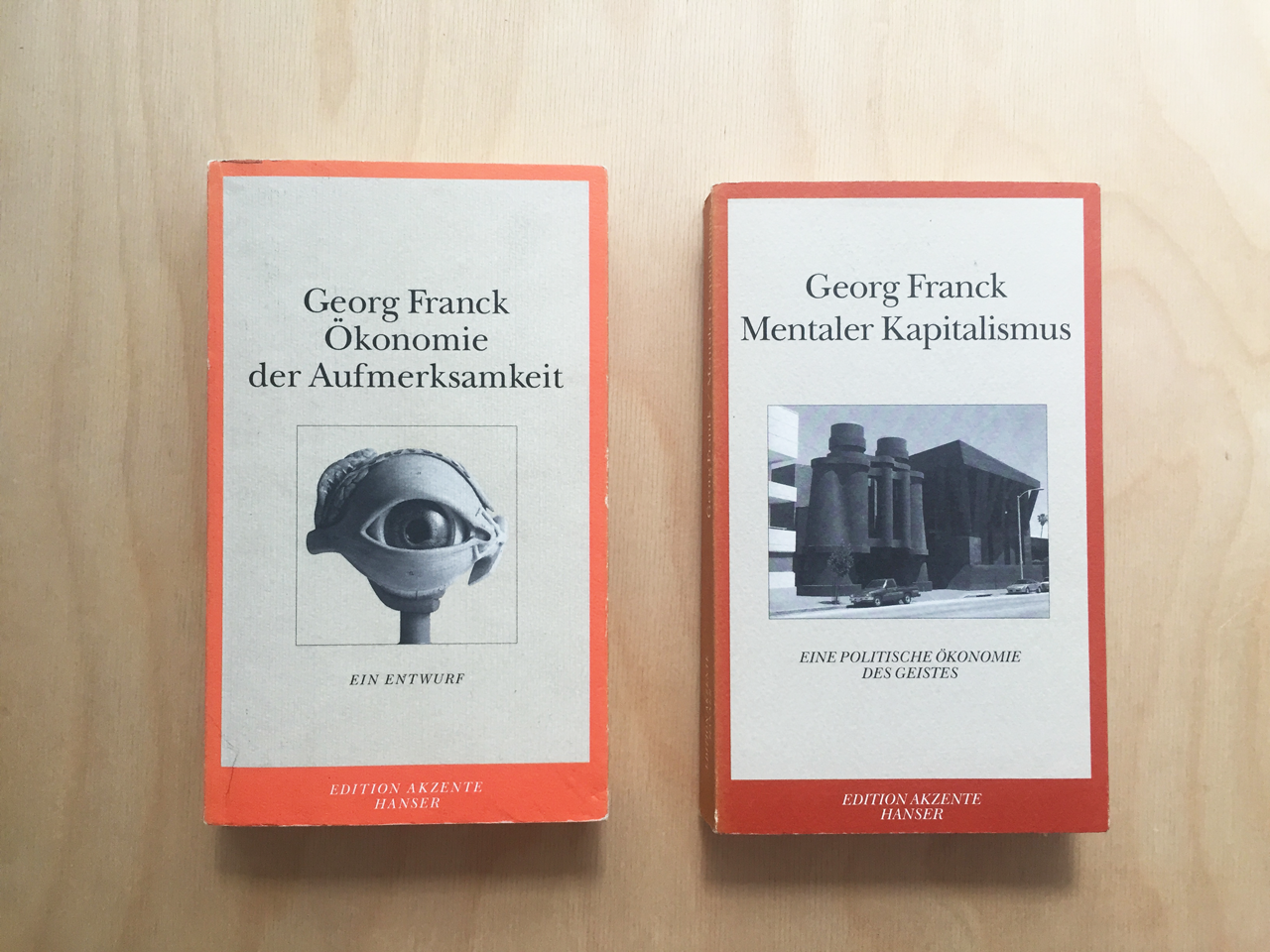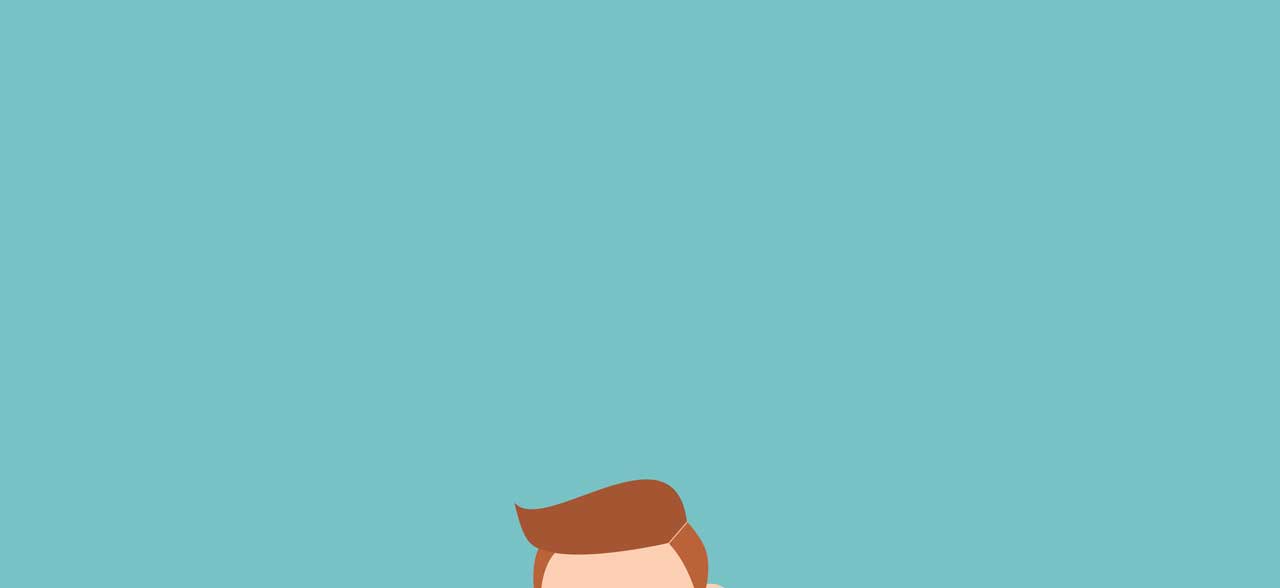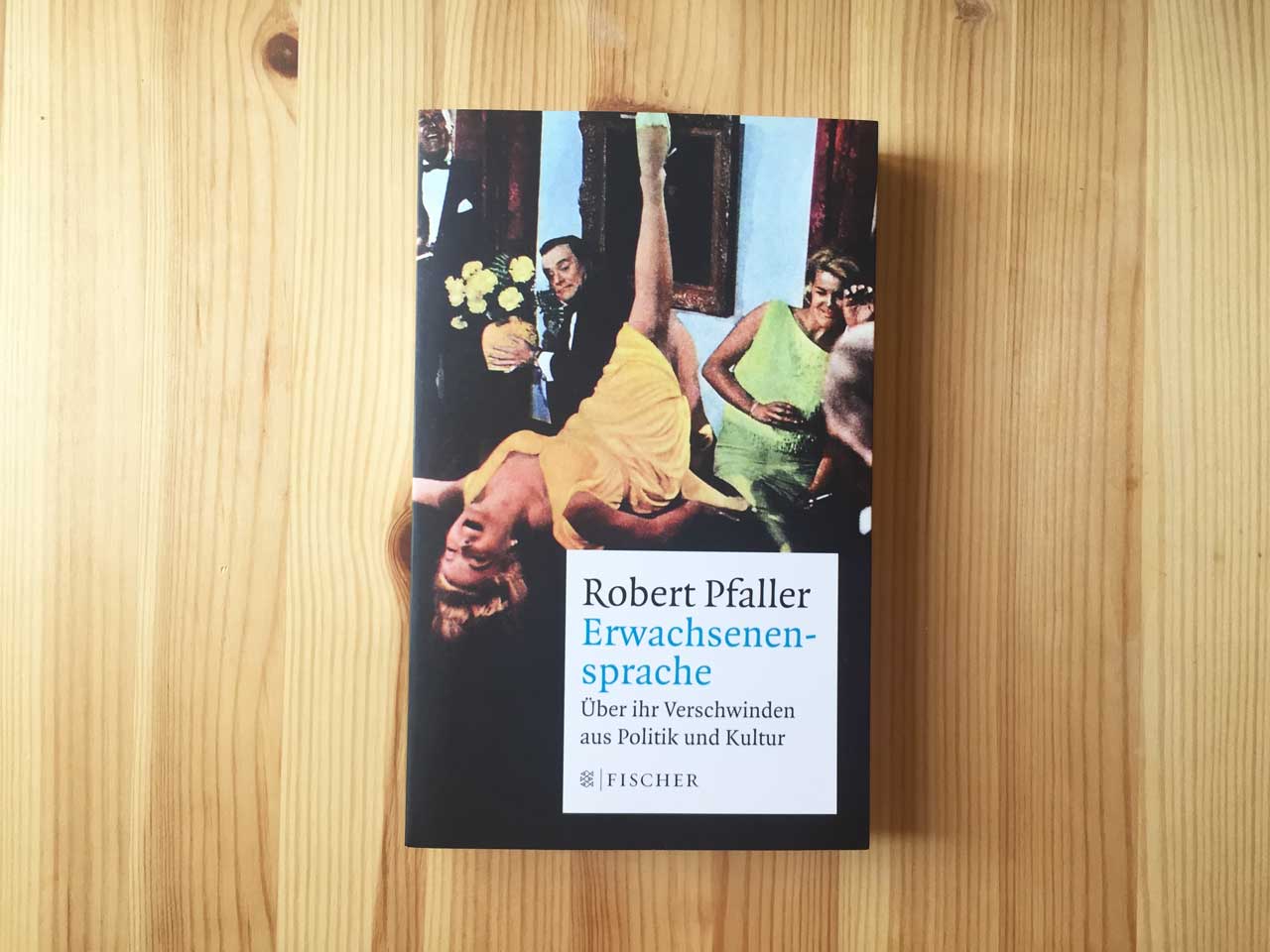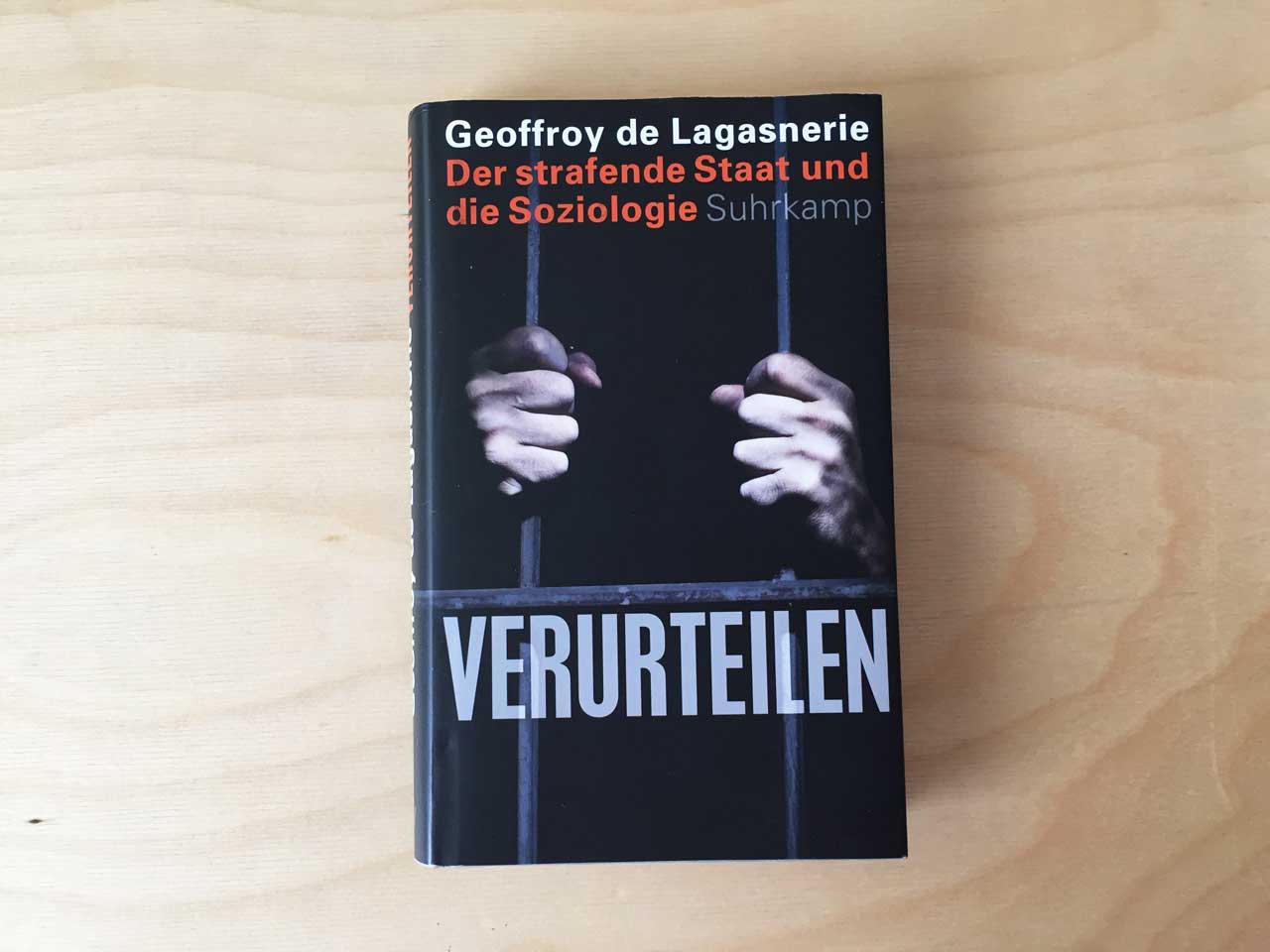„Die PR-Maschine läuft“, twittert Peter Rabl zu einem Link über Greta Thunbergs Schiffsreise nach New York und stellt einen säuerlich dreinblickenden Emoji daneben. Natürlich tut sie das und Gott sei Dank tut sie das – denn sonst wäre es geradezu unheimlich still auf der Welt. Und wenn es dem Herrn Rabe sonst noch niemand verraten hat, dann tu ich es: 95% dessen, womit er in seinem Leben als Journalist zu tun hatte, war PR. Der Rest waren Fehler von PR-Verantwortlichen. Sein Privileg war es, daraus Journalismus machen zu dürfen. PR ist nichts Schlechtes, Engagement ist nichts Schlechtes, der Kampf gegen den Klimawandel ist nichts Schlechtes. Was reitet dann jene, die Greta Thunberg immer nur mit säuerlich abfälligen Kommentaren erwähnen können, die plötzlich offenbar sogar in Politiker_innen, denen man sonst nicht die üblicherweise größte Sachkompetenz zuschreibt, größeres Sach-Knowhow vermuten? Entlang welcher Werte und Überzeugungen verläuft die Grenze zwischen jenen, die soziale Bewegungen hinnehmen können und jenen, die sich darüber entrüsten müssen?
Üblicherweise bin ich, sobald Gruppendynamik Form annimmt, der erste, der einen Schritt zur Seite macht und weder überrannt noch mitgerissen werden möchte. Hier sehe ich die Pressuregroup aber recht eindeutig bei den alten Grantlern. Sie reden sich in einen Strudel, klopfen einander auf Schultern und überbieten einander dabei, nur zu reden, aber nichts zu sagen. (Anmerkung: Sie klopfen einander auf schmäler werdende, hängende Schultern, müsste man sagen, so wie sie gern Greta Thunberg Frisur und Gesichtsform erwähnen.)
Was sagt das also über die Methoden der Weltsicht, wenn manche hier mit Nachdruck Argumente suchen, eine Erfolgsstory nicht gut finden zu müssen? Da gibt es verschiedene Ansätze, über die man nachdenken könnte.
Egozentriker!
Eine erste Idee ist natürlich ein egozentrisches Weltbild. Allerdings hat sich diese simpelste Annahme, die so vielen vorwissenschaftlichen Theorien zugrundelag (Die Sonne drei sich ein die Erde, der Mensch ist das Maß aller Dinge, Ich denke, also bin ich), schon so oft als problematisch bis falsch herausgestellt, dass man eigentlich auch im Grant darüber hinweg sein sollte. Also suchen wir mal weiter,
Verantwortung! Dann ist es vielleicht genau das Gegenteil: Diese erfahrenen Kommentatoren fordern oft Verantwortung ein. Man müsse ethisch handeln, was bedeutet, auch mit den Konsequenzen zu leben. Sie fordern Verantwortungsethik anstelle von Gesinnungethik – etwas nur zu tun, weil es als richtig empfunden wird, ist ihnen zu wenig. Die Konsequenzen entscheiden. Ja und, möchte man jetzt meinen? Die persönliche Konsequenz ist immerhin ein auf den Kopf gestelltes Leben, die geforderte Konsequenz – verträglicher mit der Umwelt umzugehen – schadet jetzt auch niemandem. Also? Weit gefehlt – denn Protestbewegungen ohne Lösungsvorschläge sind wertlos, sagt der gelernte Grantler. Und Greta Thunberg tut schließlich nichts gegen den Klimawandel. Sie verweist auf WissenschaftlerInnen, denen man zuhören solle, auf Verantwortliche, die aktiv werden sollen – aber selber tut sie ja nichts. Außer PR.
Es wäre ziemlich still in einer Welt, in der Kommunikation nach diesen Regeln abliefe. Und die, die nach diesen Regeln etwas sagen dürften, sollten streng genommen dann lieber auch nichts sagen – sondern besser gleich handeln.
Ist das denn überhaupt real?
Eine andere Vermutung: Was ist Protest ohne Handlungsoption schon wert? Ist das überhaupt real, was die Kinder da machen? Es ist ja nur Ideologie – ohne Konsequenz. Und ist falsche Ideologie überhaupt real? Ohne jetzt auf die Frage von richtig oder falsch einzugehen: Ideen und Trends bewegen etwas, ob uns das passt oder nicht. Junge Menschen bewerfen das Goethe-Haus in Weimar mit Klopapierrollen, um auf metaphorische Vergewaltigungsanspielungen in Goethes Gedichten anzuspielen. Man kann dieser Ansicht zustimmen, man kann über Interpreten und Interpretationsmuster von Lyrik nachdenken, man kann das für Schwachsinn halten – jedenfalls ist das Ereignis real und findet auch medialen Niederschlag.
Das ist ein Indiz dafür, dass mit dem Realitätsargument schlecht gegen Trends anzukommen ist. Ein anderes findest sich beim deutschen Philosophen Markus Gabriel, der sich mit seinem Neuen Realismus gegen den „Naturalismus“ wendet, der nur physische Gegenstände als real gelten lässt. Gedanken sind real – auch wenn sie noch so absurd sein sollte. Sie befinden sich in dieser Welt und können Wirkung zeigen. Das ist allerdings nicht mit dem Inhalt der Gedanken zu verwechseln. Der ist, als Teil des Gedankens, zwar real, kann aber trotzdem (also eigentlich: genau deswegen) auch falsch sein.
Wer, wenn nicht wir?
Wer am Wegesrand steht und schlechtgelaunt twittert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Darin sind dann diese Mahner jenen nicht unähnlich, die rund um ihre eigene Existenz einen permanenten Opferkult pflegen. Opfer von Verhältnissen, Strukturen, Verpflichtungen sind gefangen und haben keine Gelegenheit, sich zu bewegen. Sie können bestenfalls reagieren. Andere handeln. Während die einen mit ihrer Existenz beschäftigt sind und am Hamsterrad des Überlebens drehen, gestalten die anderen Bedingungen. Und wenn es ihnen nicht gelingt, haben sie dennoch eine Spur hinterlassen. Hannah Arendt grüßt: Das animal laborans ist Opfer der Umstände, homo faber hinterlässt eine Spur in der Welt. Das ist natürlich schmerzhaft. Und das ist möglicherweise eine Spur: Da handelt jemand und gestaltet die Weltöffentlichkeit – und es ist keine von ihnen. Dann kann man das nicht gutheißen.
Das verwunderliche dabei ist, dass am lautesten jene gehört werden wollen, die im Lauf ihres Lebens ausreichend Gelegenheit hatten, sich Gehör zu verschaffen. Das kann Gewohnheitsssache sein. Oder Charaktersache: Man hört es mit der Zeit für so selbstverständlich, gehört zu werden und recht zu bekommen, dass es nicht mehr ohne geht. Das ist insofern bemerkenswert, als solche harmlos beginnenden Threads wie der eingangs zitierte dann oft zu Laiendiagnosen von ADHS oder Asperger Syndrom führen.
Die Greta-Grenze verläuft ganz einfach zwischen jenen, die einem Menschen Anerkennung und Aufmerksamkeit geben können, und jenen, die beides stets für sich einfordern. Damit ist sie eine sinnvolle Demarkationslinie dafür, mit wem man reden und arbeiten kann, und mit wem eher nicht.