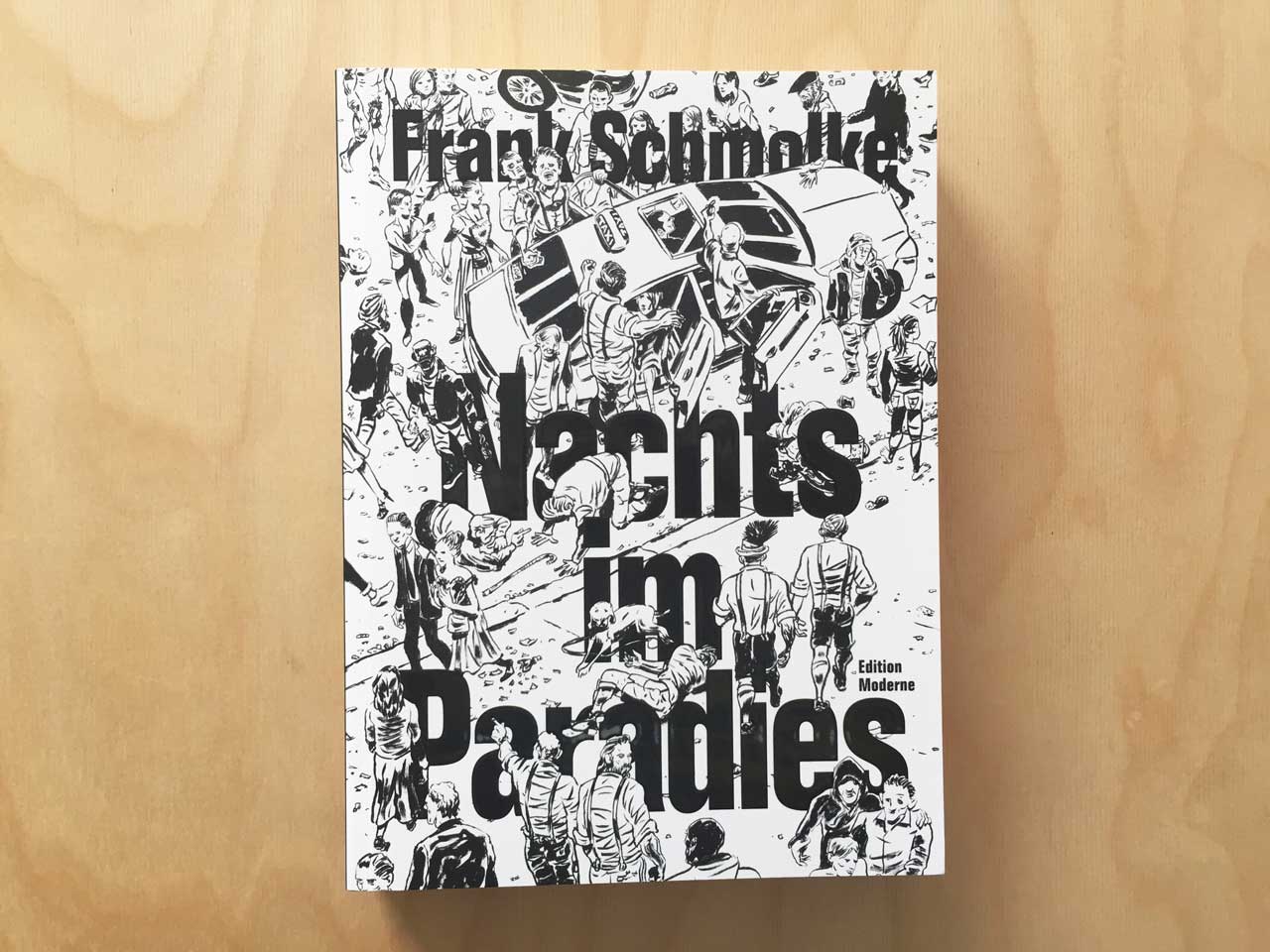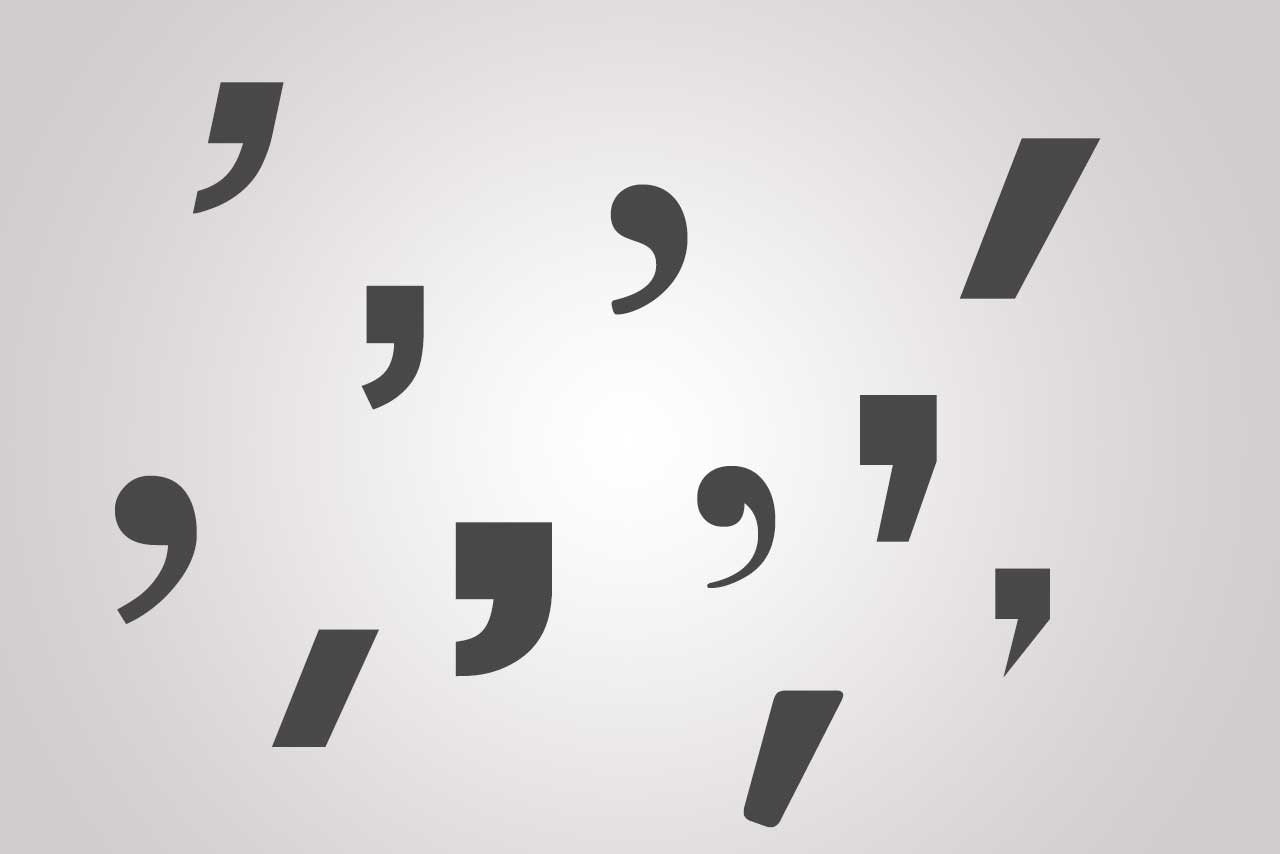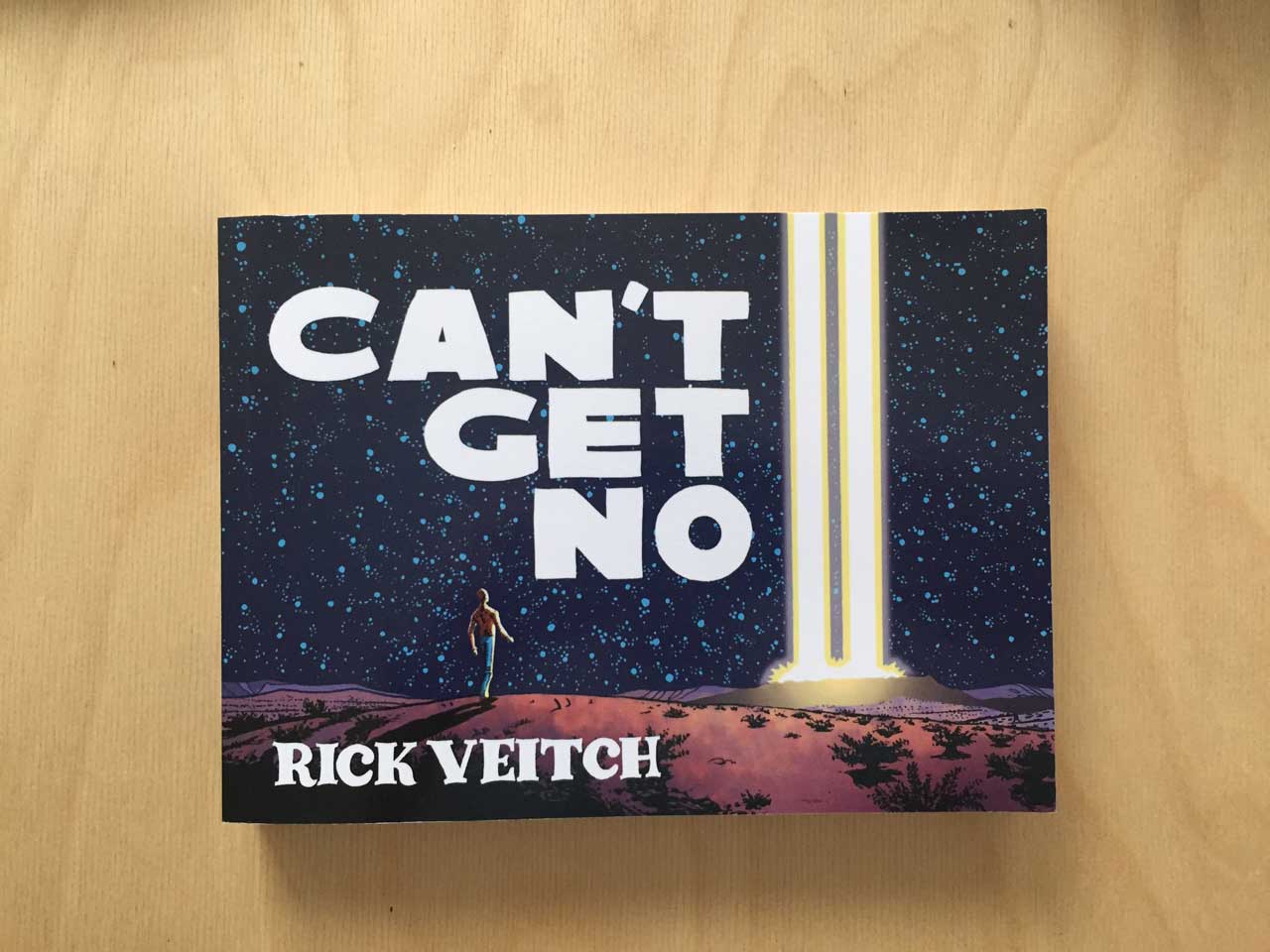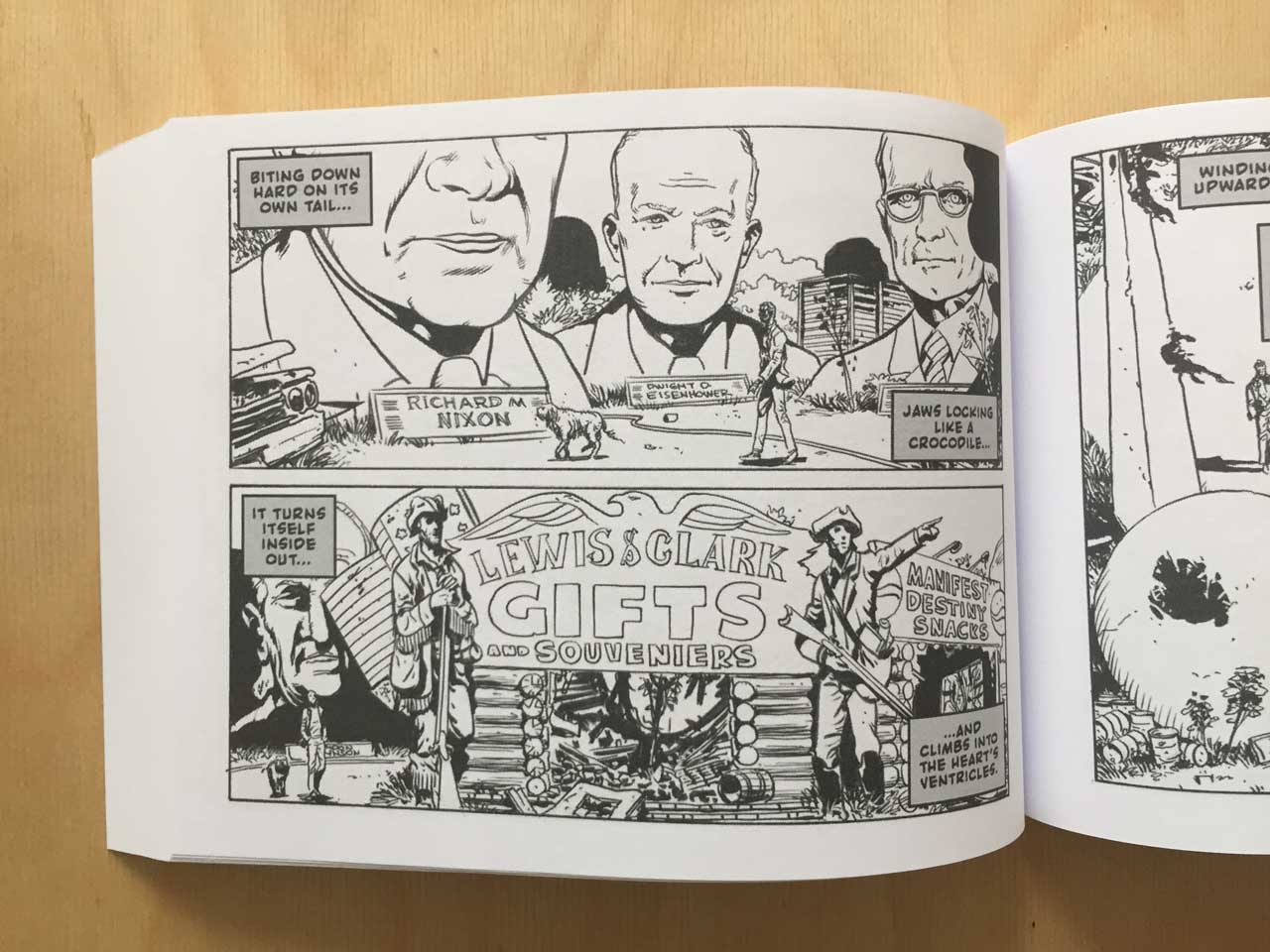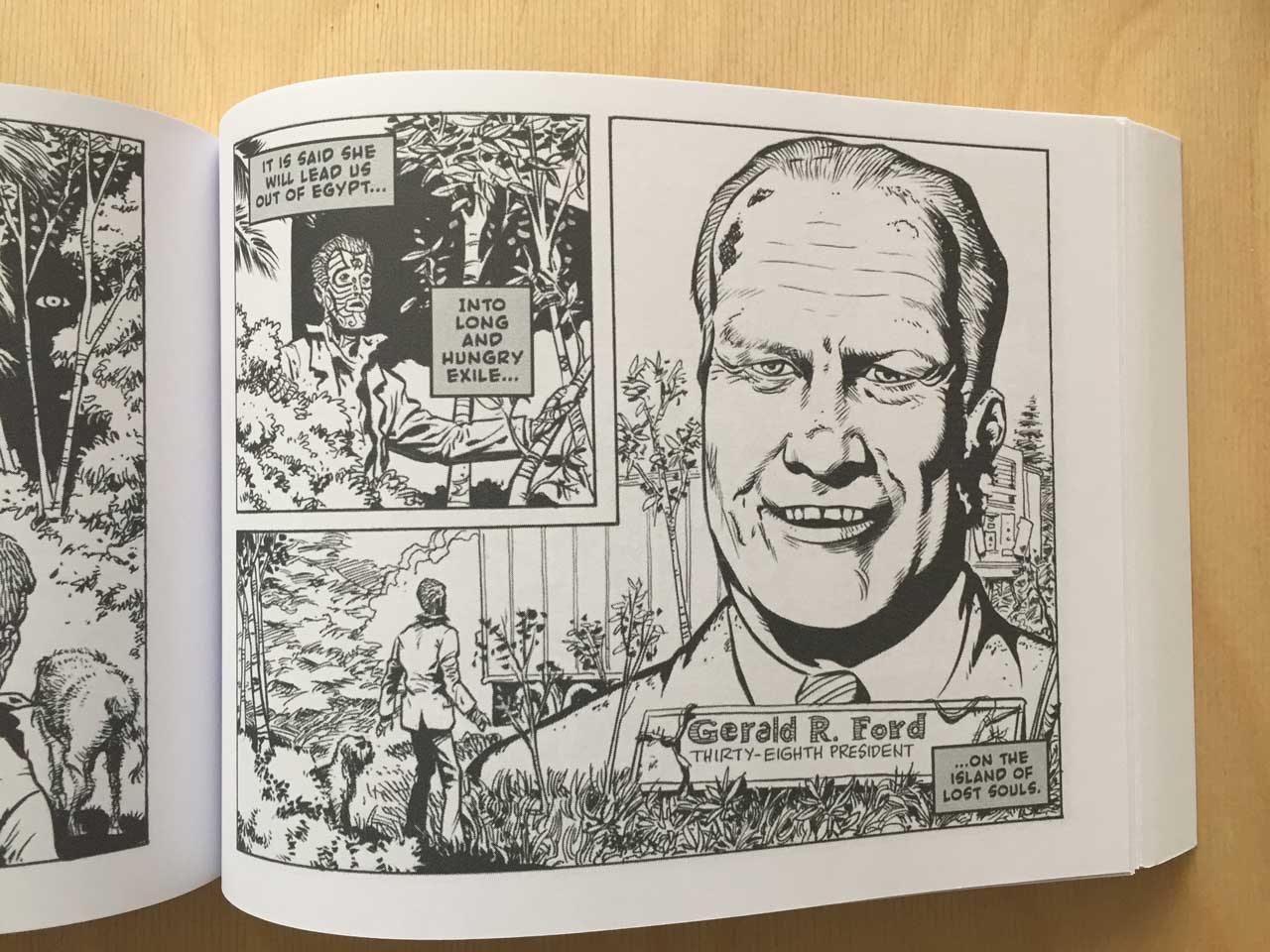Markus Gabriel redet schnell und zackig; „exakt!“ Ist offenbar eines seiner Lieblingsworte im Gespräch. Man merkt: Der Mann har eine Mission. Der Philosoph ist einer der jüngeren Universitätsprofessoren seines Fachs und liefert gekonnt markige Ansagen. Sein Thema ist der Neue Realismus, zu denen Verbreitung er eine populärphilosophisch angelegte Trilogie zur Wirklichkeit verfasst hat.
Der Sinn des Denkens ist der dritte und letzte Teil, der Denken als Sinn im Wortsinn – so wie Geruchssinn oder Tastsinn – etablieren will. Das ist Teil des Unterfangens, zu zeigen, dass Denken etwas wirkliches ist – so wirklich wie Berge, Autos oder Geldprobleme. Letztere haben ja auch kein eindeutiges physisch greifbares Erscheinungsbild.
Für Nichtphilosophen mag das verwunderlich sein. Was soll denn am Denken unwirklich sein? Die Philosophiegeschichte und die Erkenntnistheorie als philosophische Disziplin haben allerdings viel Energie darauf angewendet, zu erklären, wie wir erkennen, in welchem Verhältnis die Außenwelt zu unserem Innenleben steht, und wie das denn eigentlich zusammenpasst. Im Schnelldurchgang: Protagoras sah den Mensch als „Maß aller Dinge“, was auch bedeutete, dass (nur) das existiert, was wir wahrnehmen – auch wenn das noch so falsch und eingeschränkt sei Für Plato saßen Menschen in der Höhle und sahen nur Schattenspiele des Wesentlichen, die an ihre Höhlenwand projiziert wurden. Descartes ist heute noch beliebtes Orakel. Kant erfand ein Ding an sich, das sich ähnlich wie Platos Idee, unserer Wahrnehmung entzieht. Und auch hyperrationale Positivisten hatten noch ihre Probleme, Erkenntnis in Worte zu fassen: Rudolf Carnap und Jehoschua Bar-Hillel beschrieben das Paradoxon, dass wir eigentlich nichts neues erkennen können – entweder es ist neu und steht in keiner Beziehung zu Dagewesenem (dann können wir es nicht einordnen), oder es ist eine Facette dessen, was wir kennen (dann ist es nicht neu).
Es war also durchaus in gewisser Weise strittig, wie real Denken als Bindeglied zwischen innen und außen ist.
Weil das alleine aber och zu wenig sein könnte, um eine aktuelle Debatte anzuheizen, bezieht Gabriel auch Künstliche Intelligenz in seine Überlegungen zu Denken und Wirklichkeit ein. Sein Fazit: Künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, weil sie nicht denkt. Deshalb müsse man sich nicht vor ihr fürchten.
Gabriel erklärt anhand vieler Beispiele, Gedankenexperimente und Begriffe von Denken, warum er bei dieser These bleibt. Dem ist wenig entgegenzusetzen. Allerdings teile ich die Schlussfolgerung, dass KI deshalb kein Problem sei, nicht. Ich glaube auch nicht, dass KI eines Tages selbstständig Pläne fassen, Entscheidungen treffen und die Menschheit vernichten möchte. Ich weiß allerdings, dass auch die simpelste KI, die heute schon als Massenware online verfügbar ist, ausreicht, um unliebsame Probleme zu bereiten. Ist euch denn noch nie Onlinewerbung, die glaubt, sich nach euren Surfgewohnheiten zu richten, auf die Nerven gegangen? Habt ihr noch nie Autocomplete verfügt? Und habt ihr euch noch nie gewundert, was Social Media Algorithmen über euch zu wissen glauben? Vielleicht sind es nicht die Künstlichen Intelligenzen selbst sie „Schlüsse ziehen“ oder „Handlungen ableiten“, was denkenden Individuen vorbehalten ist. Aber sie kombinieren und funktionieren einfach und haben damit Einfluss auf unser Leben. Auch viele Menschen als grundsätzlich denkende Individuen, nehmen oft ohne zu denken negativen Einfluss auf unser Leben. Insofern halte ich diese Fragestellung für etwas verfehlt und wenig relevant.
In einem zweiten aktuellen Bezugspunkt bezieht Gabrie eine etwas andere Position. Er beschäftigt sich auch mit Fake News und anderen digitalen Scheinwelten und kommt zu dem Schluss, dass Filterblasen und Echokammern Erfindungen seien um sich nicht der Wirklichkeit stellen zu müssen. Er sieht Diskurse über Echokammern und Filterblasen als Entfremdung von der Wirklichkeit, als Ausrede, sich nicht der Wirklichkeit zu stellen, dass die Öffentlichkeit einen vielschichtigen Strukturwandel durchlaufen hat. Das bleibt im Gegensatz zu Gabriels sonstigen Ausführungen ein wenig oberflächlich; ich denke auch, dass kaum jemand die Realität und Wirkkraft von Echokammern bestreitet – immerhin haben sie Trump ins Präsidentenamt gehievt (genauso wie Obama). Ihre Bewertung ist eher eine moralische Frage als eine erkenntnistheoretische. Markus Gabriel ist übrigens nicht nennenswert auf Social Media aktiv, was auch hilft, seine Meinung hier einzuschätzen.
Neben den digitalen Debatten, die in Der Sinn des Denkens neu sind, zieht sich die Kritik an jeglicher Form von Konstruktivismus als roter Faden durch Gabriels Überlegungen. Konstruktivismus, der jetzt nicht gerade auf vorsokratischem Niveau dahinspekuliert, ob man möglicherweise allen auf der Welt ist, ist allerdings oft nur eine Methode, in kontingenten Situationen Entscheidungen zu treffen. Es gibt keinen zwingenden, von sozialen Aspekten und anderen Konstrukten unabhängigen Grund, warum etwas so sein soll, wie es ist, oder warum man etwas bestimmtes tun und etwas anderes lassen muss, also muss man eben erklären, warum man der Meinung ist, dass etwas so ist oder dass man so handeln sollte. Und schon hat man etwas konstruiert. – Konstruktivismus ist nicht immer Realitätsfeindlich, sondern oft eine Krücke, mit der sich Realität greifbar machen lässt.
Diese Punkte beschreiben die Schwächen des Neuen Realismus ganz gut. Er bekämpft viele Phantomprobleme, die er es schaffen muss, um sie lösen zu können und dann eben recht zu haben. Noch deutlicher als in der Wirklichkeitstrilogie wird das in dem von Gabriel herausgegebenen Tagungsband „Neuer Realismus“, der sich auf philosophiewissenschaftlicher Ebene mit der Sache befasst.
Das ist beim Lesen manchmal ein wenig ärgerlich – so wie diese Schulterklopfer oder freundschaftlichen Ellbogenrempler, die im Smalltalk Zustimmung heischen wollen, bevor sie eigentlich noch etwas gesagt haben.
Das ist schade, denn die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit der Gedankenwelt als Gegenstück zum reinen Naturalismus, der nur anerkennen will, was greifbar und messbar ist, ist eine wichtige. Spiritualität und ähnliches ist natürlich kein Thema für Gabriel, und auch politische oder soziale Konsequenzen sind nicht sein Ding. In diesen Sphären wird der sonst wo wortreiche Philosoph etwas einsilbig. Dabei gäbe es sicher viele dankbare Abnehmer für leichtfassliche Philosophien zur Macht der Gedanken. Aber mal sehen, was als nächstes kommt.