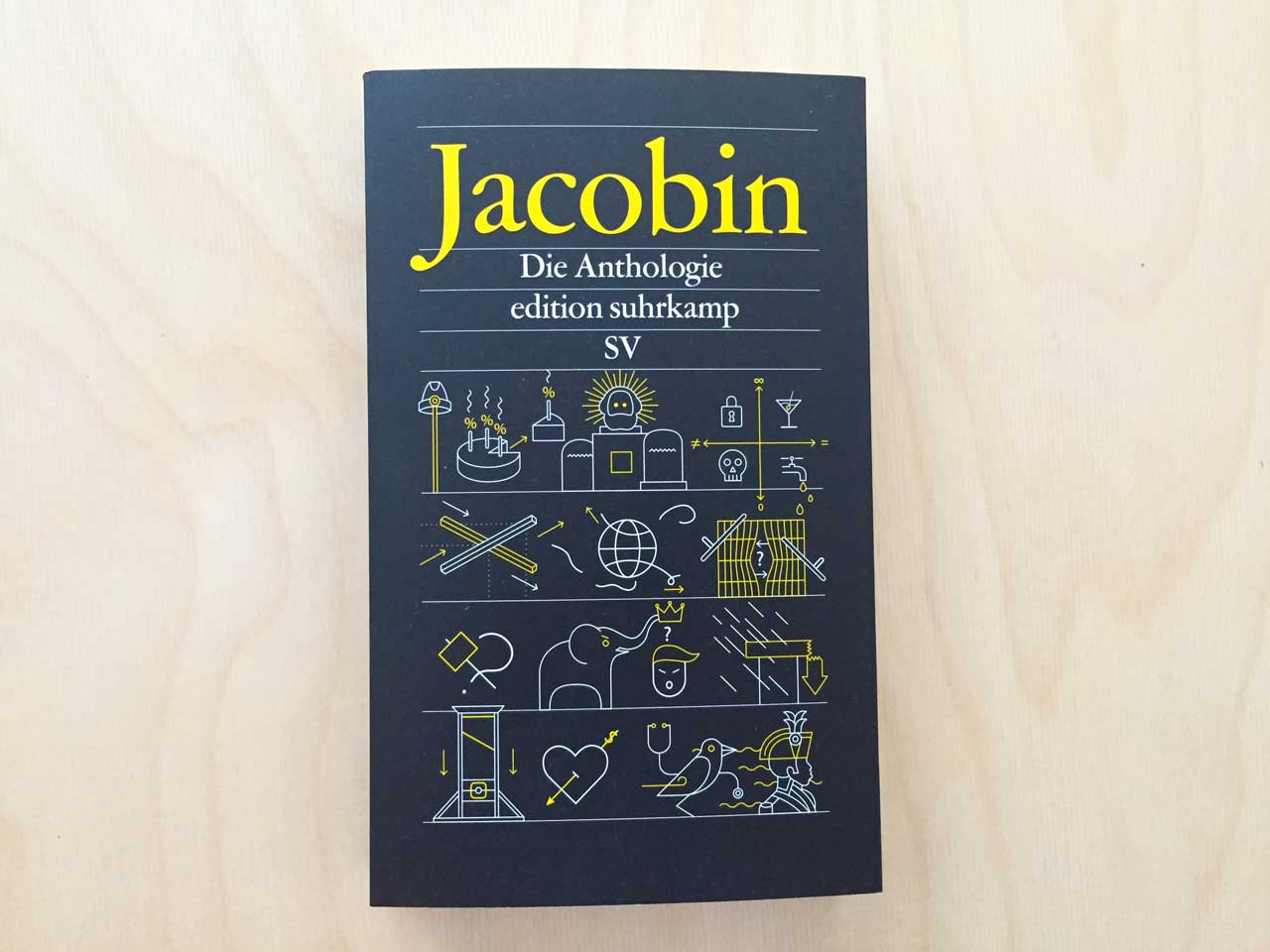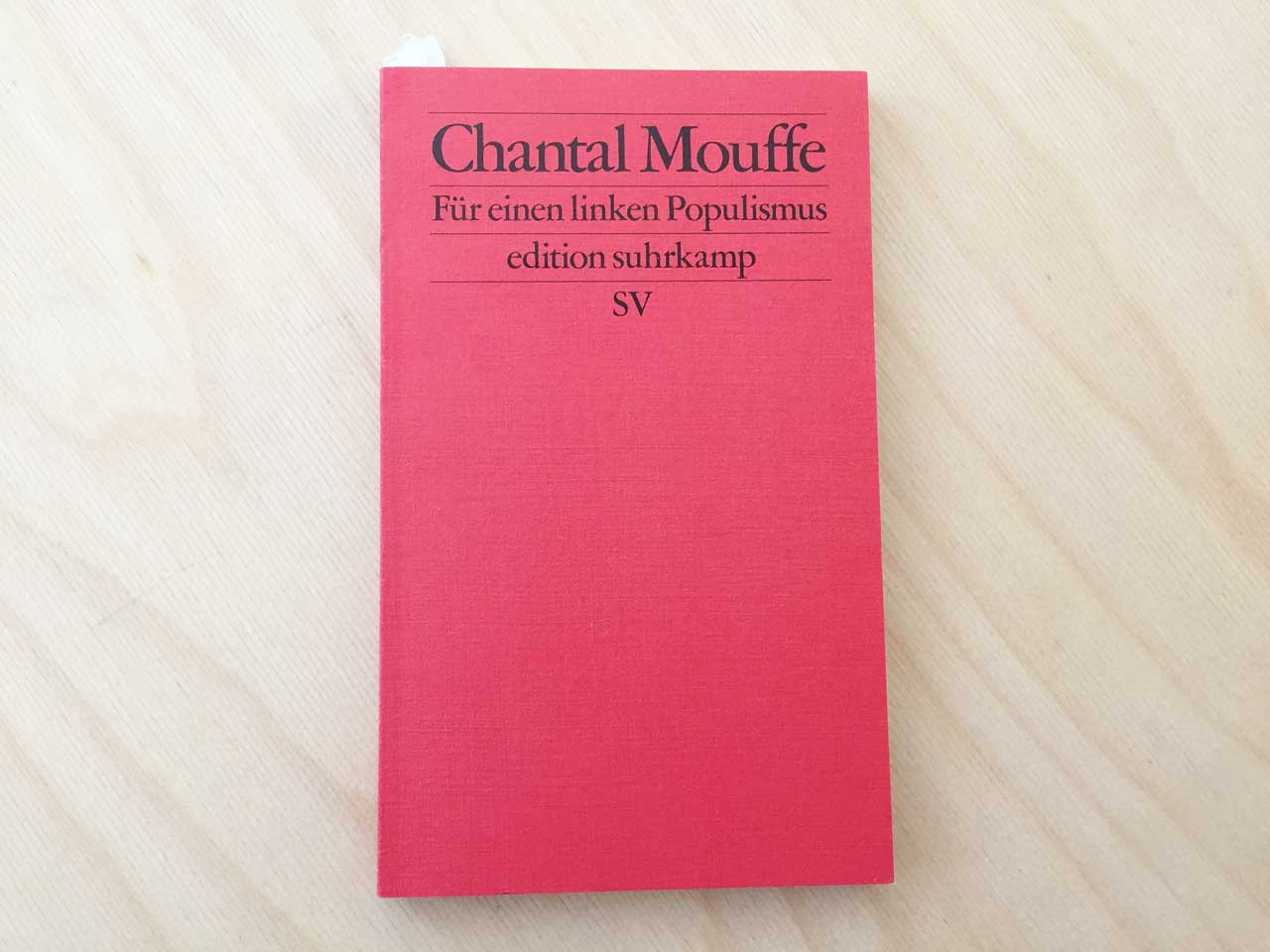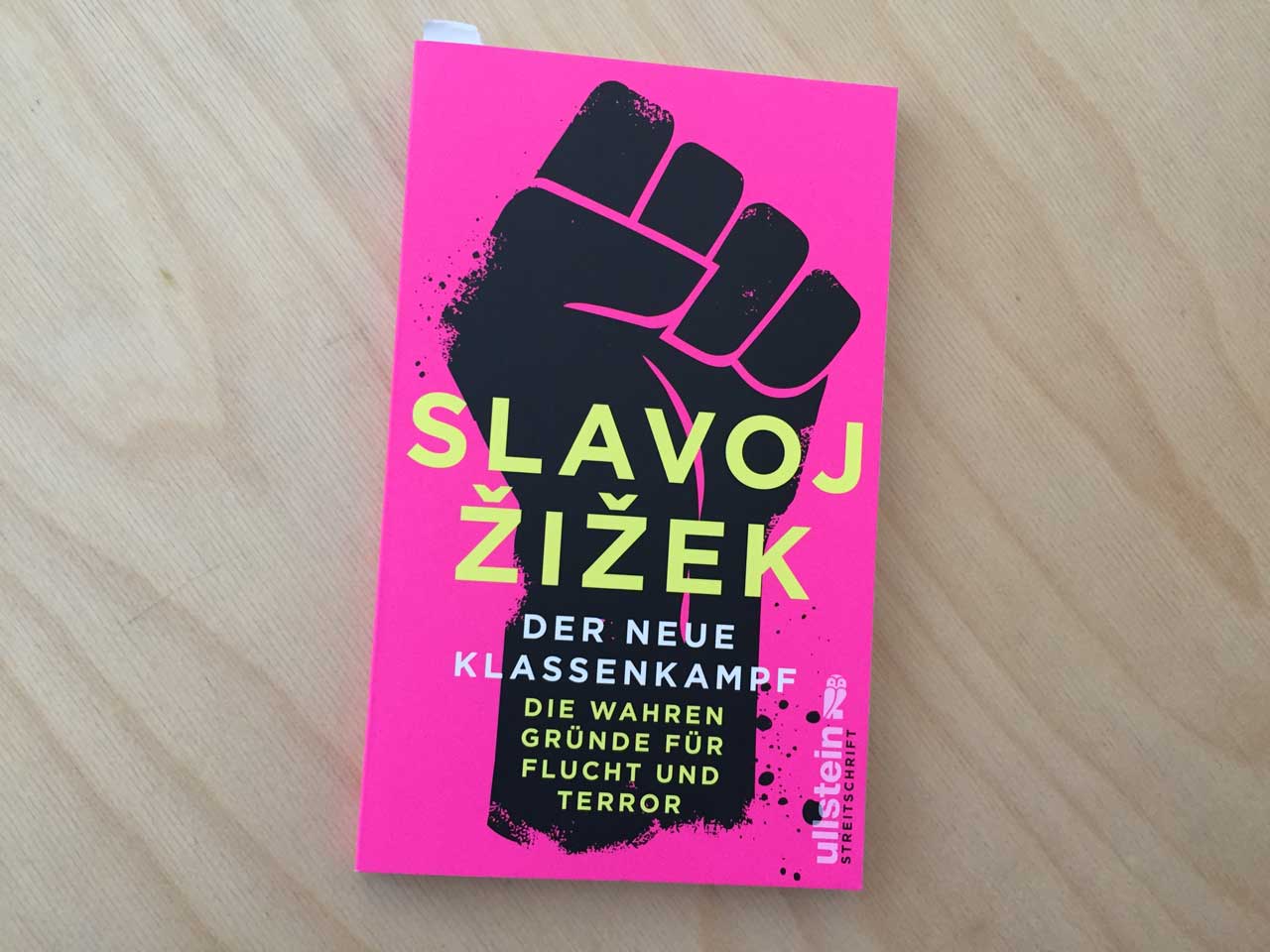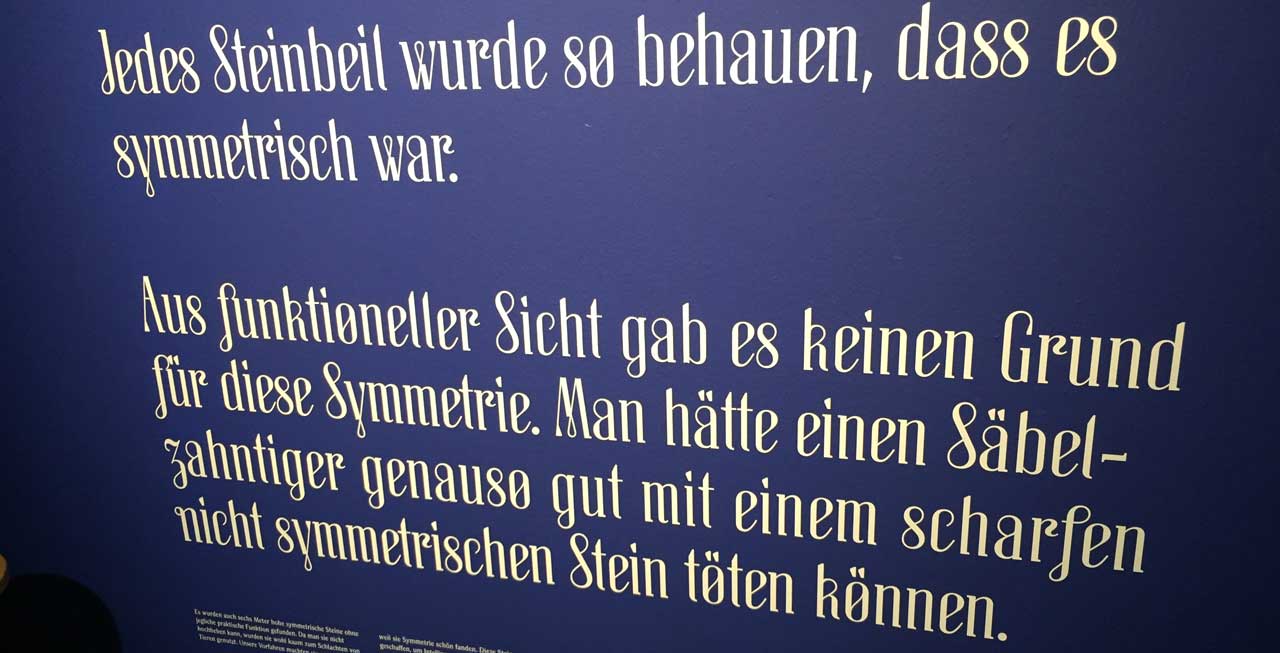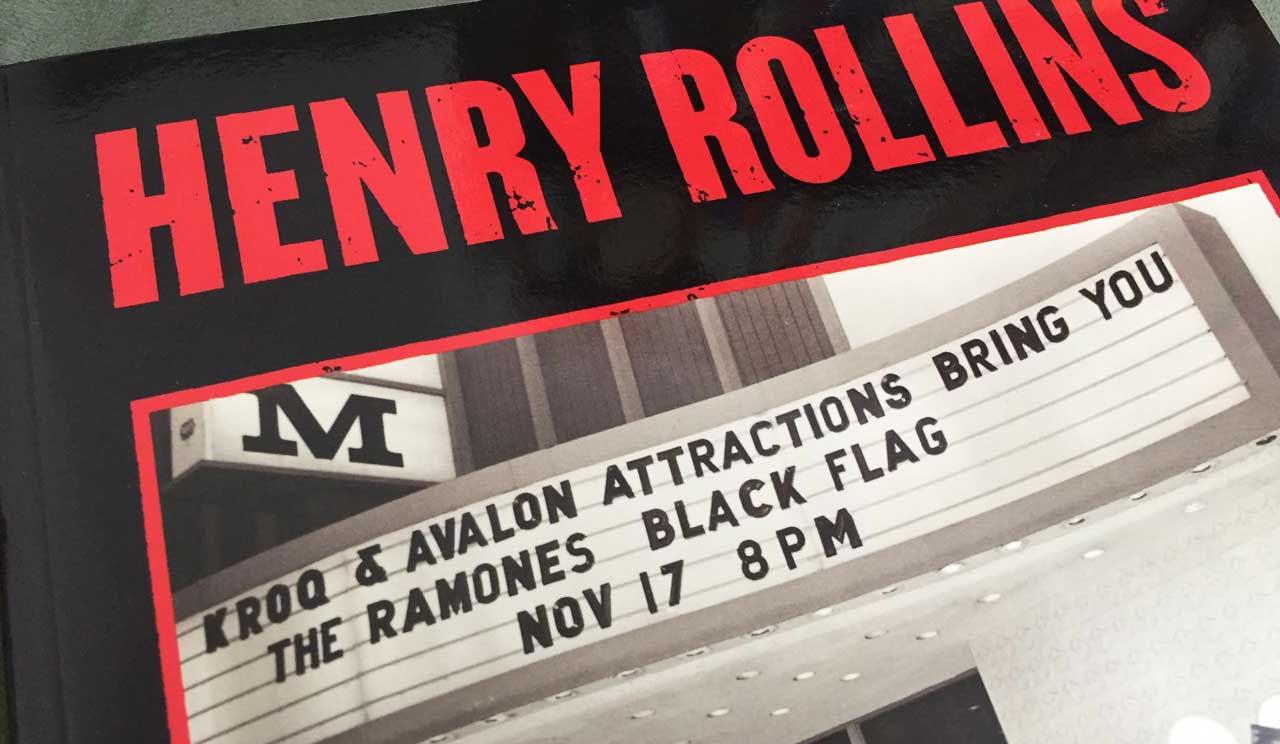Marx stand nie ganz oben auf meiner Leseliste. Als Student war mir da zu wenig Musik drin – Marx beschäftigt sich mit realökonomischen Fragestellungen; Metaphysik, Ontologie und andere spannende Themen finden sich bestenfalls zwischen den Zeilen.
Später, als ich die realökonomischen Fragestellungen spannender fand, hatten für mich andere Zeitgenossen, vor allem die Anarchisten wie Bakunin und Kropotkin mehr zu sagen.
Heute wundert mich ja am meisten, dass Marx auch zu seinem 200. Geburtstag noch nicht als neuer Heiliger der Work Life Balance, der öko-esozentrierten Selbstoptimierung und der Finde-dein-Selbst-Mentalcoaches avanciert ist. Schließlich war er es doch, der grundlegende Unzufriedenheit, Spannungen zwischen Ideellem und Materiellem, zwischen Anspruch und Realem beschrieben hat.
Gelesen habe ich trotzdem bis heute nur das Kapital – und dann auch nie wieder reingeschaut.
Linke Theorie liegt im Moment eher danieder. Das neu erflammende Interesse an Karl Polanyi ist befremdlich, verlässliche Visionsspekulanten wie Slavoj Zizek oder Chantal Mouffe versagen kläglich beim Versuch, real relevanter zu werden, kaum etwas wirkte bereits bei Erscheinen älter als der große Sammelband „Die große Regression“, in dem das Aufkommen rechter Politik diskutiert wurde.
Auf der anderen Seite gibt es das Jacobin Magazin: Cool aufgemachte linke Theorie, ein Magazin, das astronomische Verkaufszahlen hat (für ein Politik-Magazin, für ein Theorie-Magazin, eigentlich für jedes Magazin), und ein neuer Hoffnungsschimmer am politisch linken Horizont.
Der Aufstieg des Jacobin ist offenbar so faszinierend, dass der Suhrkamp Verlag dem Magazin eine eigene Anthologie in Buchform widmet. Auf 300 Seiten findet sich ein Best-Of diverser Artikel und Interviews. Und sehr viele davon drehen sich, wenn sie sich nicht um Bernie Sanders drehen, um Marx, Marxismus, Marx lesen und Marx verstehen.
Für einen Menschen, der politischer Theorie gegenüber sehr aufgeschlossen ist, ist das sehr ernüchternd. Von konservativer Seite ist nichts nur erwarten, weil das Bewahren (vor allem das Bewahren von Macht) selten herausfordernde Argumente hervorbringt. Liberale sind heute die intellektuell schwächsten – aus lauter Angst vor Ideologie und Dogmatismus beschränkt sich deren Theorieüberbau auf zu Hashtags eingedampften Spässchen im veganen Blondinenwitzformat. Die linken waren die mit Visionen, um die man spannende Theoriegebäude bauen konnte.
Und jetzt wollen sie auch nur mit Marx-Zitaten um sich werfen?
Vielleicht hat die Rückbesinnung auf weitgehend gefahrlose und inspirationsfreie Texte ja auch mit der Angst vor den gescheiterten Menschenbildern zu tun. Der Idealtyp konservativer Politik ist der verdienstvolle langjährige Angestellte, dessen Frau ihm abends die Pantoffeln zur Couch bringt. Liberale idealisieren einen farblosen homo oeconomicus, der immer rational handelt – es sei denn, es ärgert ihn gerade etwas. Der neue Mensch sozialistischer Visionen ist in den Blutbädern Chinas und Russlands untergegangen, geistert heute noch durch albanische oder rumänische LIteratur.
Dabei wäre gerade hier viel Platz für ansprechende politische Theorie: Von welchem Menschen reden wir, welche Bilder haben wir dabei im Kopf? Welche Verhaltensweisen und Ideale helfen, eine Welt zu schaffen, die wir uns wünschen?
Ich fürchte, dass viele davon nur über Verhaltensweisen – im Konsum, im Wirtschaften, im persönlichen Umgang und auch in der Kultur – erreicht werden kann. Revolutionäre Wirtschaftsordnungen, auch wenn sie sauber marxistisch-leninistisch durchstrukturiert sind, leisten das nicht, fürchte ich.