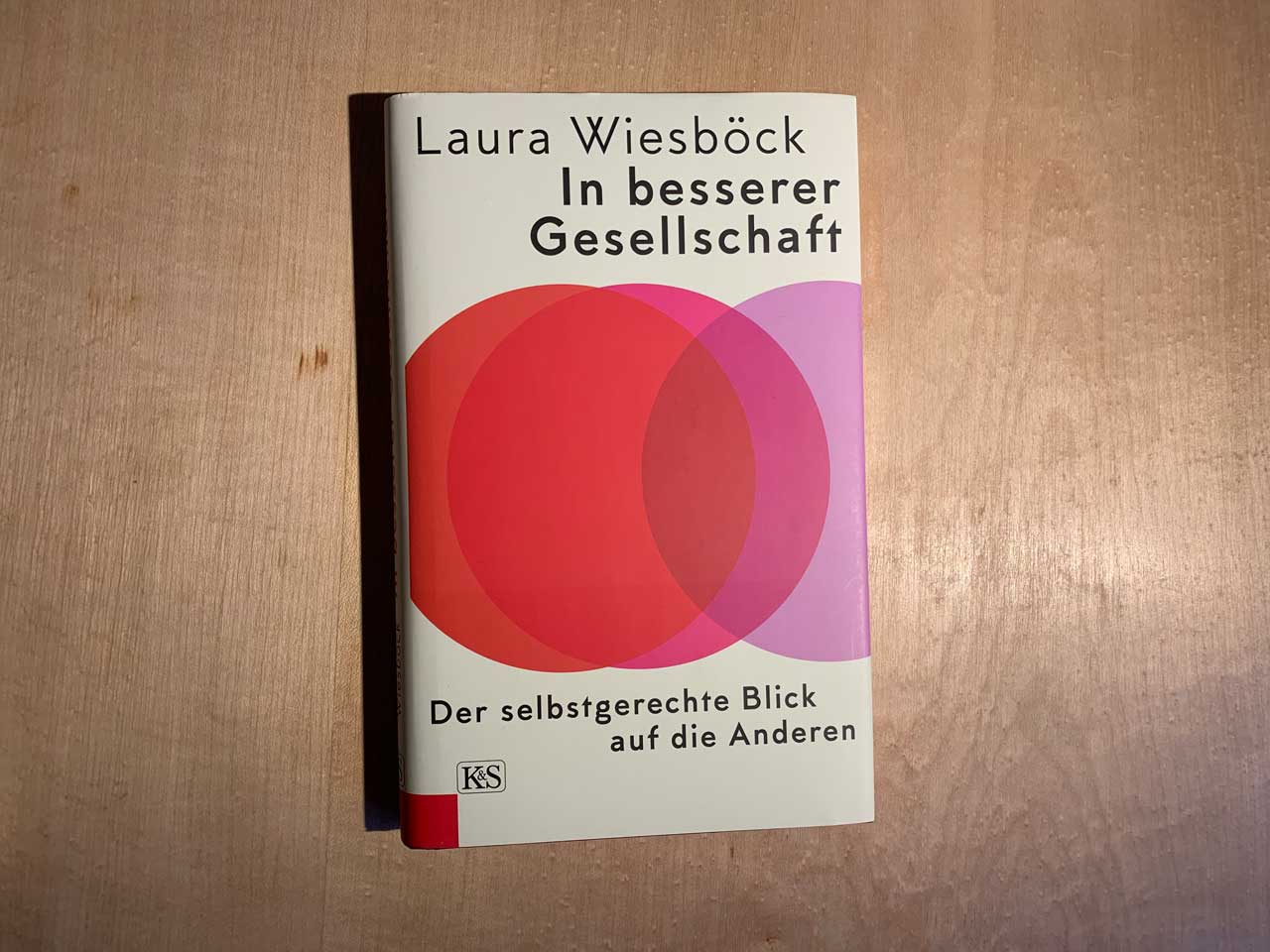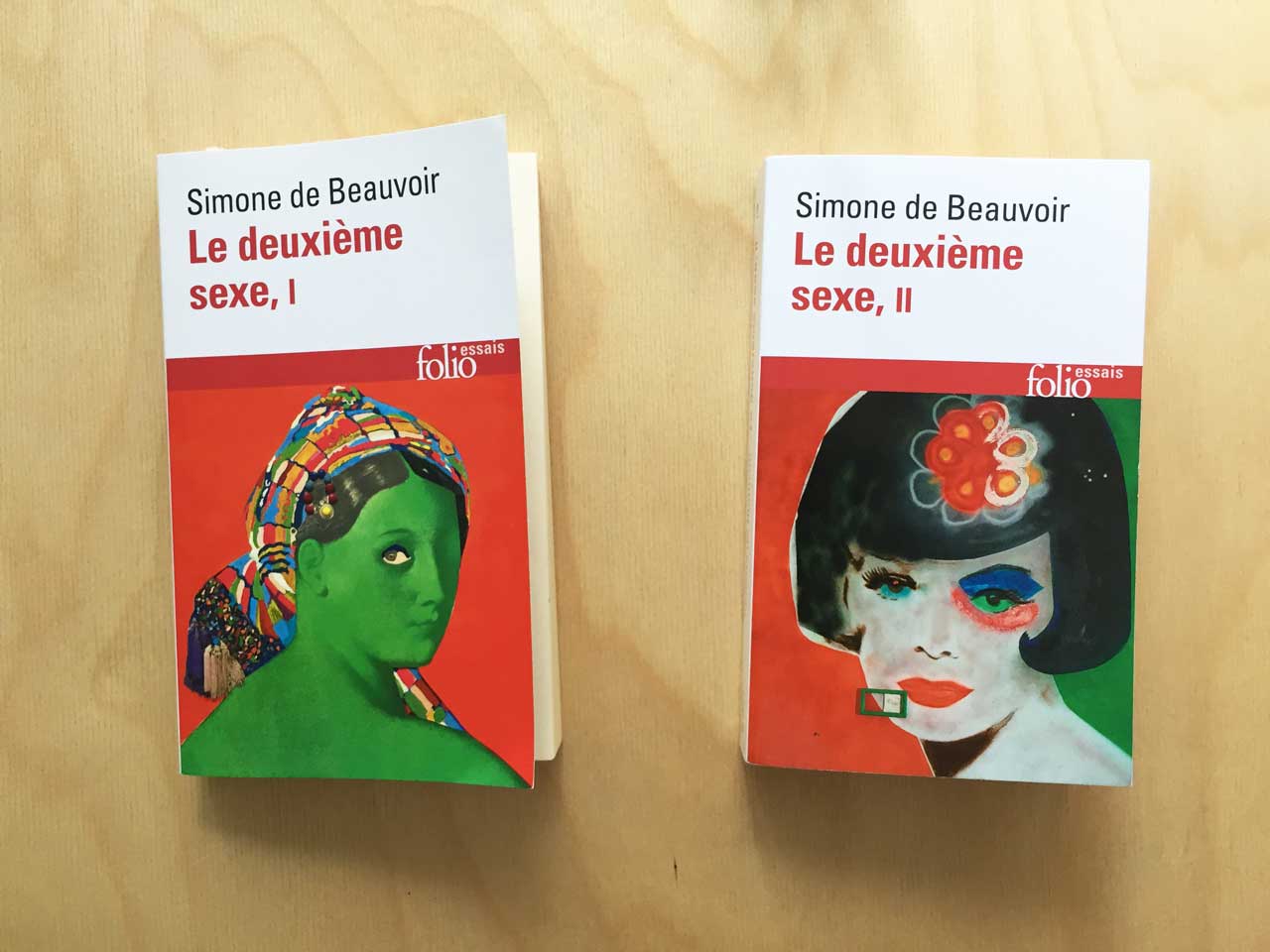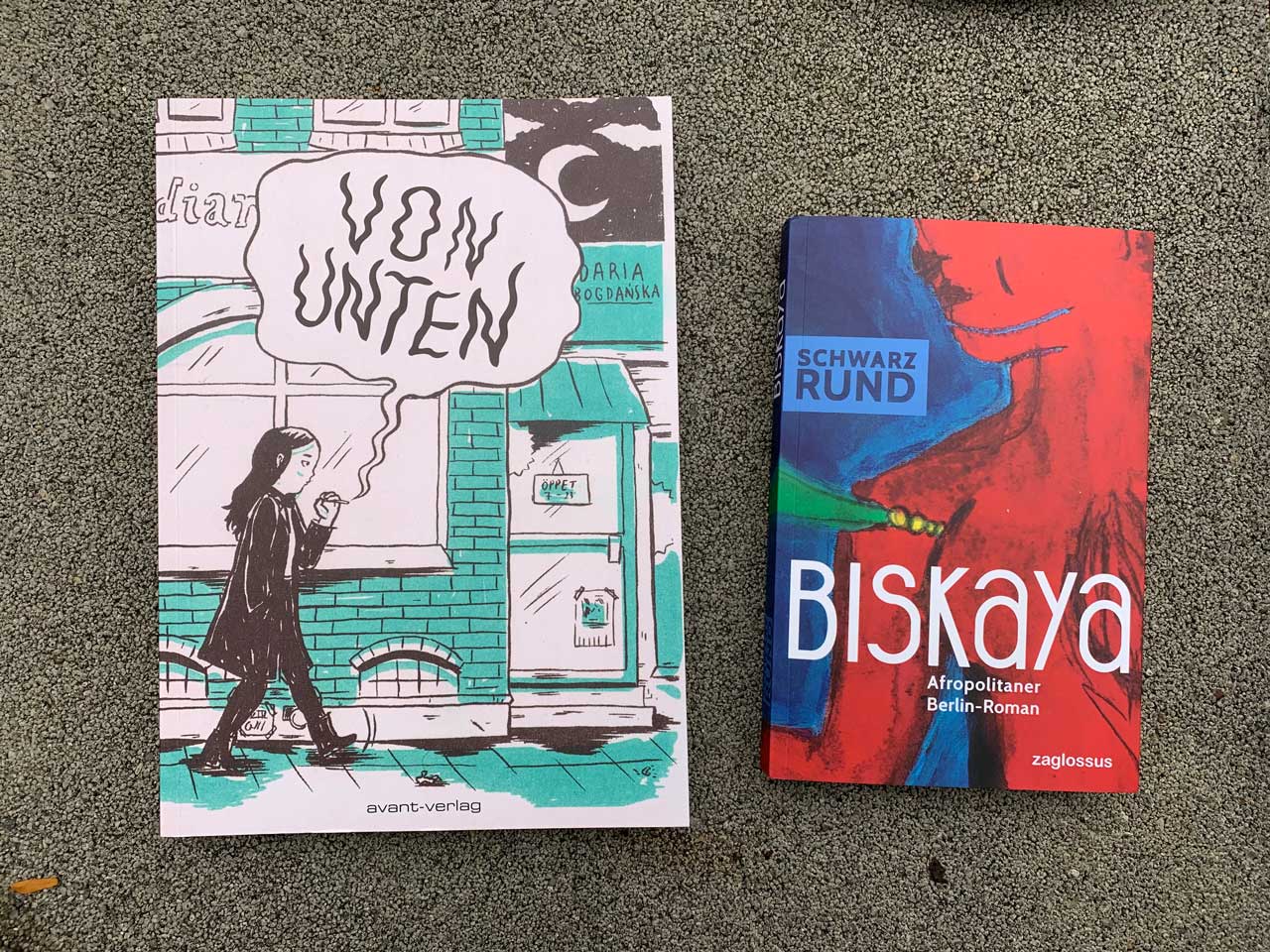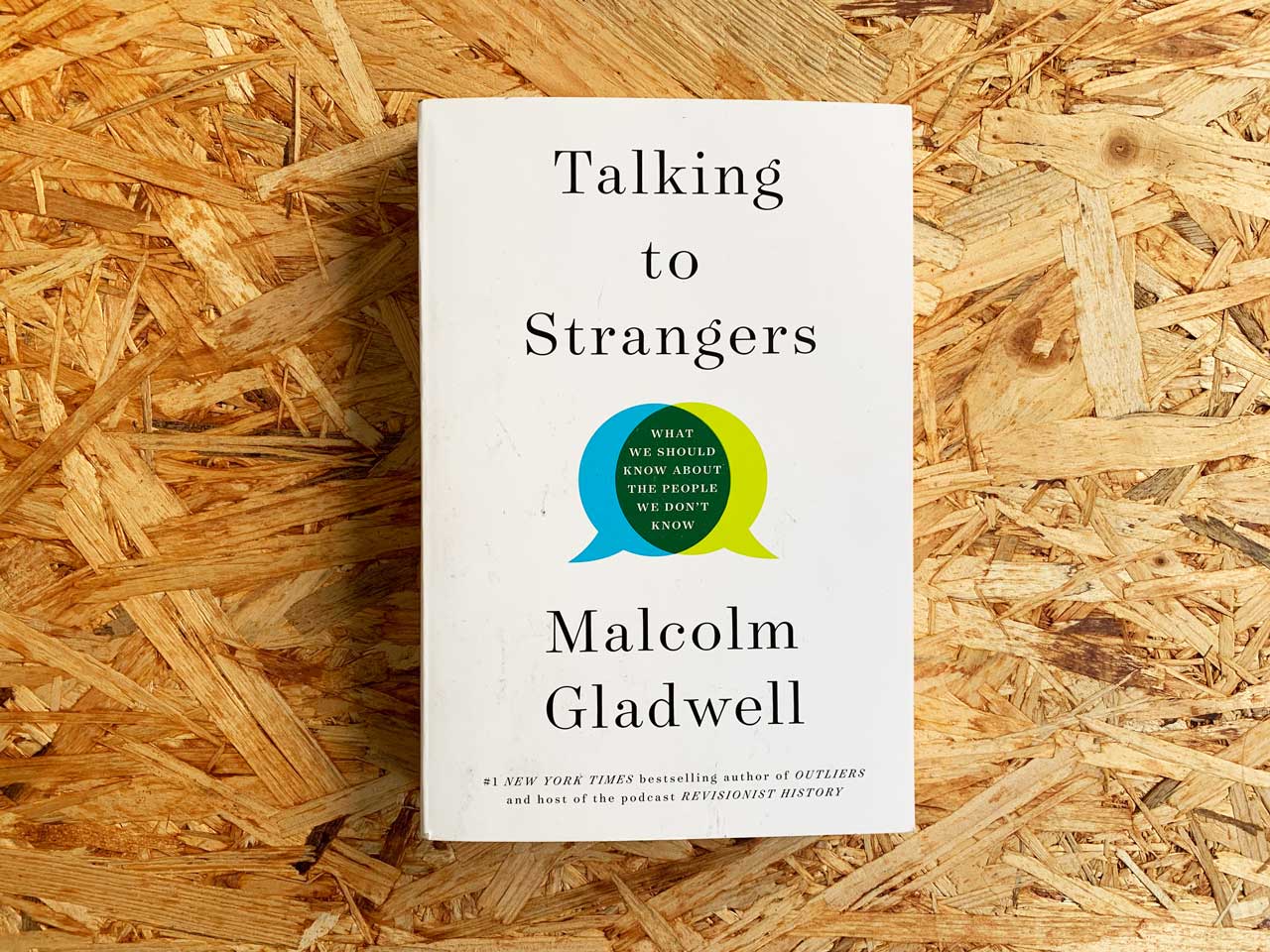Es klingt aufregend: In „Überreichtum“ verspricht Martin Schürz, zu erklären, was das Problem an Überreichtum ist und wie er die Demokratie bedroht. Zunächst liegt das ja auch auf der Hand: Überreichtum verhilft Leuten wie Trump zu Präsidentenämtern. Allerdings gewann Trump eine demokratische Wahl – und das mit kleinerem Budget als Hillary Clinton. – So konkret möchte Schürz aber offenbar auch nicht werden, die Bedrohungsszenarien bleiben unspezifisch. Reiche haben Macht oder Zugang zu Macht. Das ist so, und das kann abhängig von ihren und unseren Absichten gut oder schlecht sein.
Schürz hat einige gute Vergleiche bei der Hand, um Vermögensunterschiede greifbar zu machen. Das Medianvermögen in Österreich liegt bei 83.000 €, die Mediankörpergröße bei 1,71 Meter. Im 90. Perzentil der Vermögen wäre man dann etwa zehn Meter hoch, im 99. so hoch wie der Donauturm (252 Meter). Um es in die Forbes-Reichenliste zu schaffen, müsste man etwa 2000 Meter groß sein, die Spitze wäre erst bei einer Körpergröße von 800 Kilometern erreicht. Das ist knapp das Hundertfache des Mount Everest.
Das ist eine ordentliche Schieflage, die jedenfalls auch bedrohlich wirken kann. Es gibt auch nichts, was ein Mensch mit diesem Geld anfangen könnte – es reicht, auch ohne sich zu vermehren, für mehr Generationen, als man planen könnte. Dabei kann allerdings schon etwas dazwischen kommen – und damit beginnen auch schon die Schwächen in Schürz‘ Argumentation. Nicht jeder Reichtum ist flüssig, sodass man einzelne Teile herausnehmen und nützen könnte. Oft sind es Unternehmensbeteiligungen, oft aber auch Luxusgegenstände – die nur solange einen Wert haben, solange sie jemand zahlen kann. Bei einer Obergrenze von 30 oder 50 Millionen Euro für privates Vermögen, die Schürz mehrmals anspricht, wären wohl einige Luxusobjekte auch für die dann Reichsten plötzlich zu teuer – und damit weniger wert. Wer will schon ein abgelegenes Chalet in den Bergen oder eine Hütte auf der einsamen Insel, wenn man sich nicht den Helikopter oder die Yacht dazu leisten kann, um auch schnell hin und wieder weg zu kommen, von passenden Sommer- und Winterdomizilen für mehr als ein Wochenende gar nicht zu reden?
Das bedeutet nicht, das Superreiche nicht superreich sind, aber ihre Mobilisierungskraft ist vielleicht nicht ganz so gigantisch …
Aber so konkret möchte Schürz gar nicht werden.
Ihn interessiert die moralische Frage mehr. Reichtum ist ungerecht. – Auch dabei kann ich allerdings nicht ganz mit. Gerade der Superreichtum der Superreichen ist durch Konsum enstanden. Sie sind reich geworden, weil sie etwas kontrollieren, das andere haben wollen. Und das sind nicht mal überlebenswichtige Dinge. Niemand muss bei Amazon einkaufen, niemand muss Apple-Geräte verwenden, man muss nicht einmal Microsoft-Software nutzen oder Red Bull trinken. Für alles gibt es Alternativen. Die Superreichen von heute sind keine Großgrundbesitzer aus alten Adelsgeschlechtern, die ihr Vermögen Leibeigenen abgepresst haben. Ihr Reichtum ruht auf dem Konsum der Armen.
Natürlich ist auch nicht alles allein auf ihre Leistung zurückzuführen. Sie nutzen Infrastruktur, die andere über ihre Steuern mitfinanziert haben, profitieren von staatlich finanzierter Bildung und Forschung – das sind allgemeine Güter, die allen zur Verfügung stehen.
Ist es nicht recht egal, ob Reichtum gerecht ist? Ist es nicht wichtiger, allen Menschen die gleichen Chancen einzuräumen? Das findet Schürz offenbar nicht, Chancen- und bedarfsorientierte Gerechtigkeitskonzepte sind für ihn „ideologisch und wirklichkeitsfremd“. Deshalb steht er auch der Betonung von Bildung als wichtige Lebensvorausetzung skeptisch gegenüber. Für ihn ist das ein Ablenkungsmanöver, Bildung wäre also sinngemäß Opium für das Volk. Wer Bildung als wichtig darstellt, trägt dazu bei, die Schürz‘ Meinung nach falsche Ansicht zu verbreiten, jeder könnte „es“ schaffen.
Wer „es“ nicht schafft, sei dann eben faul oder müsse mit anderen negativen Zuschreibungen werden.
Das ist eine andere Argumentationslinie, die sich durch Schürz’ Buch zieht: Die Welt sei auf Reiche ausgerichtet; Reiche beachte man und man schreibe ihnen positive Eigenschaften zu. Arme dagegen seien ein Mangel, etwas, das es zu beseitigen gilt und mit negativen Eigenschaften verbunden. Jetzt wirft das natürlich auch die Frage auf, welche Armen denn gern arm sind und welche Reichen ungern reich; noch auffälliger ist aber, dass Schürz lauter Beispiele aus doch schon recht lange vergangener Zeit anführt. Bemitleidete und verteufelte Arme in viktorianischen Arbeitshäusern haben wir schon etwas länger hinter uns gelassen, ebenso wie für Fleiß und Arbeitsethos bewunderte Reiche. Nicht einmal mehr die Geschichte von der Hindernisse überwindenden Selfmade-Person ist noch besonders spannend – heute bewundert man Erfolgreiche ja eher dafür, dass sie mit möglichst wenig Aufwand durchs Leben kommen und ausreichend Zeit finden, ihren Instagram-Account zu kuratieren (Rich Kids of the Internet lässt Schürz im übrigen aus).
Schürz’ Anklage ist ähnlich wie viele misslungene Versuche, linke Positionen zu argumentieren: Die Sozialdemokratie hat ihre unverzichtbaren Verdienste. Aber ihre Erzählungen finden heute einfach keinen Halt mehr. Ihre Subjekte sind ihr abhanden gekommen, ihre eigenen Profiteure außerhalb der Parteien interessieren sich nicht mehr für sie.
Martin Schürz setzt zu einer großen Erzählung an – und liefert dann wenig. Reichtum kann Unbehagen verursachen, Charity, Spenden und Philanthropie sind auch Machtinstrumente – geschenkt. Absurde Vermögenskonzentrationen stehen Nullzinsen und stagnierenden Gehältern gegenüber – Aber was wäre wirklich gewonnen, würde man das ändern? Weniger reiche Menschen hätten nach einer Umverteilung etwas mehr Geld – aber auch nicht ausreichend, um ihr Leben von Grund auf zu ändern. Schürz’ Vorstellung von Gerechtigkeit ist eine anspruchsorientierte. Gerecht behandelt fühlt sich, wer den Eindruck hat, seine oder ihre Ansprüche wurden erfüllt; er oder sie hat, was ihm oder ihr zusteht. Vor diesem Hintergrund können sich alle immer ungerecht behandelt fühlen – auch Superreiche (wie auch Schürz einräumt). Das ist eine sehr unpraktikable Vorstellung.
Schade an Schürz’ Buch ist weniger, dass es keine Lösung entwirft, sondern dass es auch das Problem nicht auf den Punkt zu bringen vermag. Da sind Pikettys radikale Steuersätze noch sinnvoller.