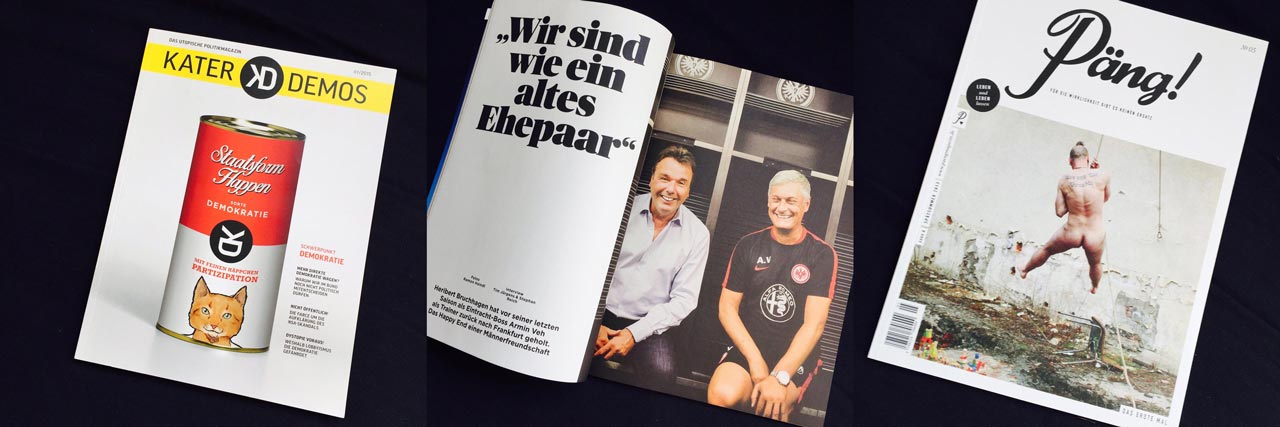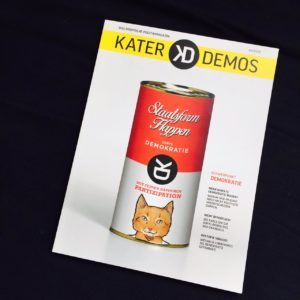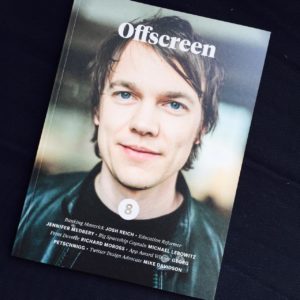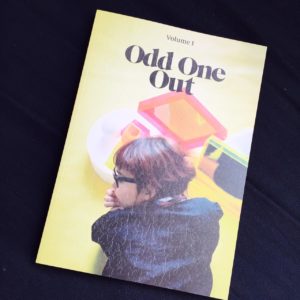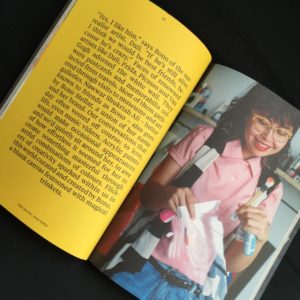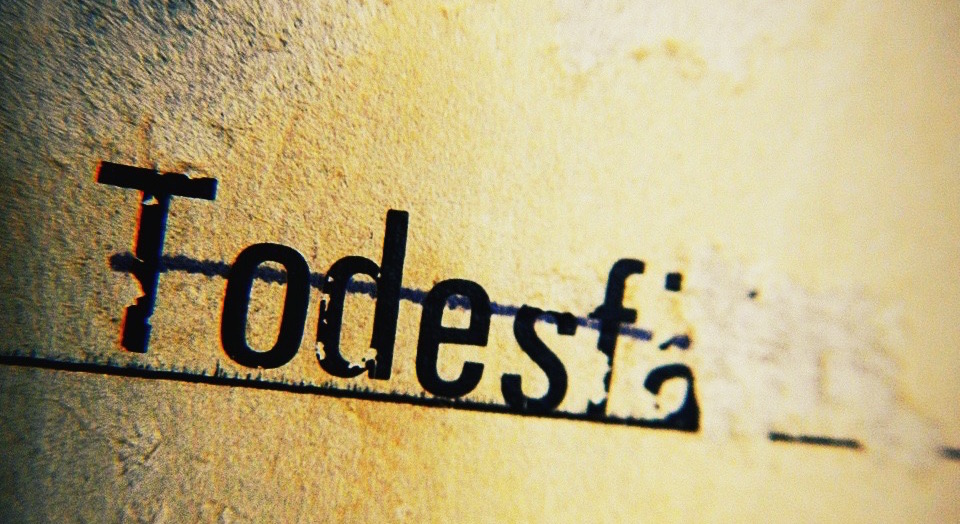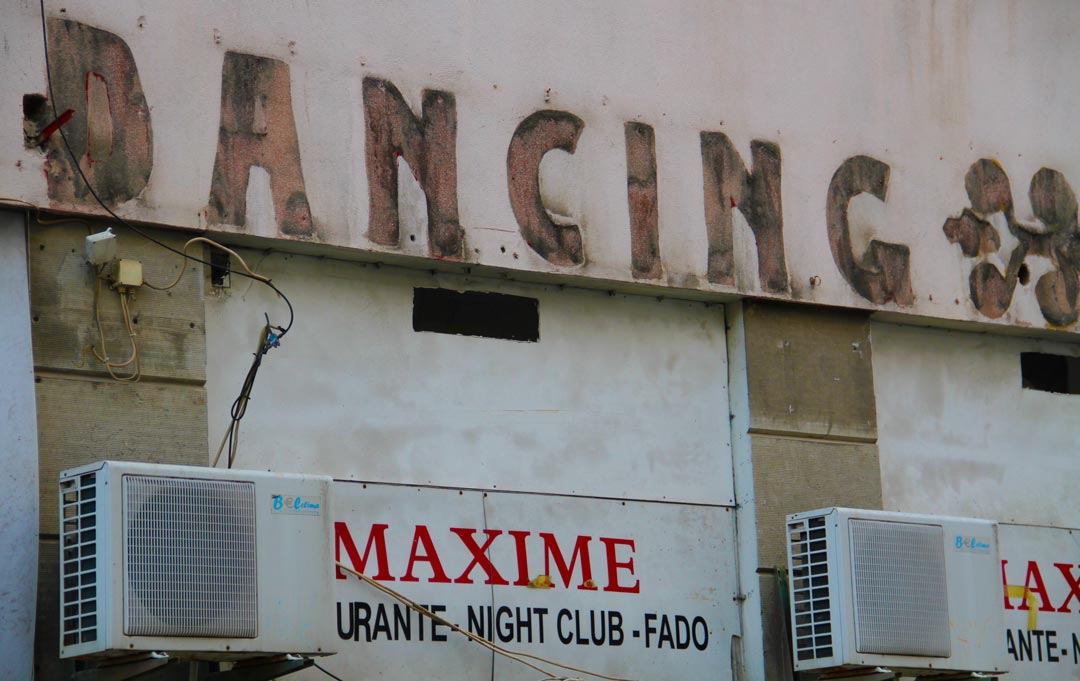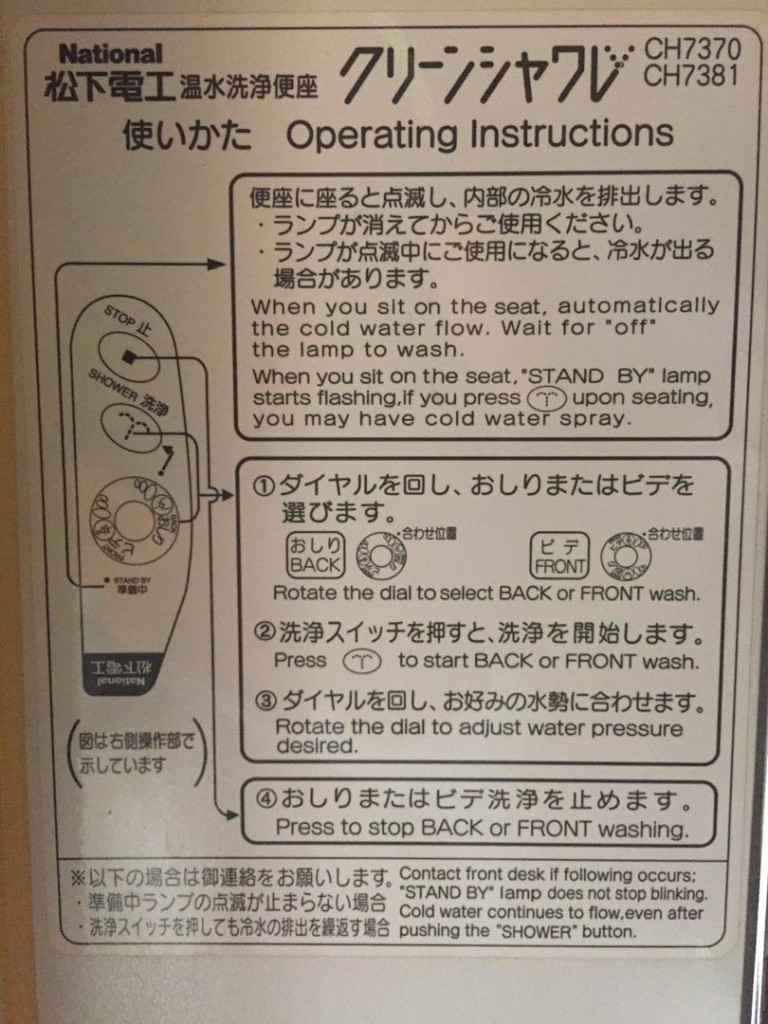Ende August war Indiecon – das Treffen der unabhängigen Magazinmacher in Hamburg. Eineinhalb Tage Konferenz und ein anschliessender Messetag bringen viele neue Publikationen ans Tageslicht.
Die Probleme und Erfahrungen sind erwartungsgemäß überall sehr ähnlich; etwas erstaunt hat mich, dass die Magazinmacher_innen bis auf wenige Ausnahmen ziemlich online-naiv statt -nativ sind: kaum Strategien für die digitale Vermarktung, noch weniger für die digitale Publikation. Auf der anderen Seite zeigt das auch wieder: Online ist nicht so einfach und blllig, wie man oft glauben möchte, und Print ist nicht so tot, wie manche meinen möchten.
Noch erstaunlicher: Michael Hopp (Ex-„Wiener”) macht jetzt in Hamburg Corporate Publishing und hat es geschafft, den „Wiener“ irgendwie als historische Mutter von Indie-Publikationen in den Köpfen zu verankern. Wäre nie auf diese Idee gekommen. Und, Notiz am Rande: Es wird höchste Zeit für ein neues Narrativ der 80er-Jahre. Da waren nicht nur Falco, U4, Minisex und Koks, da waren auch Slayer, Anthrax und Public Enemy und eine Menge von Kindern, die zwischen der hermetisch abgeschlossenen Geschlecktheit, die die damals über 25jährigen propagierten, und der Beisl- und Heurigenszene ziemlich wenig Unterschied gesehen haben. Mir san mir war in beiden Fällen die auf die Essenz eingedampfte Aussenwirkung.
Eine etwas andere Indie-Geschichte erzählte Philipp Köster, Chef von 11 Freunde, der mit seinem 2000 gegründetet Magazin schon 2010 einen Exit mit Gruner und Jahr hingelegt hat. Der Verlag übernahm 51%, und Köster erzählte über Ängste und Sorgen, den Indie-Status zu verlieren. Seine Erfahrung deckt sich wohl ziemlich mit der, die jeder macht, der mit großen Verlagen oder zahlenden Kunden zu tun hat: Die größte Gefahr liegt in der Selbstzensur, in der Sorge, auf irgendetwas Rücksicht nehmen zu müssen. Direkter Druck auf Redaktionen ist nach wie vor selten, aber die Versuchungen wachsen ständig. Und der ökonomisch besorgte Blattmacher macht sich eben Gedanken, möchte niemanden vergraulen und möchte auch keine Chancen auslassen, die wirtschaftliche Basis seines Blatts zu sichern. Wie weit man dabei geht, das ist dann eine Frage des aufrechten Gangs.
Aber zurück zu den Magazinen. Ich habe da ja sehr strenge Ausschlusskriterien: Wenn ich bei drei bis fünf Mal blättern nichts anderes als Mode und Design finde, dann hat sich das Heft für mich schon erledigt. – In solchen Fällen wären irgendwie Postkarten das passendere Medium. Zweites Ausschlusskriterium: Ich verstehe nicht, wofür ein Heft steht. Wenn es keinen Claim, kein richtungsweisendes Editorial und auch sonst nichts gibt, das mich erkennen lässt, worum es hier eigentlich geht, werde ich es auch nicht lesen. Dritter Punkt: Ich verstehe die Geschichten nicht. Meist sind es Interviews mit Menschen, die schlecht vorgestellt werden, die es nicht schaffen, die Story im Vorspann oder wenigstens in den Bildern rüberzubringen, und die nicht über Gemeinplätze wie „kreativer Tausendsassa…“, „Fixpunkt der Kreativszene von XY“ hinauskommen, die mir das Lesen verleiden.
Trotzdem habe ich ein paar Magazine gekauft.
Kater Demos – Politik
Von Katzencontent ist hier nur schmähhalber die Rede. I mHeft gibt es Interviews, Analysen und ein paar fallweise recht theoretische Abhandlungen. Für eine erste Ausgabe, mit der man sich erst mal positionieren muss, ist das aber durchaus ok. Derzeit läuft gerade eine Crowdfunding-Kampagne für die Finanzierung der nächsten Ausgaben.
Inhalt: echte Gespräche und Interviews, gut erzählte Analysen; politisches und journalistisches Knowhow ist da
Gestaltung: sehr zurückhaltend für ein junges Indie; der Schmäh passt so weit.
würde ich abonnieren: ja
Offscreen – Digitale Arbeit
Offscreen ist ein Interview-Magazin, das sich mit Menschen im digitale Business beschäftigt. Kai Brach spricht mit App-Entwicklern, Hard- und Softwaredesignern und Gestaltern aus aller Welt. Das Magazin ist großteils eine One-Manshow, wird direkt vertrieben und trägt sich kommerziell.
Inhalt: ausführliche Interviews und Porträts, zwischendurch ein paar kürzere Storys.
Gestaltung: kleines Format, fast schon Buchcharakter
würde ich abonnieren: jein – super gemacht, interessant zu lesen, für mich persönlich aber vielleicht nicht auf die Dauer
Shift – Gesellschaft
Shift ist ein Gesellschaftsmagazin, das schon recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, unter anderem vom Veranstalter gesponserten Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Shift ist ein mononthematisches Magazin (diesmal: „Break“); persönlich mag ich das nicht so, weil diese Themenfixierung oft zu Geschwurbel verleitet: Es geht nicht mehr darum, eine gute Story zu machen, sondern irgendwas zum Thema. Im Heft finden sich dann auch neben Interviews und faktenbasierten Storys immer wieder ein paar Befindlichkeitsstrecken, die dann eben doch sehr beliebig sind.
Inhalt: guter Anspruch; mit der xten Story zum gleichen Thema ist aber manchmal die Belanglosigkeitsfalle nicht weit. Ich habs trotzdem in einem Zug durchgelesen.
Gestaltung: kleinformatig, hübsch
würde ich abonnieren: ja – der Anspruch und die Zielsetzung passt; die Befindlichkeiten b´verschwinden hoffentlich, sobald des die Finanzen ermöglichen
The Outpost – Gesellschaft
The Outpost erscheint in Beirut. Das bringt natürlich schon mal einen Bonus. Ibrahim Nehme ist einer jener Menschen, die einen denken lassen: Warum können nicht alle so sein? Wenn er auf der Bühne spricht, erscheint alles ganz klar, machbar und in Reichweite. Dass irgendwas Probleme machen könnte – auch im Nahen Osten – wird geradezu unwahrscheinlich. The Outpost beschäftigt sich mit Möglichkeiten („Weil es immer heisst, dass im Nahen Osten nichts möglich ist“), hat für jede Ausgabe ein Schwerpunkt-Thema und drei fixe Rubriken: „What did happen“, „What did not happen“, „What could happen“).
Inhalt: Trotz der Themenfixierung Reportagen; extrem durchdachter Aufbau
Gestaltung: Mittelformat mit vielen sehr gut aufgebauten Infografiken
würde ich abonnieren: ja
WASD – Games
WASD ist das Games-Magazin für Leute, die Games-Magazine langweilig finden. Im Heft gibts weniger Tests und Punktesysteme, mehr Reportagen rund um Games und Storys, die Games als Kulturgut wie Bücher und Filme behandeln. Auch wenn Herausgeber … … die Games-und-Kultur-Diskussionen nicht so schätzt – „Das sagt jeder, ohne einen Plan zu haben, was er damit will – ausser Förderungen keilen.“
Inhalt: Longreads rund um Games
Gestaltung: mehr Buch als Magazin
würde ich abonnieren: nein – super gemacht, Games sind trotzdem nicht mein Ding
Odd One Out – Gesellschaft
Erscheinungsort Kuala Lumpur macht neugierig. Man muss sich aber durch einige Befindlichkeitsstrecken blättern, bis man bei neugierig machenden Porträts und Interviews landet. Ich muss sagen – wenn das Magazin irgendwo in Europa publiziert worden wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Auch hier erschliesst sich nicht immer gleich, warum genau dieses Interview lesenswert sein wird.
Inhalt: Interviews aus Malaysien und der Umgebung; Schwerpunkt auf alles Künstlerische
Gestaltung: kleinformatig und eher klassisch; sehr nüchterne Fotos
würde ich abonnieren: nein – aber gute Gelegenheitslektüre
The Smart View
Ein Magazin für Smartphone-Fotografie. Also, eigentlich kein Magazin. Eher eine Bildsammlung aus Facebook- und Instagram-Fotoalben. Mit fallweise ein paar Interviews mit den Fotografen, fallweise nur kurzen Statements. Aber ich war trotzdem neugierig.
Inhalt: Bilder.
Gestaltung: Bilder. Und wenig schwer auffindbarer Text.
würde ich abonnieren: nein – online gibts dann doch noch mehr Bilder
M1CR
Ein Magazin für Rothaarige – nicht mit Styling,- Kosmetik- und Hautpflegetipps, sondern über das Leben mit rotem Haar. Irgendwo scheint das doch für viele Rothaarige ein Thema zu sein – sei es, weil sie als Kind gehänselt wurden,oder weil sie eben nicht gehänselt wurden. Oder weil sie eben doch immer wieder auf die Haarfarbe angesprochen werden. Herausgeber Tristan Rodgers erzählt, dass es auch für ihn neu war, dass es so viele immer wiederkehrende Themen gibt – und eigene Rothaarigen-Conventions mit mehreren Hundert Menschen. Perfekt definierte Zielgruppe, jedenfalls.
Inhalt: Interviews und Stories über und mit Rothaarigen
Gestaltung: kleinformatig und rötlich
würde ich abonnieren: nein – rote Haare in meinem Bart reichen nicht
+++
Restexemplare von Päng! gab es beim Messeshop übrigens auch noch. Päng! gibt es ja leider nicht mehr. Gründerin Josephine Götz erzählt hier im Interview eine schöne Geschichte, warum das so ist.