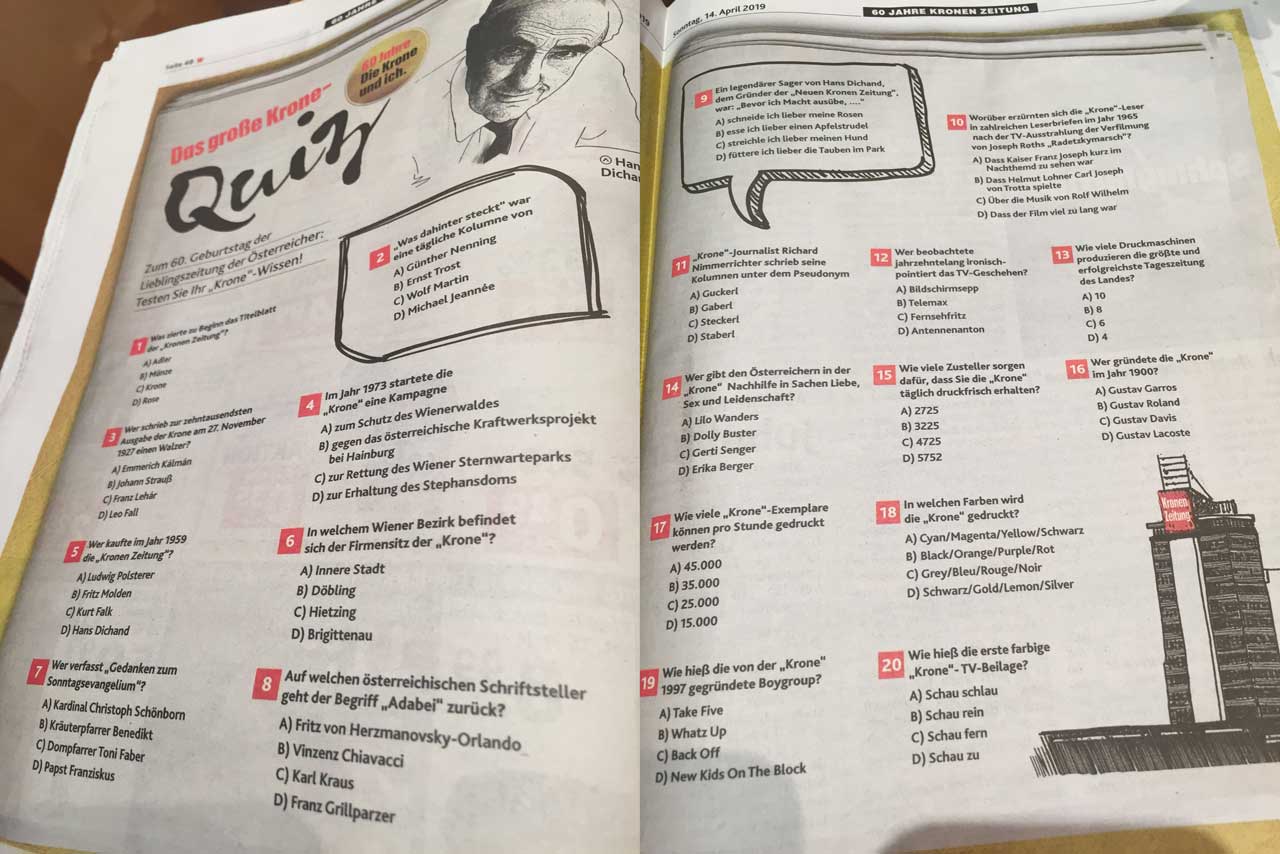Peter Sloterdijk widmet der Zeit „Nach Gott“ ein ganzes Buch, Gottlosigkeit oder -verlassenheit (Achtung, das sind eigentlich Gegensätze) sind in der einen oder anderen Art allgegenwärtig, und praktisch jeder hat schon mal gehört, dass der Typ mit dem großen Schnauzer diesen Spruch drauf hatte und jetzt aber selber tot ist (wenn er nicht mit der Katze in der Schachtel sitzt). – Nietzsche, Nihilismus und Schrödingers Katze sind gleichermaßen Allerweltsrepertoire für Halbgebildete. Warum also eine ganze Essaysammlung über einen verstorbenen Gott, noch dazu zu einer Zeit, in der Karel Gott gerade in allen Medien dementiert, gestorben zu sein?
Gut und Böse sind auch nicht mehr was sie einmal waren
Ich bewundere und beneide Menschen, die sich religiös ereifern können, sei es als Gläubige, als Atheisten, Säkularisten, Laizisten – da sind wirklich viele billige Pointen abzuholen .
Aber wenn wir Religion, ihre Kritik, ihre Machtansprüche und die umgekehrten Machtaktiken der Weltlichen, die religiöse Strategien als Vor- oder Feindbilder strapazieren, wirklich mal beiseite lassen, dann müssen wir jetzt mehr denn je die Frage nach den großen Welterklärungs- und Weltlenkungssystemen stellen. Was gibt Orientierung, was setzt einen Bezugsrahmen für richtig und falsch, gut uns böse, schlecht und besser, verbohrt und pragmatisch, aufgeschlossen und verklemmt?
Die Verschiebung dieser gut/böse-Begriffspaare deutet schon darauf hin, dass Werte und Ideale überaus unterschiedlich sein können; die Differenzierung in wünschenswert und nicht wünschenswert aber zieht sich weiter, auch ohne von außen vorgesetzte kontrollierende Instanz.
Wertegläubige und Werteanwender
Meines Erachtens müssen wir hier unterschiedliche Kategorien voraussetzen: Es gibt am Nutzen orientierte Erklärungs- und Steuerungssysteme und es gibt solche, die auf Ideale abzielen. Manche dieser Systeme sind ihren Anwenderinnen und Anwendern bewusst, andere nicht. Beide Varianten gibt es aber in beiden Kategorien, und in manchen Fällen wäre es sicher auch treffender, von Gläubigen als von Anwendern zu reden. Anwendung ist mitunter ein zu bewusster, klar gesetzter Akt, etwas, das nicht allen im Zusammenhang mit der Wertewahl offensteht. Denn diese zeichnet sich in vielen Fällen gerade dadurch aus, dass sie nicht als Wahl, sondern als Voraussetzung und Gegebenheit verstanden wird.
Am Nutzen orientierte Werte- und Erklärungssysteme kennen als leitende Fixsterne etwa
- Erfolg
- die Wirtschaft
- Kraft, Macht, Potenz im weitesten Sinn
An Idealen orientierte Systeme beziehen ihre Argumente aus Konzepten wie
- Ökologie
- die Anderen
- Gerechtigkeit
- Gemeinschaft
Vielleicht wirkt diese Aufzählung willkürlich und sehr punktuell. Aber sehen wir noch mal genauer hin.
Gut ist, was nützlich ist
Erfolg als Leitstern bedeutet nicht nur, dass ich alles tun will und darf, was meinem Erfolg dient. Es bedeutet auch, dass andere, deren Erfolg größer ist, „besser“ sind. Es bedeutet, dass diese sich Dinge herausnehmen können, die mir vielleicht verweigert bleiben, dass sie Vorgaben und Standards setzen (und verschieben), die ich zu akzeptieren habe. Wer Erfolg hat, ist gut. Wer keinen hat, ist ein Auslaufmodell. Klingt nach ferner düsterer Utopie? Dann schaut noch mal die türkise „Bewegung“ und ihre Bewunderer an … Aus diesen Urteilen und Priorisierungen lassen sich klare Wertesysteme ableiten, klar jedenfalls so lange, wie sie sich keinen Grundsatzfragen stellen müssen. Dann gerät unter Umständen schnell die allererste Entscheidung ins Wanken – man müsste erklären können, warum Erfolg das Maß aller Dinge sein soll.
Wir müssen aber gar nicht stromlinienförmige Politkörper und -geister strapazieren. In der Ökonomie sowieso, aber auch in der Kultur ist Erfolg der Leitstern. Wachstum (nahezu egal wovon und wozu) und Reichweite sind Qualitätskriterien, die vervielfachende Mechanismen in Gang setzen.
Gut ist, was wächst
Kraft und Macht als Leitbilder funktionieren nach einer ähnlichen Logik. Kraft und Macht sind wichtig und vorteilhaft, also muss es gut sein, mehr davon zu besitzen, sowohl für einzelne als auch als Leitbild.
Ein Primat der Ökonomie dagegen muss nicht von vornherein auch die Wirtschaftstreibenden an die Spitze seiner eigenen Wertepyramide stellen. Hier ist das Rechnen das entscheidende Wertekonstrukt, die scheinbare Genauigkeit, mit der der gemessen, berechnet, vielleicht sogar vorhergesagt werden kann. Es ist das klare Urteil von Mehr oder Weniger, das ein einfaches und deutliches Bild der Welt zeichnet und klar macht, wohin man möchte.
Wachstum als oberstes Prinzip anzusetzen schließt von vornherein schon aus, das Ganze im Blick zu haben. Es kann nicht alles wachsen. Wachstum bedeutet zugleich auch Verdrängung.
Gut ist, was überleben sichert
Das klingt nach moralischem Unterton, nach betulichem Beigeschmack. Ist aber nicht so. Wir nähern uns hier nur einer Sphäre andersartig orientierter Wertesysteme. Eines der am klarsten nachvollziehbaren ist dabei ein von Ökologie dominiertes Wertesystem: Es gibt nur eine Erde. Und die brauchen wir. Können sich also gut/schlecht, nützlich/schädlich und ähnliche Kategorisierungen daran orientieren, was für die Erde nützlich ist?
Das klingt altruistisch, ist es aber nicht. Denn was für die Erde nützlich ist, sichert schließlich den Fortbestand dessen, was Menschen zum Überleben brauchen. Bruno Latour greift den Gedanken der Erde als zentralen Leitwert in seinen Lebenswelt-Überlegungen mehrfach auf. Wie so oft bleibt auch dabei das Problem, dass die Erde grundsätzlich recht schweigsam ist und auf Vermittler angewiesen ist. Da bewundert man wieder die strukturelle Effizienz der religiösen oder antireligiösen Organisationskomplexe, die mit Glauben an den Glauben oder Glauben an die Rationalität unbeirrbar klare Linien fahren können.
Offenere Anstands- und Wertesysteme müssen sich da auf mehr Diskussion einlassen.
Damit kommen auch die Anderen ins Spiel. Die einfache Variante wäre: Gut ist, was für die anderen gut ist. Das ist aber eigentlich und rational betrachtet nicht verständlich. Welche Grund gibt es, hier eine Grenze zwischen uns und denen zu ziehen und andere auf eine höhere oder moralisch relevantere Stufe zu stellen? – Dieser Einwand funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Stammtischreflex gegen Politische Korrektheit, Feminismus und andere Antidiskriminierungstechniken. Das wäre auch der falsche Weg.
Die anderen kommen dann ins Spiel, wenn sie Betroffene sind, wenn unsere Handlungen Einfluss auf sie haben. Dieser Kreis wächst laufend. Handlungen ziehen größere Kreise, Information verbreiten sich schneller, globale Zusammenhänge werden unmittelbarer spürbar. Die Philosophin Lisa Herzog hat diese Dynamik der engeren und dichteren Zusammenhänge als Argument zur Ehrenrettung für Adam Smith ins Spiel gebracht, dessen Sichtweise eines (auch moralisch) regulierenden Marktes heute naiv wirken mag, aber für die Realität des 18. Jahrhunderts konzipiert war. Der Evolutionsbiologe und Mathematiker Martin Nowak stößt auf seiner Suche nach den Grundlagen, Ursachen und Motivationsfaktoren für Kooperation immer wieder auch grundsätzlich unscharfe, aber sehr bestimmende Elemente wie Hoffnung oder Vertrauen auf und in andere. – rational wäre es ja, nicht zu kooperieren. Menschen tuen es trotzdem, oft auch in der Hoffnung auf Entgegenkommen der anderen (Nowak nennt das indirekte Reziprozität).
Die anderen sind vor allem dann keine zu vernachlässigende Größe, wenn die Perspektive des einzelnen verlassen wird. Erfolg, auch für einzelne, ist ja nichts schlechtes. In dieser Isoliertheit taugt Erfolg nur wenig als Leitsystem, das Weiterentwicklung für alle im Blick hat.
Von hier aus ist es dann in vielen Debatten nicht weit zu schwierigen Begriffen wie Gerechtigkeit und Gemeinschaft, die ohne politischen Hintergrund ziemlich nutzlos sind. Chancengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Gerechtigkeit als Rache – hier kommt man auch von der politischen gefährlich schnell nah an eine praktisch religiöse Diskussion.
Heute müssten wir uns ja nicht mehr einigen …
Wozu also, warum sollten wir uns mit Fragen nach Leitsystemen beschäftigen, wenn wir diese, vor allem in ihrer Eigenschaft als Herrschaftsinstrumente endlich ein wenig in den Hintergrund gedrängt haben, wenn wir es uns auch im vielstimmigen Pluralismus gemütlich machen könnten?
Das ist eine Zeitfrage.
Wir können im friedlichen Pluralismus aneinander vorbeireden, ohne Entscheidungen treffen müssen, wir können uns auf relativistische Positionen zurückziehen, rationalistische Kahlschläge fordern, individualistische Absolutisten sein, moralisch aufmunitioniert unangreifbar werden – aber aus all dem entsteht nichts. Es bleibt bei einem Gewirr nebeneinander stehender Positionen, die wieder nur innerhalb ihres eigenen Kontexts rechtfertigen können, warum sie den anderen überlegen sind.
Warum sollten wir hier raus? Es ist dringend notwendig, Entscheidungen treffen zu können. Um Entscheidungen treffen zu können, müssen wir aber erst wieder Auseinandersetzung lernen. Dagegen sagen die Individualisten und Ausgegrenzten, dass sich sich nicht mehr mit den Machtansprüchen und Vorurteilen der anderen beschäftigen wollen, die Rationalisten sehen Jahrhunderte der Aufklärung in Gefahr, Esoteriker und Nazis sehen sich von Mainstream oder Verschwörungen bedroht, Medien freuen sich an wortreichen Debatten und mächtige Entscheidungsträger messen Gut und Böse in den kurzen Fristen von Vorstandsperioden oder Wahlzyklen.
Dann gibt es aber keine Basis für Handlung mehr
In dem großen Rauschen verliert man als nachdenklicher Mensch jede Lust, überhaupt noch etwas zu sagen. In vielen Fällen ist das auch nicht schlimm. In anderen Fällen ließe sich mit ein wenig Argumentation und Ruhe viel Aufregung vermeiden, Zeit sparen und Energie für anderes freisetzen. Und in wieder anderen Fällen braucht es anscheinend Regeln und Werte und Grundsätze, um überhaupt entscheiden zu können, wer reden sollte, wem man Aufmerksamkeit schenken sollte und wessen Einwände eine Rolle spielen.
Solange hier unhinterfragt und unreflektiert unterschiedliche Systeme aufeinanderprallen und es keine Kultur der Übersetzung gibt, es nicht notwendig ist, den Standpunkt wechseln zu können, ja solange das eigene System nicht einmal annähernd so bewusst und durchdacht ist, wie es verordnete Zwangssysteme wie Religionen noch waren – so lange haben wir keine Basis, um uns mit großen Herausforderungen zu beschäftigen. Wie wollen wir leben, Arbeit organisieren, die Umwelt überleben lassen – das sind warteorientierte Fragen. Für eine sinnvolle Beschäftigung mit diesen müssen wir uns auch sinnvoll wieder mit Wertesystemen beschäftige können, und ganz praktisch betrachtet, als vielleicht erster Schritt, müssen wir auch reden und verhandeln lernen.
Das ist die dringend notwendige Basis.
Dafür brauchen wir keine traditionellen, weltumgreifenden oder auf andere Art und Weise unverschämten Systeme wie Religionen (seien sie jetzt spirituell, ökologisch oder rationalistisch). Wir brauchen eher die Offenheit, auch außerhalb der eigenen Clique verständlich sein zu wollen. Oder die Bereitschaft, das Risiko einzugehen, fürs erste vielleicht auch mal schwer verständlich zu sein …