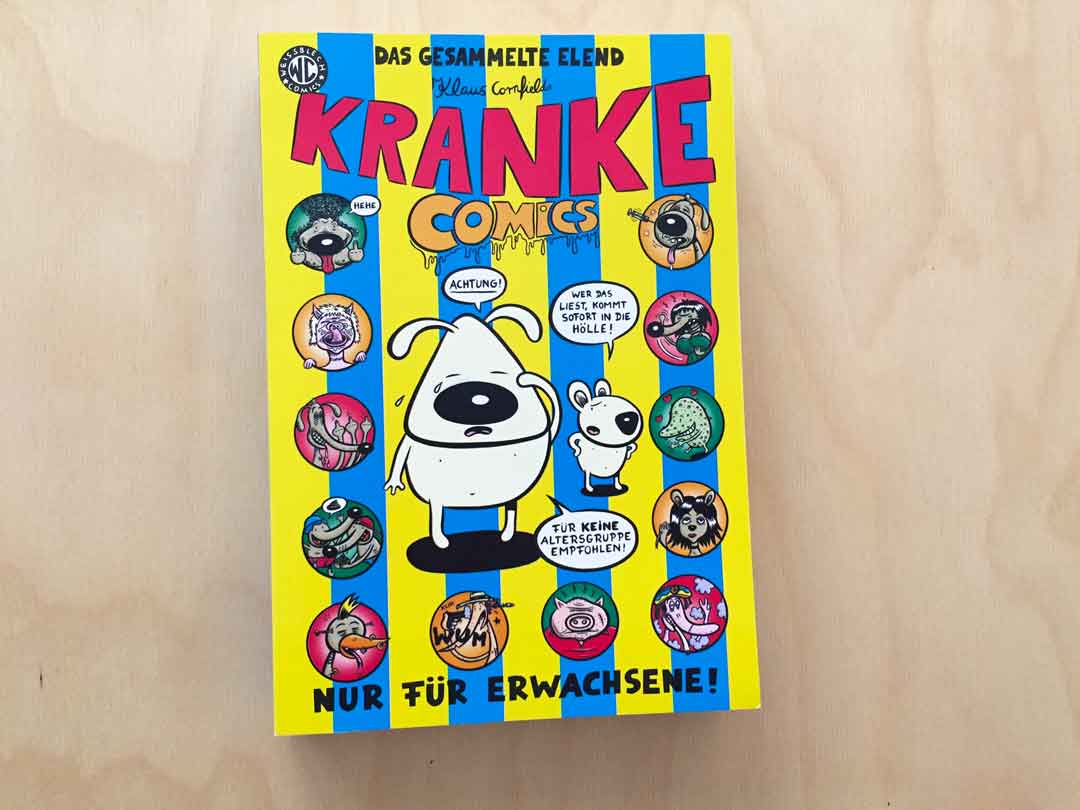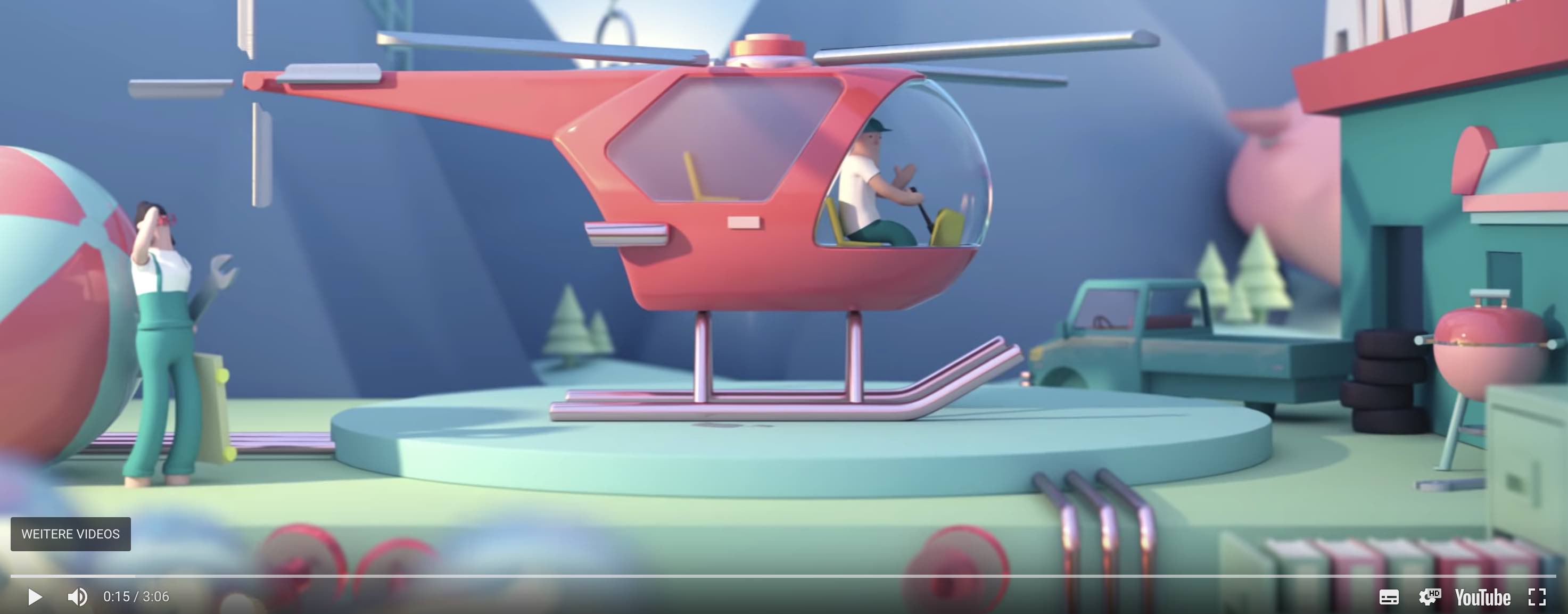Ich meide Medien-Diskussionsveranstaltungen seit einiger Zeit. Das war keine bewusste Entscheidung, das ist eher einfach so passiert. Es hat natürlich viel mit Online/Offline- oder Print/Digital- oder anderen kanalfixierten
Diskussionen wie diesen zu tun. Nach dem, was optimistischere Menschen erzählt haben, die die Medienenquete trotzdem besucht haben, habe ich nicht viel versäumt.
In der letzten Zeit haben ich mich lieber mit anderen Medienformaten beschäftigt, als mit den üblicherweise diskutierten Nachrichten-, „Nachrichten“- oder öffentlich rechtlichen Formaten, vor allem mit Comics oder Indie-Magazinen.
Man mag über Reichweite oder Relevanz lächeln. Dann muss man aber auch daran denken, welche Wirkung Comics im Guten wie im Schlechten zugeschrieben wird und wer sich aller Indie, unabhängig oder Großvater des Indie nennt.
Kleiner Märkte und Projekte haben den Vorteil, überschaubarer zu sein – Reaktionen sind schneller und direkter. Und auch Aktionen schleppen sich nicht in Fünfjahresplänen dahin.
Comics sind jetzt länge schon eine grundsätzlich sehr digitalaffine Publikationsnische. Neue Techniken werden gern ausprobiert, große Verlage überbieten einander im Einsatz von VR-, AR- und anderen „immersiven“ Erzählweisen. Und nichts davon hebt ab. Technische Comic-Spielereien sind eine Vorstufe zu neuen Filmstandards – die Produktion ist günstiger, man kann schneller etwas ausprobieren und hat in der Situation der Einzelnutzung mehr Freiraum als im Kinosaal. Trotzdem bleibt 3D die einzig breitenwirksame Technik-Innovation, die in wirklich vielen Produktionen angewendet wird. Hier wird viele Energie aufgebracht – der Nutzen ist bescheiden. Nichteinmal ganz unspektakuläre Reader-Formatehaben bis jetzt einen Standard etabliert, es schwirren noch immer unzählige Apps nebeneinander durch den Raum und die Umsätze auch der stärksten Anwendungen und Plattformen sind im Vergleich zu Print im Prozentbruchteil-Bereich.
Ganz anders bei Webcomics: Webcomics, die als einfache Bilder angelegt sind, erzielen die höchsten Reichweiten. Und sie funktionieren als Sprungbrett für Crowdfunding-Kampagnen etwa für die Produktion von Printversionen. Mit etwas Verspätung greifen auch Plattformen wie Patreon, mit denen sich kleinweise ein wenig Geld sammeln lässt.
In beiden Szenarien funktioniert Digital mit mehr oder weniger Aufwand als Vermarktungstool. Die Voraussetzung dafür ist eben, dass es dahinter ein Produkt gibt, das auch jemand haben möchte.
Indiepublisher waren vor zwei oder drei Jahren noch komplett planlos, was digitale Pläne betrifft. Das Internet spielte großteils nicht mal für Werbung und Vermarktung eine Rolle . So sehr lag der Schwerpunkt auf Handwerk, Optik und Haptik. Und so sehr sind auch die Kaufreflexe noch auf greifbare Produkte angewiesen – vor allem wenn es um Präsenz, Lesbarkeit und Archivierbarkeit geht. Ein angreifbares Heft oder Buch, das vor mir rumliegt, lese ich viel eher, als eines, das nur als Datei existiert.
Die Onlineabstinenz der Indies ist zuletzt deutlich weniger geworden. Sie bedienen Instagram (das funktioniert auch ähnlich einbahndimensional wie Printproduktionen), schreiben Newsletter und können, wenn schon nicht Webshops, so zumindest Bestellformulare einrichten.
Dabei haben einige gelernt, dass man auch online designen und schreiben kann, haben ihre Webseiten ausgebaut – und nicht allen gelingt es dabei, Lust auf ihr Produkt zu machen. Da reicht der Onlineauftritt, um zu langweilen.
Hier killt nicht das Medium das Produkt. Hier gibt es schlicht kein Produkt, das jemand haben möchte.
User holen sich ihre Produkte auf die eine oder andere Art. Sie möchten nur gern entscheiden können, ob sie etwas kaufen. Und es ist eben nicht stilvoll, Zwangsbundles zu schnüren – sei es Comicheft + Oculus VR, Flatscreen + öffentlich rechtliche Gebühr, Kindle + Amazon unlimited Account oder Festplatte + Urheberrechtsabgabe.