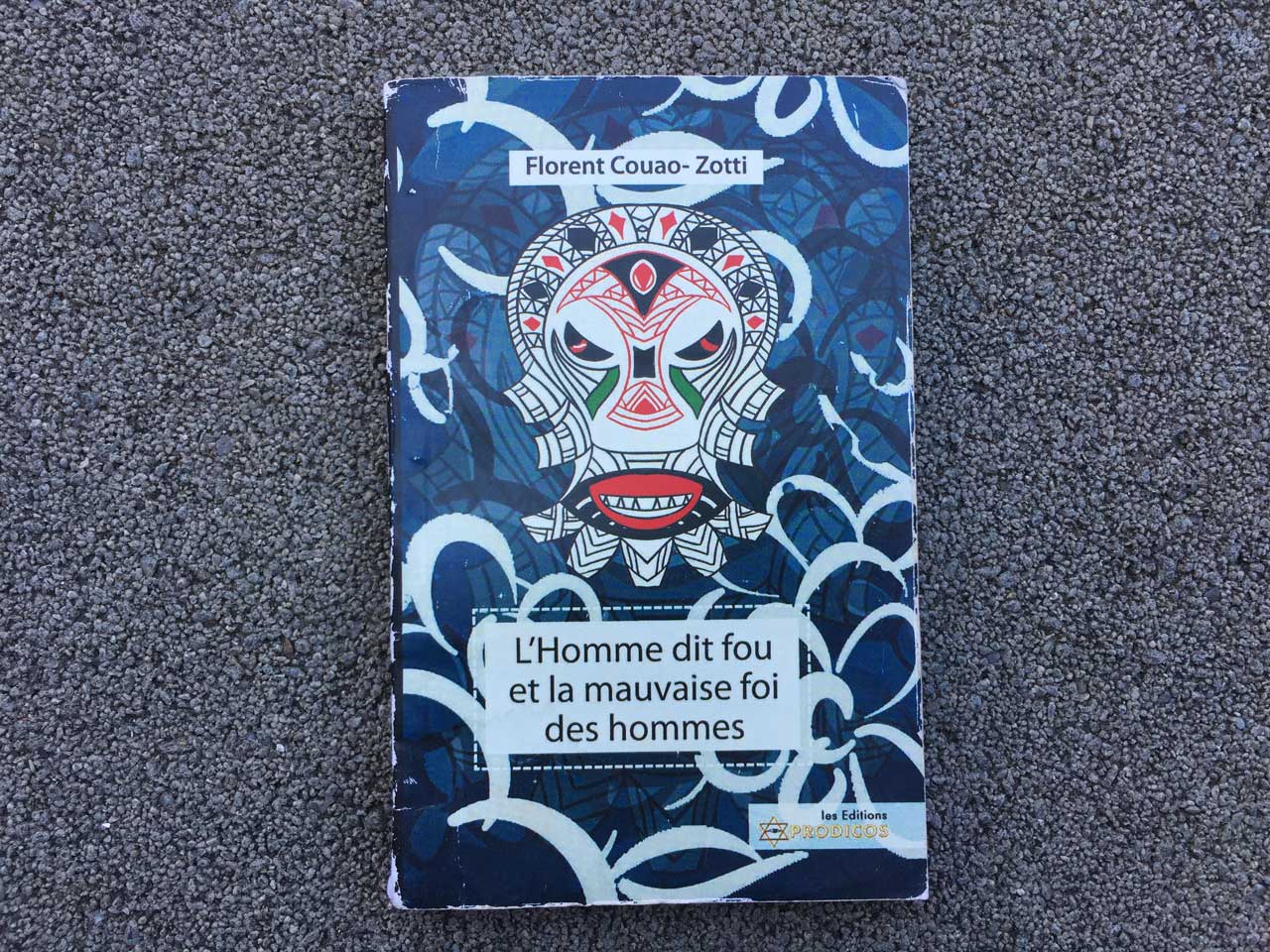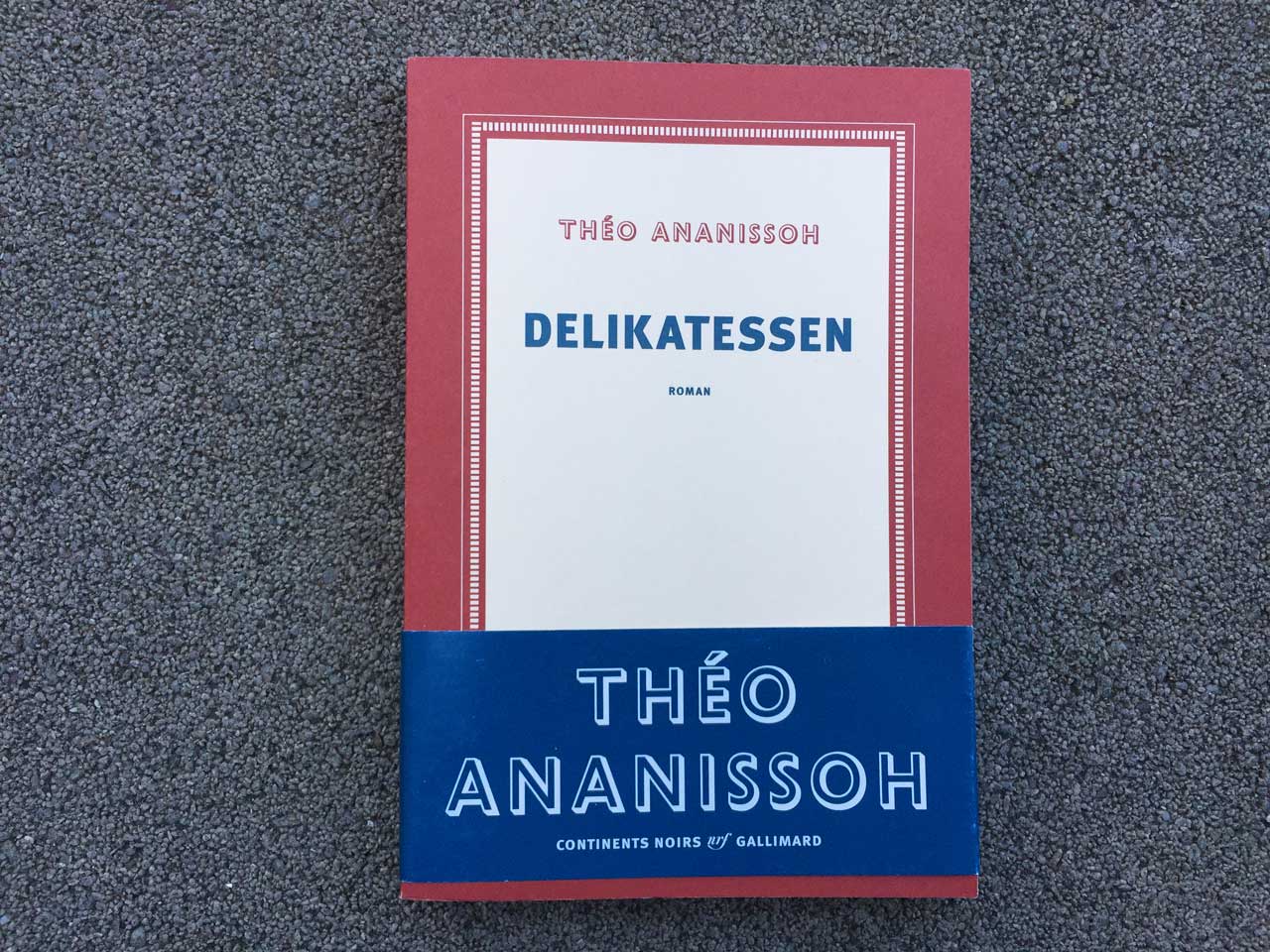Der Titel ließe eigentlich ein angriffigeres Buch vermuten: „Geht’s noch!“ heißt das neue Buch von Lisz Hirn, das sich mit aktuellen Gefahren für die Geschlechtergleichstellung beschäftigt. Im Buch findet sich dann aber eine weitgehend nüchterne Bestandsaufnahme, die kein besonders rosiges Bild der Gegenwart zeichnen.
Hirn greift Max Frischs Geschichte von Biedermann und den Brandstiftern auf – Biedermänner öffnen Brandstiftern ihre Tür statt klare Grenzen zu setzen, und natürlich geht alles in Flammen auf.
Biedermänner und Biederfrauen sind leitende Figuren in Hirns Buch, sie sind das Gegenstück zu Radikalen in alle Richtungen, sie sind jene, für die alles halb so schlimm sind und die „Das wird man doch noch sagen dürfen“ und „Früher war es einfacher“ zu ihren Leitmotiven machen.
Zwei wesentliche Gedanken unterscheiden Hirns Überlegungen von vielen anderen feministischen Diskursen.
Der erste: Sie macht Diskriminierung nicht nur am Geschlecht, sondern vor allem auch an der Mutterrolle fest. Frauen können bei vielem mit, sind formell gleichgestellt, abstrakte Diskriminierungsbeispiele können oft (ebenso abstrakt) entkräftet werden (auch wenn die Praxis eine andere Sprache spricht), Frauen können Karriere machen – aber sie müssen Entscheidungen treffen. Sobald Mutterschaft ins Spiel kommt, verändert sich das Bild. Kind oder Karriere ist immer noch eine weibliche Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, die immer nur falsch sein kann – zumindest können jede Menge Einwände ins Feld geführt werden, egal wie die Entscheidung getroffen wurde. Das sind Mechanismen, die Frauen kritisieren, in die Pflicht nehmen und mit Entscheidungen belasten – obwohl der ganze Themenkomplex grundsätzlich nicht ausschließlich Frauensache ist. Als zugespitztes Gedankenexperiment lädt Hirn dazu sein, sich vorzustellen, anstelle von Frauenquoten gäbe es Mütterquoten …
Der zweite Punkt: Hirn schreibt auch mit dem Blick auf Männerrollen. Emanzipation von Geschlechterrollen ist eine Entwicklung, die auch vor Männern nicht halt macht. Das betrifft männliche Privilegien genauso wie Zwänge, Verpflichtungen und Einschränkungen, die vorrangig Männer betreffen. „Auch wenn es weht tut: Emanzipation kann nur nachhaltig gelingen, wenn sich mit den Frauen auch die Männer emanzipieren.“
Mit der Bereitschaft, auch Männerrollen anders zu sehen (oder Männlichkeit, so wie sie traditionell und nach wie vor mehrheitlich gesehen wird, überhaupt erst als Rolle zu verstehen), entsteht die Möglichkeit, neue Verhältnisse zuzulassen. Diese Art der Emanzipation ist eine Entwicklung, die vorrangig Männer selbst durchlaufen müssen. Die – vorrangig von Biedermännern und Biederfrauen ausgehende – Gefahr dabei ist, die Verantwortung für diese Entwicklung wiederum Frauen in die Schuhe zu schieben, sei es durch Kindererziehung oder durch Alarmismus in der politischen Diskussion. Männliche Emanzipation dagegen wäre eher als Reifeprozess der Männer zu sehen.
Das Buch erzählt vielleicht nichts zwingend neues, aber es leuchtet neue Facetten aus und setzt etwas andere Schwerpunkte, als sie sonst in der Diskussion vorherrschen.
Ich habe eigentlich nur zwei kleine Einwände, die an der Sache nichts ändern, sondern eher nur eine nerdige Frage der Textgenauigkeit sind: Lisz Hirn sieht politische Entwicklungen als mitverantwortlich, manchmal klingt es sogar so als wären sie ursächlich für neue konservative Tendenzen; „Niemand hätte sich früher als konservativ bezeichnet.“ – Dem möchte ich entgegenhalten, dass Österreich nie nicht-konservativ oder traditionskritisch war. Gerade in Bezug auf Geschlechterrollen zieht sich das Reaktionärkonservative durch alle politischen Lager, und Tradition war praktisch immer ein liebliches Abziehbild, das gern auch mit einem Augenzwinkern für alles eingesetzt werden kann und alles entschuldigt. Vor zehn Jahren, nach zwei aufeinanderfolgenden sozialdemokratischen Wahlsiegen und zwei Jahre nach Schwarz-Blau startete ausgerechnet die tiefrote, aus der Zentralsparkasse hervorgegangene Bank Austria eine neue Werbelinie: „Konservativ liegt voll im Trend“ und illustrierte sie mit Fotos von patschentragend zeitunglesenden Männern und kopftuchtragenden Frauen. – Damals war es allerdings nur Werbung, heute ist es Regierungspolitik.
Der zweite Kritikpunkt betrifft die Rückkehr zur Natur, hinter der sich das Vorbild der Natürlichkeit als neues zusätzliches Unterdrückungsinstrument verbirgt. Lisz Hirn sieht hier erstaunliche Parallelen zwischen linksorientierten Ökos und Konservativen – beide Seiten seien gegen hormonelle Medikamente, ähnlich wie sie auch gegen Impfungen seien. Ich sehe solche Parallelen auch, allerdings eher zwischen linksorientierten Ökos und dem rechten Rand – in beiden Szenen gibt es seltsame Esoterikphantasien; links und rechts sind oft schwer zu unterscheiden. Die Natürlichkeit, die Konservative propagieren, ist dagegen eher eine von Kultivierthiet geprägte Natürlichkeit; Natürlichkeit ist hier das Gegenstück zu Aufdringlichkeit, Natürlichkeit ist das Verhalten, das (von Gott oder der Tradition) vorgegebenen Rollen entspricht. – Man soll das Makeup einer Frau vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, aber rasieren soll sie sich bitte schon, und die Absätze nicht zu hoch. Da “natürliche” Frauenbild, das mir hier in den Sinn kommt, ist das zurückhaltender Frauen auf Burschenschafterveranstaltungen, oder das jener, deren Neigung zur Hausarbeit, wie es die Sozialministerin sieht, in ihrer Natur festgelegt sein soll.
Gerade dieser letzte Punkt zeigt aber eher, wie verworren die Diskussion sein kann und wie wichtig eine klare analytische Sicht ist. Also lest dieses Buch. Denn letztlich – insofern bin ich schon auf ein nächstes Buch gespannt – ist für Hirn auch Emanzipation nur eine Spielart einer grundlegenden Freiheit, nämlich jener Freiheit, Dingen ins Auge sehen zu können um sich mit den großen Fragen beschäftigen zu können, jenseits von vorschnellen Antworten und zweckorientierten wirtschaftspolitischen Banalitäten. Und große Fragen wird es in den nächsten Jahren schließlich genug geben.